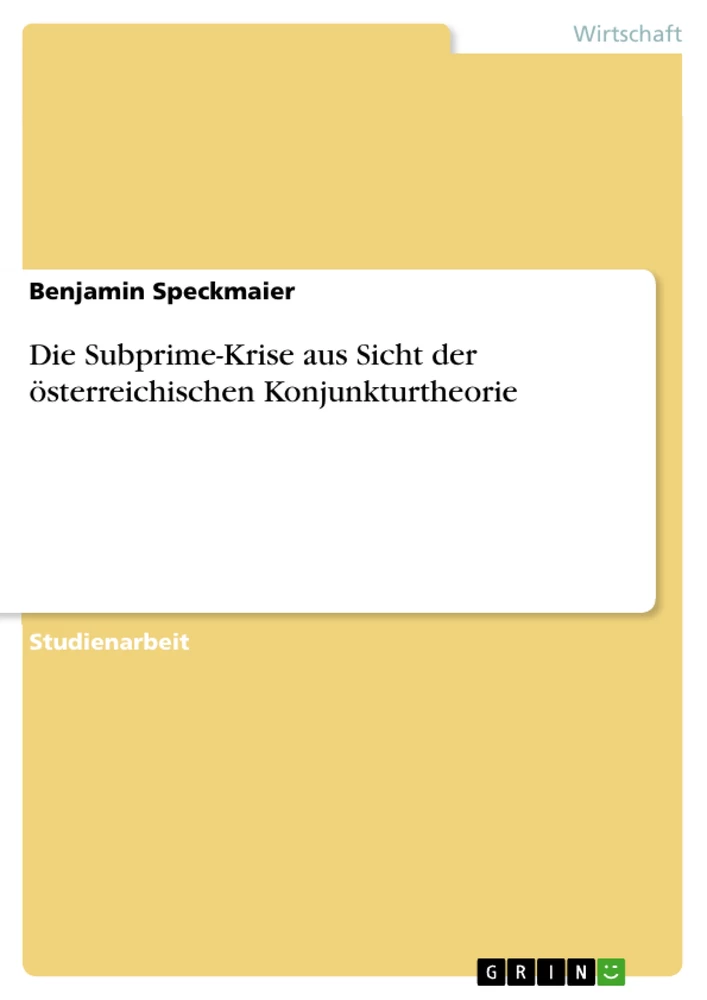Im Sommer 2007 platzte die Preisblase am amerikanischen Wohnimmobilienmarkt. Das war der Beginn der globalen Finanzkrise, die im Herbst 2008 zu einer weltweiten Wirtschaftskrise führte. Für die Weltwirtschaft bedeutete das die größten Verwerfungen seit der Weltwirtschaftskrise von 1929.
In der öffentlichen Diskussion werden die Ursachen der Krise oft in der Gier von Managern und Banken sowie einer nicht ausreichenden Regulierung der Finanzmärkte gesehen. Zweifelsohne begünstigten die Marktgegebenheiten opportunistische Verhaltensweisen bestimmter Akteure, die Grundlagen für spekulative Übertreibungen werden jedoch von politischen Institutionen geschaffen.
Die Konjunkturtheorie der Österreichischen Schule der Nationalökonomie ist ein zentraler Ansatz zur Erklärung von Wirtschaftszyklen. Mit ihrer Hilfe kann die Subprime Krise aus mikroökonomischer Sicht erklärt werden. Den Ausgangspunkt
stellen dabei systembedingte Eingriffe in den natürlichen Marktprozess dar.
Ziel dieser Seminararbeit ist es den Verlauf und die Auswirkungen der Subprime Krise darzustellen. Mithilfe der Österreichischen Konjunkturtheorie sollen die zu hohe Liquiditätsversorgung und die überdurchschnittlichen Renditen auf dem amerikanischen
Wohnimmobilienmarkt als Ursachen der Krise identifiziert werden.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Subprime Krise
3. Die Österreichische Schule und ihre Konjunkturtheorie
3.1. Die Österreichische Schule der Nationalökonomie
3.2. Die Österreichische Konjunkturtheorie
3.2.1. Geldproduktion in einem Teilreserve Bankensystem
3.2.2. Natürlicher Zins und Marktzins
3.2.3. Der Konjunkturzyklus
3.2.4. Erkenntnisse der Österreichischen Konjunkturtheorie
4. Die Subprime Krise aus Sicht der Österreichischen Konjunkturtheorie
4.1. Das Entstehen einer globalen Liquiditätsschwemme
4.2. Der US Immobilienmarkt
5. Zusammenfassung
6. Fazit
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was war die Hauptursache der Subprime-Krise laut der Österreichischen Schule?
Die Krise wird auf systembedingte Eingriffe in den Marktprozess zurückgeführt, insbesondere auf eine zu hohe Liquiditätsversorgung und künstlich niedrige Zinsen, die zu spekulativen Übertreibungen am Immobilienmarkt führten.
Was versteht man unter der Österreichischen Konjunkturtheorie?
Diese Theorie erklärt Wirtschaftszyklen durch die Abweichung des Marktzinses vom natürlichen Zins, was zu Fehlinvestitionen und schließlich zu einer Bereinigungskrise führt.
Welche Rolle spielt das Teilreserve-Bankensystem in der Krise?
In einem Teilreserve-System können Banken durch Giralgeldschöpfung die Geldmenge ausweiten, was laut der Österreichischen Schule die Entstehung von Preisblasen begünstigt.
Warum platzte die Preisblase am US-Wohnimmobilienmarkt 2007?
Nach einer Phase überdurchschnittlicher Renditen und massiver Kreditausweitung konnten viele Kreditnehmer ihre Raten nicht mehr bedienen, was zu einem globalen Vertrauensverlust im Finanzsystem führte.
Wie unterscheidet sich diese Sichtweise von der öffentlichen Diskussion?
Während oft Gier und mangelnde Regulierung betont werden, sieht die Österreichische Schule die Ursachen primär in der Geldpolitik politischer Institutionen.
- Arbeit zitieren
- Benjamin Speckmaier (Autor:in), 2011, Die Subprime-Krise aus Sicht der österreichischen Konjunkturtheorie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196908