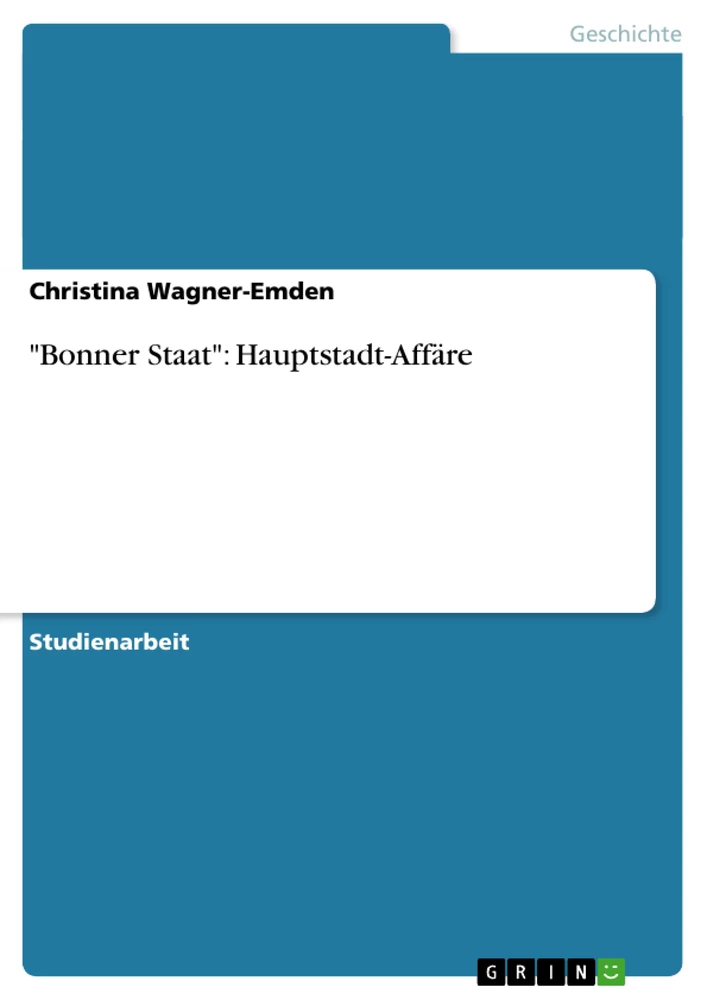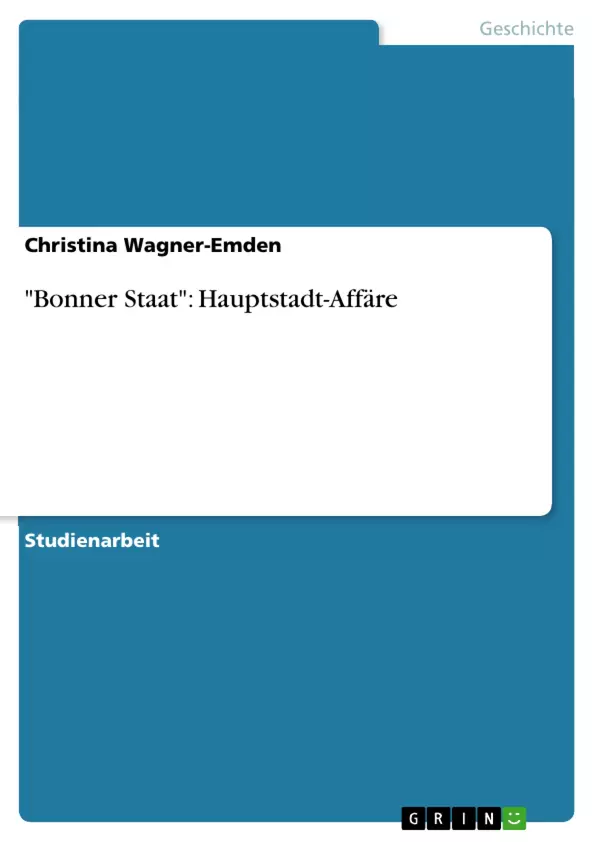I. Einleitung
Die Hauptstadt-Affäre 1950-1951 ist nicht nur Ausgangspunkt für die sich ent-wickelnde Skandalkultur der Bundesrepublik Deutschland, sie zeigt auch institutio-nelle Schwachstellen der jungen Demokratie auf. Die vorliegende Arbeit versucht dabei vor allem, den dynamischen Prozeß der politischen Affäre einzufangen.
Um das Spezifische der Hauptstadt-Affäre herauszustellen, geht der Analyse ihrer Teilsegmente jeweils eine kurze allgemeine Definition der Skandalelemente voraus. Letztere richtet sich nach der Arbeit von John B. Thompson.
Was waren das ursprüngliche Skandalon und dessen wesentliche Bedeutung? Kam es im Verlauf der Ereignisse zu weiteren Normübertretungen? Auf welchem Wege konnte das skandalierte Verhalten, von dem zu vermuten wäre, daß es geheim gehalten wurde, an die Öffentlichkeit gelangen? Diese Fragen führen zum Skandalierer – dem Nachrichtenmagazin »Der Spiegel«. Seine Position im und Bedeutung für die Hauptstadt-Affäre sollen genauer betrachtet werden.
Ferner ist die öffentliche Mißbilligung des skandalierten Verhaltens in der Berichter-stattung der deutschen Presse zu analysieren. Es steht zur Diskussion, ob die von den Medien vertretenen Meinungen als für die Bevölkerung der BRD repräsentativ anzu-sehen sind und wie die Einstellung letzterer zu den Geschehnissen in und um Bonn einzuschätzen ist. Auch das aus der Hauptstadt-Affäre resultierende Verhalten des Deutschen Bundestages soll untersucht werden.
Über den gesamten Verlauf des Skandals beschränken sich die Vorwürfe in der Hauptstadt-Affäre nicht auf Korruption bei der Wahl Bonns, sondern erstrecken sich auf weitere Fälle der Abgeordnetenbestechung. Die enge Verknüpfung beider Kom-plexe macht es notwendig, daß auch letztere in die Betrachtung eingehen.
Als Quellen stehen neben stenographischen Berichten von den Verhandlungen des Deutschen Bundestages vor allem Tageszeitungen und das Wochenmagazin »Der Spiegel« zur Verfügung. Aufgrund ihrer Überregionalität und um ein möglichst brei-tes Spektrum politischer Meinungen abzudecken, werden »Die Welt«, die »Süddeutsche Zeitung« sowie die »Frankfurter Allgemeine Zeitung« berücksichtigt.
Leserbriefe und Umfrageergebnisse von Emnid sowie dem Institut für Demoskopie Allensbach sollen die Stimmung in der deutschen Bevölkerung widerspiegeln.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Das politische Feld
- III. Das Skandalon
- 1. Das Skandalon – 27. September 1950
- a) Korruption bei der Wahl der vorläufigen Bundeshauptstadt
- b) Käuflichkeit von Abgeordneten in anderen Fragen
- c) Die wesentliche Normübertretung
- 2. >>Second-order transgressions<<
- IV. Verborgenheit und Bekanntwerden
- 1. Gerüchte im Bundestag
- 2. Das Wissen in der Bayernpartei
- V. Der Skandalierer
- VI. Öffentliche Bekundung der Mißbilligung durch Unbeteiligte
- 1. Die Printmedien
- a) Zum Verlauf der Berichterstattung in der Presse
- b) Von den Printmedien thematisierte Hintergründe des Skandals
- 2. Der Deutsche Bundestag
- a) Die Debatte am 5. Oktober 1950
- b) Der Untersuchungsausschuß (»Spiegel«<-Ausschuß)
- 3. Die deutsche Bevölkerung
- 4. Vergleichende Darstellung der öffentlichen Mißbilligung
- VII. Die Gefahr einer Schädigung der Reputation
- VIII. Schluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Bonner Hauptstadt-Affäre von 1950-1951. Ziel ist es, den dynamischen Prozess dieser politischen Affäre zu analysieren und die institutionellen Schwachstellen der jungen Bundesrepublik aufzuzeigen. Die Analyse betrachtet die Entwicklung des Skandals von seinem Ursprung bis zu seiner öffentlichen Bekanntmachung.
- Der Prozess der Entstehung und Eskalation des Skandals
- Die Rolle der Medien (insbesondere "Der Spiegel") bei der Aufdeckung und Berichterstattung
- Die öffentliche Reaktion und die Meinungsbildung in der Bevölkerung
- Die Auswirkungen des Skandals auf die Reputation beteiligter Personen und Institutionen
- Vergleichende Analyse der öffentlichen Missbilligung und der Reaktionen der beteiligten Parteien und Institutionen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Bonner Hauptstadt-Affäre ein und skizziert die Forschungsfrage, die sich mit der dynamischen Entwicklung des Skandals, seinen institutionellen Ursachen und der Rolle der Medien auseinandersetzt. Sie beschreibt die methodische Herangehensweise, die auf der Arbeit von John B. Thompson basiert und die ausgewählten Quellen benennt, darunter Zeitungen wie "Die Welt", "Süddeutsche Zeitung" und "Frankfurter Allgemeine Zeitung" sowie das Magazin "Der Spiegel", Umfrageergebnisse und stenographische Berichte des Bundestages. Die Einleitung betont die begrenzte Forschungsliteratur zum Thema und die Notwendigkeit einer primär quellenbasierten Analyse.
II. Das politische Feld: (Kapitelbeschreibung fehlt im Ausgangstext, daher keine Zusammenfassung möglich)
III. Das Skandalon: Dieses Kapitel beschreibt den Skandal um die Wahl Bonns zur Bundeshauptstadt im September 1950. Es analysiert verschiedene Aspekte der Korruption, darunter die Bestechung von Abgeordneten bei der Abstimmung und in anderen politischen Entscheidungen. Es unterscheidet zwischen dem ursprünglichen Skandal ("Skandalon") und "Second-order transgressions", weiteren Normverletzungen, die im Zuge der Ereignisse ans Licht kamen. Die Analyse dieser Normübertretungen und deren Bedeutung für das Gesamtgeschehen bildet den Schwerpunkt des Kapitels.
IV. Verborgenheit und Bekanntwerden: Dieses Kapitel beschreibt den Weg des Skandals in die Öffentlichkeit. Es untersucht die Verbreitung von Gerüchten im Bundestag und das Wissen innerhalb der Bayernpartei, bevor die Affäre öffentlich bekannt wurde. Es analysiert die Mechanismen und Akteure der Informationsverbreitung und -kontrolle im Vorfeld der öffentlichen Aufdeckung.
V. Der Skandalierer: (Kapitelbeschreibung fehlt im Ausgangstext, daher keine Zusammenfassung möglich)
VI. Öffentliche Bekundung der Mißbilligung durch Unbeteiligte: Dieses Kapitel analysiert die öffentliche Reaktion auf den Skandal. Im Fokus steht die Berichterstattung der Printmedien, der Verlauf der Debatte im Deutschen Bundestag, inklusive der Einrichtung eines Untersuchungsausschusses und die öffentliche Meinung in der Bevölkerung, die anhand von Umfrageergebnissen und Leserbriefen erforscht wird. Das Kapitel vergleicht diese Reaktionen und wertet ihre Bedeutung für die Entwicklung des Skandals aus.
VII. Die Gefahr einer Schädigung der Reputation: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen des Skandals auf das Ansehen verschiedener Akteure, darunter der Bundestag, der Bundesfinanzminister Schäffer, einzelne Abgeordnete und die Bayernpartei. Es analysiert, wie der Skandal das symbolische Kapital der Beteiligten beeinträchtigte und die damit verbundenen Folgen.
Schlüsselwörter
Hauptstadt-Affäre, Bonn, Korruption, Abgeordnetenbestechung, "Der Spiegel", Bundestag, öffentliche Meinung, Reputationsverlust, Skandalkultur, institutionelle Schwachstellen, Bundesrepublik Deutschland, Presseberichterstattung, Untersuchungsausschuß.
Häufig gestellte Fragen zur Bonner Hauptstadt-Affäre (1950-1951)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Bonner Hauptstadt-Affäre von 1950-1951. Sie untersucht den dynamischen Prozess dieser politischen Affäre, legt institutionelle Schwachstellen der jungen Bundesrepublik offen und betrachtet die Entwicklung des Skandals von seinem Ursprung bis zur öffentlichen Bekanntmachung.
Welche Aspekte der Hauptstadt-Affäre werden untersucht?
Die Analyse umfasst die Entstehung und Eskalation des Skandals, die Rolle der Medien (besonders "Der Spiegel") bei der Aufdeckung und Berichterstattung, die öffentliche Reaktion und Meinungsbildung, die Auswirkungen auf die Reputation beteiligter Personen und Institutionen sowie einen Vergleich der öffentlichen Missbilligung und der Reaktionen der beteiligten Parteien und Institutionen.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf eine primär quellenbasierte Analyse. Verwendete Quellen sind Zeitungen wie "Die Welt", "Süddeutsche Zeitung" und "Frankfurter Allgemeine Zeitung", das Magazin "Der Spiegel", Umfrageergebnisse und stenographische Berichte des Bundestages.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Das politische Feld, Das Skandalon (inkl. "Second-order transgressions"), Verborgenheit und Bekanntwerden, Der Skandalierer, Öffentliche Bekundung der Missbilligung durch Unbeteiligte (Printmedien, Bundestag, Bevölkerung), Die Gefahr einer Schädigung der Reputation und Schluss. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Affäre.
Was ist das "Skandalon" und was sind "Second-order transgressions"?
Das "Skandalon" bezeichnet den ursprünglichen Skandal um die Wahl Bonns zur Bundeshauptstadt im September 1950, inklusive Korruption und Bestechung von Abgeordneten. "Second-order transgressions" sind weitere Normverletzungen, die im Zuge der Ereignisse ans Licht kamen.
Welche Rolle spielten die Medien, insbesondere "Der Spiegel"?
Die Arbeit untersucht die Rolle der Medien, besonders "Der Spiegel", bei der Aufdeckung und Berichterstattung des Skandals. Analysiert wird der Verlauf der Berichterstattung und deren Einfluss auf die öffentliche Meinung.
Wie reagierte die Öffentlichkeit auf den Skandal?
Die öffentliche Reaktion wird anhand der Berichterstattung der Printmedien, der Debatte im Bundestag (inkl. Untersuchungsausschuss), und der öffentlichen Meinung (Umfrageergebnisse, Leserbriefe) analysiert und vergleichend dargestellt.
Welche Auswirkungen hatte der Skandal auf die Reputation der Beteiligten?
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen des Skandals auf das Ansehen des Bundestages, des Bundesfinanzministers Schäffer, einzelner Abgeordneter und der Bayernpartei, und analysiert den Verlust an symbolischem Kapital.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hauptstadt-Affäre, Bonn, Korruption, Abgeordnetenbestechung, "Der Spiegel", Bundestag, öffentliche Meinung, Reputationsverlust, Skandalkultur, institutionelle Schwachstellen, Bundesrepublik Deutschland, Presseberichterstattung, Untersuchungsausschuß.
- Citar trabajo
- Christina Wagner-Emden (Autor), 2002, "Bonner Staat": Hauptstadt-Affäre , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197091