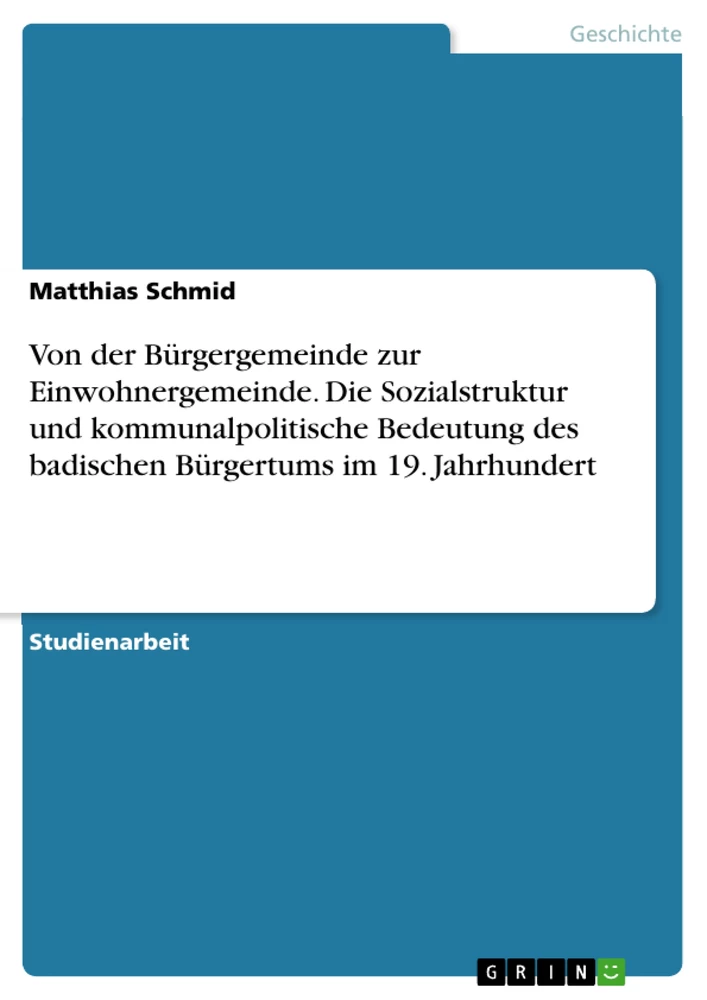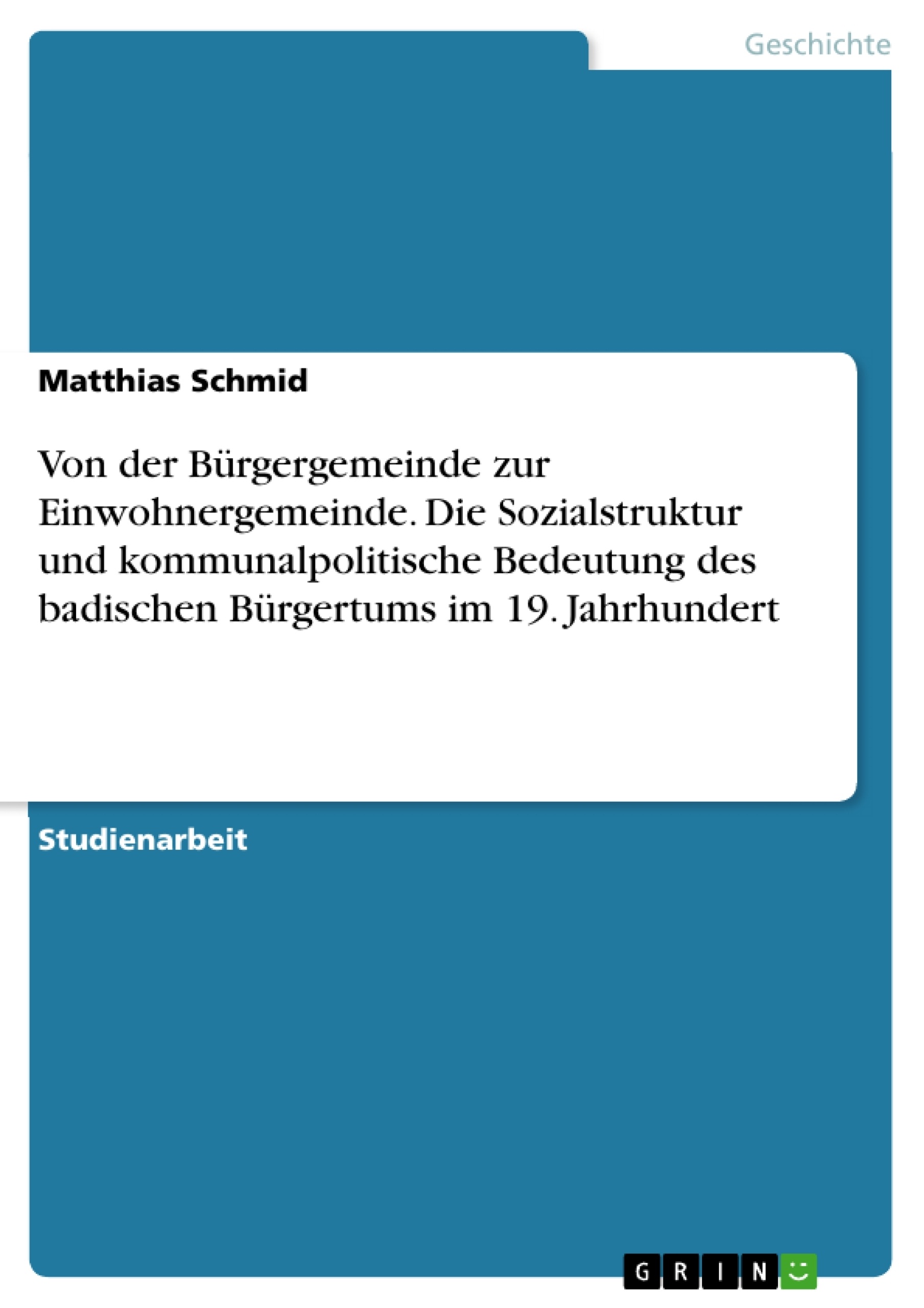Der Urbanisierungsprozeß im 19. Jahrhundert führte zu einem sozialen, rechtlichen und politischen Wandel innerhalb der städtischen Gesellschaft. Wie sich dieser Wandel vollzog, soll in dieser Arbeit an dem Beispiel des Großherzogtums Baden näher erläutert werden.
Im Mittelpunkt der städtischen Gesellschaft stand im 19. Jahrhundert das Bürgertum, das eine "unauflösliche Einheit" mit den Institutionen der Stadt bildete.
Wie entwickelte und veränderte sich nun die Sozialstruktur und die kommunalpolitische Bedeutung des badischen Bürgertums im 19. Jahrhundert?
Was waren die wesentlichen und entscheidenden Voraussetzungen dafür, dass der Übergang von der Bürger- zur Einwohnergemeinde in Baden vollzogen werden konnte, und wie wirkte sich das Prinzip der Einwohnergemeinde auf die städtische Bevölkerung aus?
Diese zentralen Fragen sollen in dieser Seminarrabeit erörtert werden.
Inhaltsverzeichnis:
Einleitung
I. Die allgemeine Entwicklung der badischen Städte im 19. Jahrhundert
II. Die Sozialstruktur und kommunalpolitische Bedeutung des badischen Bürgertums im 19. Jahrhundert
1. Die badische Gemeindeordnung von 1831
a) Inhalte und Bestimmungen der Gemeindeordnung
b) Folgen und Auswirkungen
2. Nach der Revolution 1848/49. Die rechtlichen und sozialen Entwicklungen und Veränderungen im badischen Bürgertum in den Jahren 1850 bis 1870
3. Von der Bürgergemeinde zur Einwohnergemeinde
a) Die badische Städteordnung von 1874 und 1884
b) Soziale, rechtliche und politische Auswirkungen der Städteordnung auf die badische Stadtbevölkerung
Resümee
Quellen- und Literaturverzeichnis
- Quote paper
- Matthias Schmid (Author), 2002, Von der Bürgergemeinde zur Einwohnergemeinde. Die Sozialstruktur und kommunalpolitische Bedeutung des badischen Bürgertums im 19. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197188