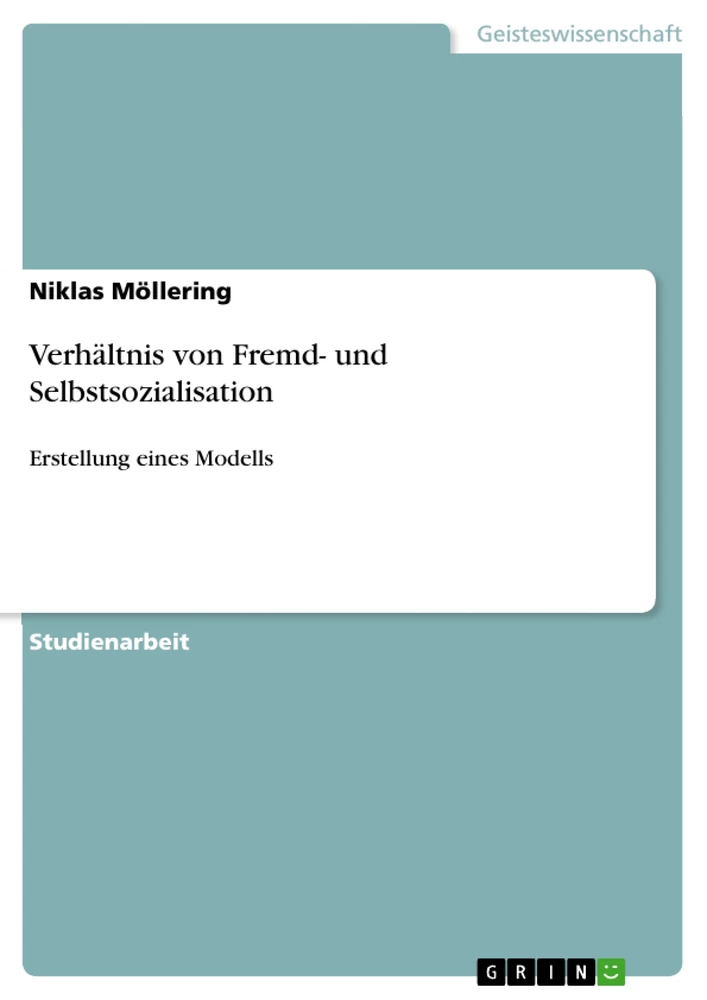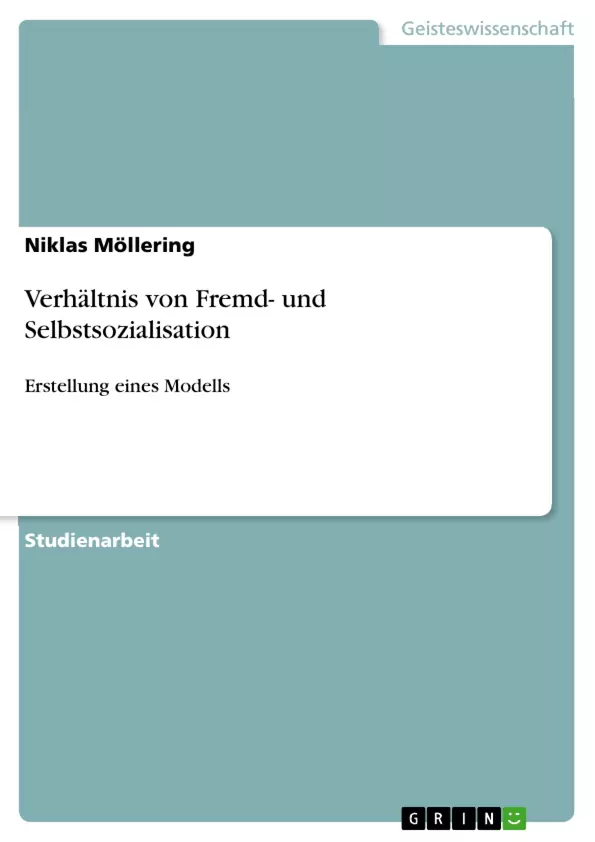Bevor in dieser Arbeit das Verhältnis von Selbst- und Fremdsozialisation genauer unter die Lupe genommen wird, soll vorab eine kurze Definition klären, wie die Forschung den Begriff Sozialisation zu fassen versucht. Hannelore Faulstich-Wieland versteht unter „Sozialisation [...] den Prozess, in dem ein Mensch zum integrierten Angehörigen seiner kulturellen und gesellschaftlichen Bezugsgruppe wird. Dieser Prozess stellt eine aktive Auseinandersetzung des Einzelnen mit seiner materiellen wie sozialen Umwelt dar. [...] Für die Person selbst bedeutet der Sozialisationsprozess die Entwicklung einer eigenen Identität, welche die Person zu etwas einzigartigem macht, das dennoch nicht isoliert und unverbunden dasteht.1 Aus dieser Definition geht hervor, dass Sozialisation aus mehreren Faktoren bestehen muss, welche im folgendem vorgestellt werden. Schon Karl Groos stellte 1904 fest, dass sich die Entwicklung eines Kindes anhand dreier Komponenten vollzieht. Er benennt sie als Spontanes Wachstum, Selbstausbildung und Fremdausbildung, wobei der Aspekt des Spontanen Wachstums in Bezug auf Sozialisation außer Acht gelassen werden kann. Wichtiger hingegen sind die Punkte der Selbst- und Fremdausbildung, welche er dahingehend differenziert, dass es zu einer unabsichtlichen und absichtlichen Selbst- bzw. Fremdausbildung kommen kann.2 [...] 1 Vgl. Faulstich-Wieland, Hannelore (2002): Sozialisation in Schule und Unterricht. Neuwied, Kriftel: Luchterhand. S.7. 2 Vgl. Zinnecker,Jürgen (2000): Selbstsozialisation. Essay über ein aktuelles Konzept. In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, Jg. 20, H. 3, S.276 f.
Inhaltsverzeichnis:
1. Das Verhältnis von Fremd- und Selbstsozialisation Entwurf eines Modells
1.1 Fazit:
Bibliographie:
1. Das Verhältnis von Fremd- und Selbstsozialisation - Entwurf eines Modells
Bevor in dieser Arbeit das Verhältnis von Selbst- und Fremdsozialisation genauer unter die Lupe genommen wird, soll vorab eine kurze Definition klären, wie die Forschung den Begriff Sozialisation zu fassen versucht. Hannelore Faulstich-Wieland versteht unter
„Sozialisation [...] den Prozess, in dem ein Mensch zum integrierten Angehörigen seiner kulturellen und gesellschaftlichen Bezugsgruppe wird. Dieser Prozess stellt eine aktive Auseinandersetzung des Einzelnen mit seiner materiellen wie sozialen Umwelt dar. [...] Für die Person selbst bedeutet der Sozialisationsprozess die Entwicklung einer eigenen Identität, welche die Person zu etwas einzigartigem macht, das dennoch nicht isoliert und unverbunden dasteht.[1]
Aus dieser Definition geht hervor, dass Sozialisation aus mehreren Faktoren bestehen muss, welche im folgendem vorgestellt werden.
Schon Karl Groos stellte 1904 fest, dass sich die Entwicklung eines Kindes anhand dreier Komponenten vollzieht. Er benennt sie als Spontanes Wachstum, Selbstausbildung und Fremdausbildung, wobei der Aspekt des Spontanen Wachstums in Bezug auf Sozialisation außer Acht gelassen werden kann. Wichtiger hingegen sind die Punkte der Selbst- und Fremdausbildung, welche er dahingehend differenziert, dass es zu einer unabsichtlichen und absichtlichen Selbst- bzw. Fremdausbildung kommen kann.[2]
Zwar entstammt diese These den Anfangsjahren deutscher Kinderforschung, doch ist sie für Jürgen Zinneckers Essay von zentraler Bedeutung, da er den Begriff der Selbstausbildung mit dem der Selbstsozialisation gleichsetzt und die Fremdausbildung als Fremdsozialisation betitelt. Vor allem der Begriff der Fremdsozialisation hat immer etwas mit pädagogischer Lenkung zu tun und findet vor allem in Familien, Krippen, Kindergärten, Schulen oder Peer-Groups statt.[3] Um diesen Sachverhalt zu verdeutlichen kann vor allem die Systemtheorie von Urie Bronfenbrenner herangezogen werden. Bronfenbrenner unterscheidet in Mikro-, Meso-, Exo-, und Makrosysteme, in denen die alltägliche Lebensführung vollzogen wird.
Das Mikrosystem stellt die gesamte Erlebenswelt des Individuums dar und ist aus diesem Grund den anderen Systemen übergeordnet. Das Mesosystem beinhaltet die Beziehungen zu den wichtigsten Settings wie Familie, Schule oder Peers. Nach Zinnecker verlieren Sozialisationsinstanzen wie etwa die Familie immer mehr an Bedeutung, wobei die Peer-Gruops als Instanzen immer wichtiger werden.[4] Weiter unterstellt Zinnecker den Peers eine „Selbstsozialisation als Gruppenaktivität“. Seiner Auffassung nach, würden sich Jugendliche gegenseitig selbst sozialisieren.[5] Jedoch wird diese Arbeit die Sozialisation innerhalb von Peer-Groups weniger als Selbst- sondern vielmehr als beabsichtigte bzw. unbeabsichtigte Fremdsozialisation verstehen. Ein Beispiel für beabsichtigte Fremdsozialisation wäre unter anderem eine bewusste Lenkung des Musikgeschmacks bei Freunden oder der politischen Einstellung, wie es häufiger in der Punkszene vorkommt. Eine unbeabsichtigte Fremdsozialisation wäre beispielsweise das Lernen am Modell, was häufig eher beiläufig und untergründig passiert.[6] Das Exosystem ist zwar kein direkter, allerdings ein beeinflussender Lebensbereich, wie zum Beispiel die Lebenswelt der Mutter. Die Erfahrungen, die die Mutter in ihrer Lebenswelt macht überträgt sie unbeabsichtigt oder beabsichtigt auf ihr Kind. Fremdsozialisation heißt in diesem Sinne, dass das Kind Einstellungen oder Verhaltensweisen[7] der Mutter übernimmt (unbeabsichtigte Fremdsozialisation) oder gezielt gewisse Wertevorstellungen vermittelt bekommt, wie z.B. gewisse Tischmanieren beim Mittagessen. (beabsichtigte Fremdsozialisation)
[...]
[1] Vgl. Faulstich-Wieland, Hannelore (2002): Sozialisation in Schule und Unterricht. Neuwied, Kriftel: Luchterhand. S.7.
[2] Vgl. Zinnecker,Jürgen (2000): Selbstsozialisation. Essay über ein aktuelles Konzept. In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, Jg. 20, H. 3, S.276 f.
[3] Vgl. Zinnecker,Jürgen (2000): Selbstsozialisation. Essay über ein aktuelles Konzept. In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, Jg. 20, H. 3, S.276 f.
[4] Ebd., S. 282 ff.
[5] Ebd., S.282.
[6] An dieser Stelle liegt ein Streitpunkt vor, der in dieser Arbeit nicht geklärt werden kann, da unbeabsichtigte Fremdsozialisation meist eine beabsichtigte Selbstsozialisation zur Folge hat. Ein Beispiel wäre das Person A gut Fußball spielt und ein großes Maß an Anerkennung erntet. Dies macht starken Eindruck auf Person B, welche daraufhin das Verhalten nachahmt und dementsprechend trainiert. Person A hat also eine unbeabsichtigte Fremdsozialisation bei Person B durchgeführt, die daraufhin an sich feilen wollte, um das Niveau von Person A zu erreichen, was einer beabsichtigten Selbstsozialisation entspricht. Und da Fußball festen gesellschaftlichen und kulturellen Status besitzt, lässt sich diese Beispiel auch auf Sozialisation beziehen.
[7] Gemeint ist hier das Lernen am Modell nach Albert Bandura.
- Citar trabajo
- Niklas Möllering (Autor), 2009, Verhältnis von Fremd- und Selbstsozialisation, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197212