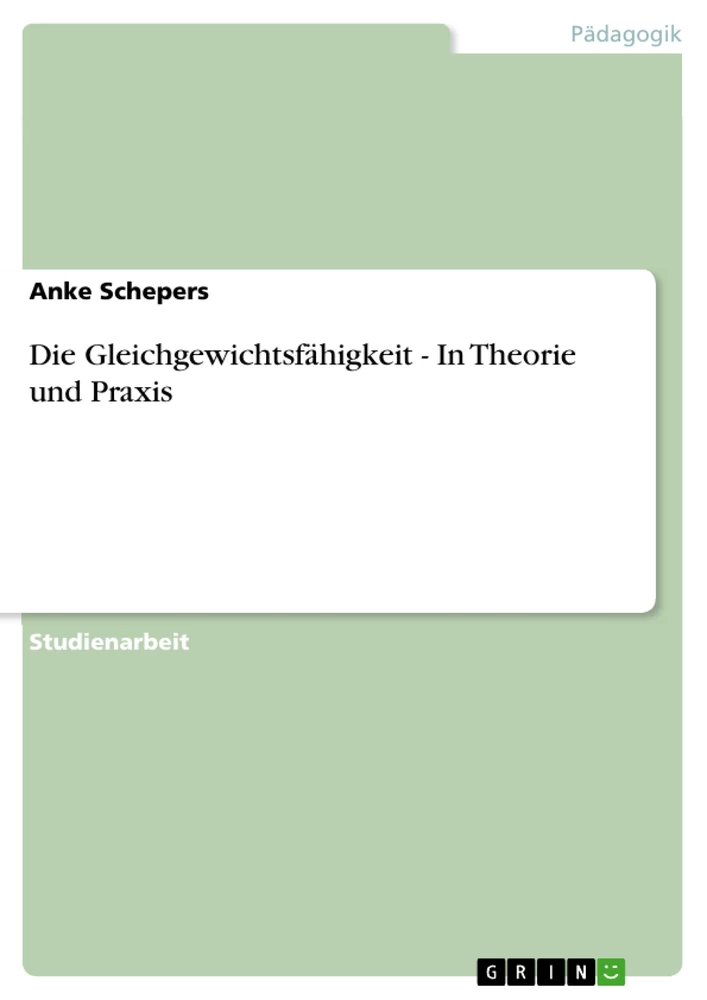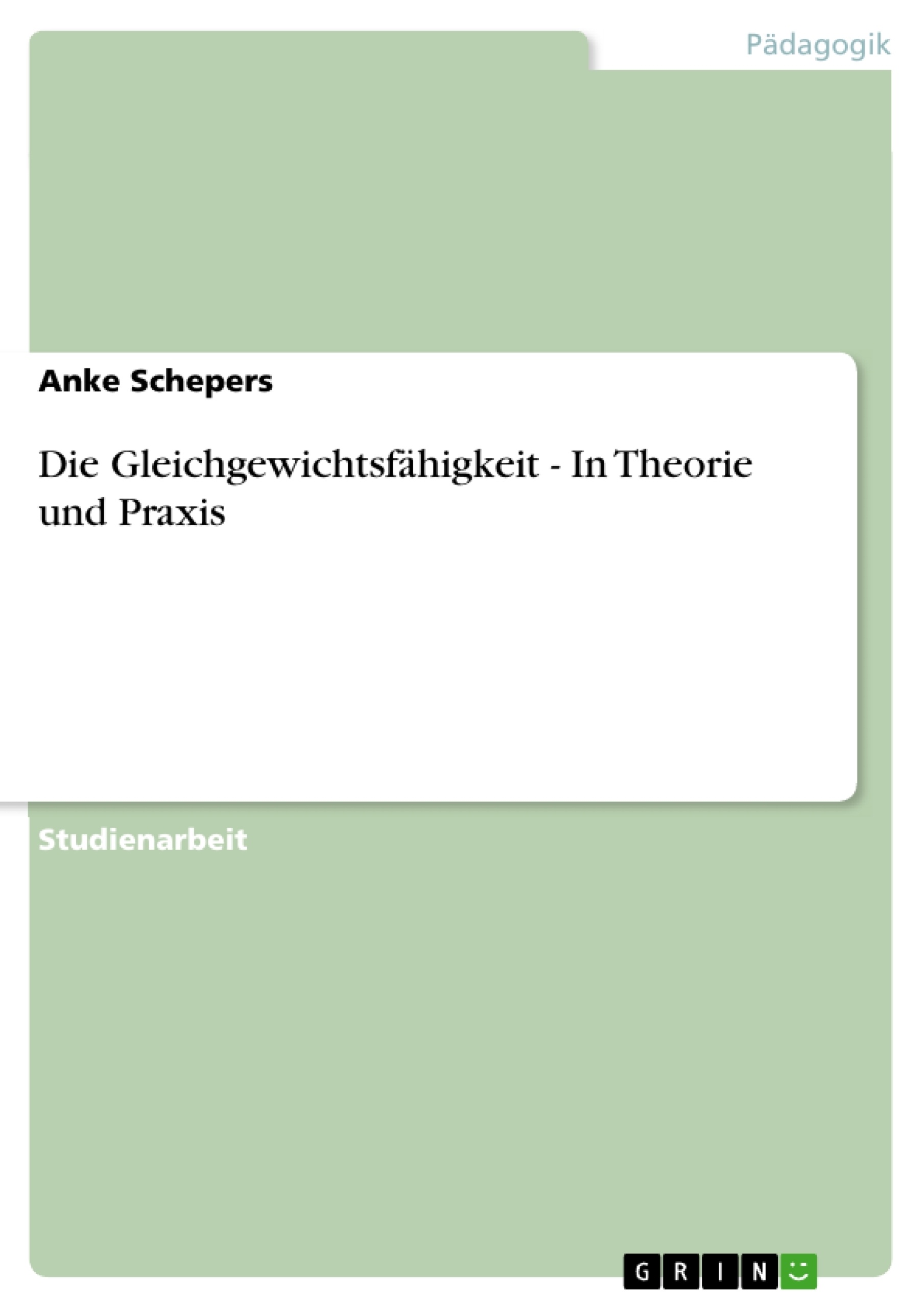Seit einigen Jahren werden die Vorwürfe, Kinder und Jugendliche werden zunehmend unsportlicher und können nicht einmal mehr eine Vorwärtsrolle turnen, geschweige denn auf einer Linie geradeaus balancieren, immer lauter.
Verantwortlich für Durchführung und Beherrschung dieser und vieler weiterer Aufgaben im Sportunterricht sind die koordinativen Fähigkeiten. Bei einigen Personen sind sie besser, bei anderen sind sie schlechter ausgebildet.
Alle sieben koordinativen Fähigkeiten lassen sich fördern und somit verbessern. Beispielhaft soll diese Arbeit zeigen, was im Bereich der Gleichgewichtsfähigkeit möglich ist. Dazu wird diese Fähigkeit zunächst in einem Theorieteil definiert und differenziert betrachtet. Daraufhin folgt ein Abschnitt, in dem Möglichkeiten für die Praxis (Übungen für den Sportunterricht) aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1 Das Gleichgewicht als koordinative Fähigkeit
- 2.2 Die drei Arten des Gleichgewichts
- 2.3 Die Analysatoren
- 2.4 Möglichkeiten zur Schulung der Gleichgewichtsfähigkeit
- 2.4.1 Bewegungsgeschichten
- 2.4.2 Abenteuerlandschaften
- 2.4.3 Kleine Spiele
- 2.4.4 Slackline
- 2.4.5 Einzel-, Partner- und Gruppenaufgaben
- 3. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gleichgewichtsfähigkeit im Kontext von Sport und Bewegungspädagogik. Ziel ist es, die Gleichgewichtsfähigkeit zu definieren, zu differenzieren und praktische Übungen für den Schulsport aufzuzeigen. Die Arbeit stützt sich dabei auf bestehende wissenschaftliche Literatur.
- Definition und Differenzierung der Gleichgewichtsfähigkeit
- Die verschiedenen Arten des Gleichgewichts (statisch, dynamisch, Objektgleichgewicht)
- Die Rolle der Analysatoren bei der Gleichgewichtskontrolle
- Methoden zur Schulung der Gleichgewichtsfähigkeit im Sportunterricht
- Praktische Übungen und Beispiele für den Schulsport
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung thematisiert den zunehmenden Mangel an koordinativen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Sie führt in das Thema der Gleichgewichtsfähigkeit ein und kündigt die Struktur der Arbeit an: eine theoretische Betrachtung der Gleichgewichtsfähigkeit gefolgt von praktischen Übungen für den Sportunterricht. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der Gleichgewichtsfähigkeit für sportliche Aktivitäten und den Alltagsbewegungen. Die Einleitung verweist auf die Notwendigkeit der Förderung koordinativer Fähigkeiten und positioniert die Arbeit als exemplarische Betrachtung der Gleichgewichtsfähigkeit innerhalb der koordinativen Fähigkeiten.
2. Hauptteil: Der Hauptteil liefert eine detaillierte Darstellung der Gleichgewichtsfähigkeit. Er beginnt mit einer Definition der koordinativen Fähigkeiten im Allgemeinen und positioniert die Gleichgewichtsfähigkeit als eine zentrale koordinative Fähigkeit mit dominierender Rolle in der Alltags- und Sportmotorik. Anschließend werden die verschiedenen Arten des Gleichgewichts (statisch, dynamisch, Objektgleichgewicht) differenziert und anhand verschiedener Autoren diskutiert. Die unterschiedlichen Definitionen und die Schwierigkeiten der Abgrenzung werden hervorgehoben. Die Rolle der Analysatoren bei der Wahrnehmung und Regulation des Gleichgewichts wird erläutert. Abschließend werden diverse Möglichkeiten zur Schulung der Gleichgewichtsfähigkeit im Sportunterricht vorgestellt, inklusive konkreter Beispiele wie Bewegungsgeschichten, Abenteuerlandschaften, kleine Spiele, Slackline und verschiedene Aufgabenformate.
Schlüsselwörter
Gleichgewichtsfähigkeit, koordinative Fähigkeiten, statisches Gleichgewicht, dynamisches Gleichgewicht, Objektgleichgewicht, Analysatoren, Sportmotorik, Alltagsmotorik, Schulsport, Bewegungsförderung, Übungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Gleichgewichtsfähigkeit im Sportunterricht
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit der Gleichgewichtsfähigkeit im Kontext von Sport und Bewegungspädagogik. Sie definiert und differenziert die Gleichgewichtsfähigkeit, untersucht verschiedene Arten des Gleichgewichts und präsentiert praktische Übungen für den Schulsport, basierend auf wissenschaftlicher Literatur.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und Differenzierung der Gleichgewichtsfähigkeit; die verschiedenen Arten des Gleichgewichts (statisch, dynamisch, Objektgleichgewicht); die Rolle der Analysatoren bei der Gleichgewichtskontrolle; Methoden zur Schulung der Gleichgewichtsfähigkeit im Sportunterricht; und praktische Übungen und Beispiele für den Schulsport.
Welche Arten von Gleichgewicht werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen statischem, dynamischem und Objektgleichgewicht. Die unterschiedlichen Definitionen und Schwierigkeiten der Abgrenzung werden diskutiert.
Welche Rolle spielen die Analysatoren?
Die Arbeit erläutert die wichtige Rolle der Analysatoren (z.B. visuelle, vestibuläre und propriozeptive Systeme) bei der Wahrnehmung und Regulation des Gleichgewichts.
Welche praktischen Übungen werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Möglichkeiten zur Schulung der Gleichgewichtsfähigkeit im Sportunterricht, darunter Bewegungsgeschichten, Abenteuerlandschaften, kleine Spiele, Slackline und Einzel-, Partner- und Gruppenaufgaben.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil und eine Schlussbemerkung. Der Hauptteil beinhaltet detaillierte Informationen zu den verschiedenen Arten des Gleichgewichts, der Rolle der Analysatoren und praktischen Übungen für den Schulsport. Die Einleitung hebt die Bedeutung der Gleichgewichtsfähigkeit hervor und die Schlussbemerkung fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Gleichgewichtsfähigkeit, koordinative Fähigkeiten, statisches Gleichgewicht, dynamisches Gleichgewicht, Objektgleichgewicht, Analysatoren, Sportmotorik, Alltagsmotorik, Schulsport, Bewegungsförderung, Übungen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Lehrende im Bereich Sport und Bewegungspädagogik, die nach praktischen Übungen zur Förderung der Gleichgewichtsfähigkeit bei Kindern und Jugendlichen suchen. Sie eignet sich auch für Studierende der Sportwissenschaft und verwandter Fächer.
Wo findet man wissenschaftliche Referenzen?
Die Arbeit stützt sich auf bestehende wissenschaftliche Literatur, die jedoch im bereitgestellten HTML-Snippet nicht explizit aufgeführt ist.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Gleichgewichtsfähigkeit zu definieren, zu differenzieren und praktische Übungen für den Schulsport aufzuzeigen.
- Quote paper
- Anke Schepers (Author), 2012, Die Gleichgewichtsfähigkeit - In Theorie und Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197274