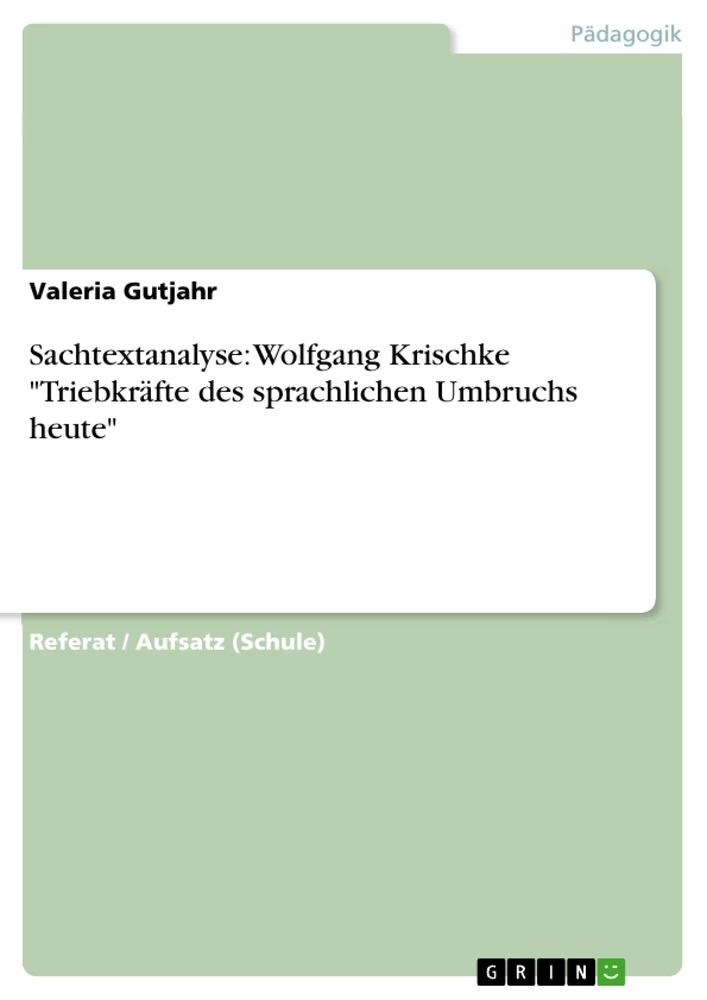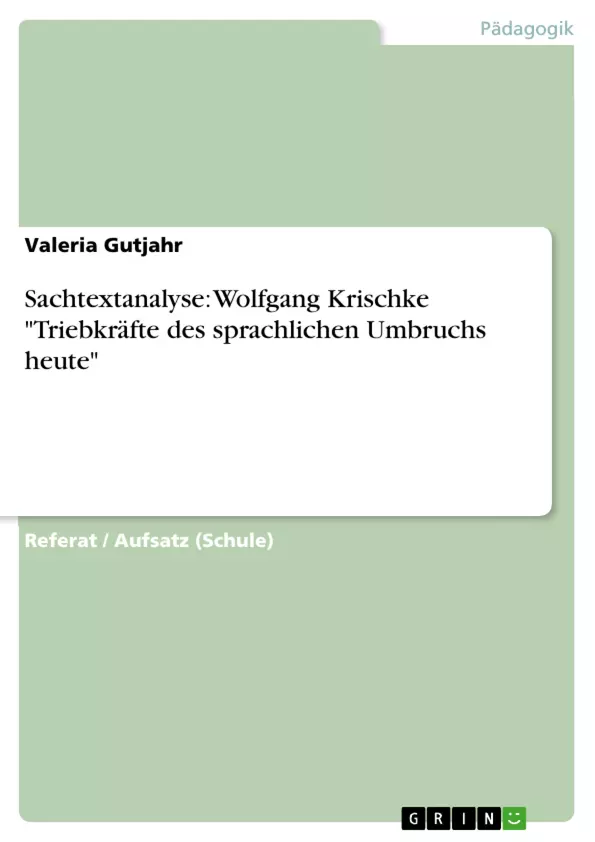Der Text „Triebkräfte des sprachlichen Umbruchs heute” von Wolfgang Krischke, veröffentlicht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Nr.197 vom 26.09.2009 befasst sich mit der Verfälschung der deutschen Hochsprache, ihren Ursachen und Auswirkungen.
Sein Leitgedanke stellt die zunehmende Migrationsrate und die damit verbundene Vermischung mit anderen Sprachen und die Simplifizierung unserer eigenen dar. Zudem befasst er sich kritisch mit der Einstellung Verantwortlicher gegenüber diesem Problem.
Krischke wendet sich dabei hauptsächlich an ein sprachinteressiertes Publikum.
Sachtextanalyse Sachtextanalyse Sachtextanalyse Sachtextanalyse Sachtextanalyse Sachtextanalyse
Wolfgang Krische: Triebkräfte des sprachlichen Umbruchs heute Wolfgang Krischke: Triebkräfte des sprachlichen Umbruchs heuteWolfgang Krischke: Triebkräfte des sprachlichen Umbruchs heuteWolfgang Krischke: Triebkräfte des sprachlichen Umbruchs heuteWolfgang Krischke: Triebkräfte des sprachlichen Umbruchs heuteWolfgang Krischke: Triebkräfte des sprachlichen Umbruchs heute
Der Text „Triebkräfte des sprachlichen Umbruchs heute” von Wolfgang Krischke, veröffentlicht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Nr.197 vom 26.09.2009 befasst sich mit der Verfälschung der deutschen Hochsprache, ihren Ursachen und Auswirkungen.
Sein Leitgedanke stellt die zunehmende Migrationsrate und die damit verbundene Vermischung mit anderen Sprachen und die Simplifizierung unserer eigenen dar. Zudem befasst er sich kritisch mit der Einstellung Verantwortlicher gegenüber diesem Problem.
Krischke wendet sich dabei hauptsächlich an ein sprachinteressiertes Publikum, wie zum Beispiel Linguisten.
Der Text lässt sich in 3 große Sinnabschnitte gliedern, die wiederum in sich selbst noch einmal strukturiert sind. Insgesamt entstehen so 13 Sinnabschnitte.
Im ersten Abschnitt (Z.1-5), der als Einleitung in die Problemstellung dient, bezieht er sich noch nicht direkt auf die Sprachverfälschung der deutschen Hochsprache, er führt den Leser zunächst grob in die Kernursache der Problematik ein, die er als „einen Exotismus der grammatischen Fehler“ (Z. 1-2) bezeichnet. Krischke kritisiert dabei schon hier die Erwartungshaltung der Gesellschaft, die die Forderung eine korrekte Ausdrucksweise zu beherrschen, als „Diskriminierung von Unterschichten und Migranten“ versteht (Z. 3-5) und äußert somit indirekt seine Meinung gegenüber der Gesellschaft.
Im nächsten Abschnitt (Z. 6-17) führt er diesen Gedanken fort. Er stellt direkt eine eindeutige These auf, die offensichtlich auf die im ersten Abschnitt erläuterte Problematik zurückzuführen ist: „Im Unterbau der deutschen Sprache knirscht es.“ (Z. 6-7) , und bedient sich damit einer Metapher. Krischke stellt die deutsche Sprache als ein Bauwerk dar, das ein stabiles Fundament braucht, um zu halten. Wenn dieses Fundament, bzw. wie er es formuliert, dieser Unterbau „knirscht“, also unstabil wird, läuft das Bauwerk Gefahr einzustürzen. So sieht er es auch mit der Sprache: Sie wird in ihren Grundlagen, der Grammatik, angegriffen und „kommt (…) immer stärker ins Rutschen“ (Z. 9), und zwar nicht nur im alltäglichen Umgang, sondern auch in der formellen Sprache (Z. 7-8).
Krischke führt dazu einige Beispiele wie „man ratet ab“ (Z.12 à man rät ab) oder „Gebühren werden erheben“ (Z. 13 à erhoben) an, macht seine Sicht der Dinge somit anschaulicher für den Leser und festigt seine These schließlich mit einer weiteren Metapher indem er diesen Prozess als „die langsame Erosion des gesamten Systems“ (Z. 16-17) bezeichnet, womit er meint, dass es durch immer akzeptiertere Verstöße der deutschen Grammatik zur stetigen Verfälschung unserer Hochsprache kommt.
Im Weiteren konkretisiert Krischke seine Beobachtungen (Z. 18-40). Er erinnert daran, dass das Thema des Sprachumbruchs aktuell ist und „journalistische Sprachkritiker (…) sich wegen ihren Ratschlägen größter Beliebtheit erfreuen“ (Z. 18-21), Sprachwissenschaftler dies zwar hauptsächlich als „Alarmismus“ (Z. 22) bezeichnen, aber dennoch zugeben, dass der Sprachwandel immer schneller voranschreitet (Z. 23-27). Somit bedient sich Krischke eines Autoritätsarguments, wobei die Aussage der Sprachwissenschaftler seine These im gewissen Grat unterstützt.
Von Zeile 27 bis 33 beschreibt er das Problem des Sprachumbruchs genauer. Er stellt die Beobachtung auf, dass gewisse grammatikalische Fehler „schon seit Jahrhunderten schleichend wirken“ (Z.28-29), was dazu führt, dass unsere eigentlich synthetisch erlernte Sprache immer analytischer wird, das heißt anwendungsbezogener, statt auf fundamentalen Regeln beruhend (Z. 29-33).
Dazu bringt Krischke das Beispiel vom „Haus meines Vaters“ was schließlich immer drastischer vereinfacht und zum „Haus von mein Vater“ wird (Z. 33-39).
Durch das Beispiel bekommt der Leser eine realistischere und naturalistischere Vorstellung des tatsächlich fortschreitenden Sprachwandels.
Im letzten Teil des ersten großen Abschnitts (Z. 41-58) nennt Krischke einige der Ursachen, die die Sprachverfälschung antreiben.
Zur Einleitung stellt er eine direkt an den Leser gerichtete Frage: „Warum verstärken sich solche Tendenzen gerade jetzt?“ (Z. 41-42) und regt ihn somit zum Nachdenken an, da die Ursache eigentlich ganz alltäglich und subtil ist, schließt er seine Antwort direkt daran an.
Er nennt als erste Ursache den Einfluss der englischen Sprache, zudem kommen neue technologische Kommunikationsmöglichkeiten wie E-Mails und Chat-Foren, bei denen ausführliches Formulieren Abkürzungen und Vereinfachungen weicht und sich durch stetige Gewohnheit langsam aber sicher in unserem „normalem” Sprechen und Schreiben manifestiert (Z. 41-52).
Krischke kritisiert außerdem die gesellschaftliche Einstellung zu diesem Prozess, der diesen als Kontrast zum angeblichen „Spießer-Abbild” sogar begrüßt (Z. 53-55), was durch „das Geschwätz der Talk- und Casting-Shows” (Z. 56) gefestigt wird und diese gewünschte „Lockerheit” (Z.55) wiederum die Verformung der deutsch Hochsprache antreibt. Er zeigt seine Abneigung zudem deutlich, da er das eher abwertende Wort „Geschwätz” (Z.56) für Gespräche in „Talk- und Casting-Shows” verwendet und ironischerweise die Formulierung „besser rüber” (Z. 57-58) benutzt.
Der zweite große Abschnitt trägt die Überschrift „Gehst du Schule?”, wobei er nun seinen Schwerpunkt auf das Problem der Migration hinsichtlich des Sprachumbruchs legt. Durch die Überschrift gibt Krischke direkt ein Beispiel, sodass der Leser sich schon im Voraus eine Vorstellung des Problems machen kann.
class=WordSection2>
Hierbei erläutert er im ersten Abschnitt (Z. 59-75) grob die, seiner Meinung nach Hauptursache, bzw. „wichtigste Triebkraft” (Z. 59) der Sprachverfälschung. Er stützt seine Thesen dabei auf den Leipziger Sprachwissenschaftler Uwe Hinrichs und bedient sich somit weiteren Autoritätsargumenten, um seine Argumentation glaubwürdig zu gestalten (Z. 61-62).
Seine These, der Sprachumbruch wird hauptsächlich durch „die vielfältige Sprachmischungen [immigrierter Bürger] geprägt” (Z. 62-65) beruht auf Hinrich (bzw. auf einem seiner Bücher). Dieses Problem, so erläutert Krischke, entsteht dadurch, dass immigrierte Einwohner die deutsche Sprache nicht oder nur „bruchstückhaft” (Z. 67) beherrschen und diese zusätzlich mit ihrer Muttersprache mischen. Bedeutend sei nur die Verständlichkeit, nicht die Richtigkeit dessen, wie sie es formulieren (Z. 66-72). Zudem stellt er die Prognose auf, dass dieser Prozess sich auf Dauer nicht nur auf die
[...]
- Citar trabajo
- Valeria Gutjahr (Autor), 2010, Sachtextanalyse: Wolfgang Krischke "Triebkräfte des sprachlichen Umbruchs heute", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197643