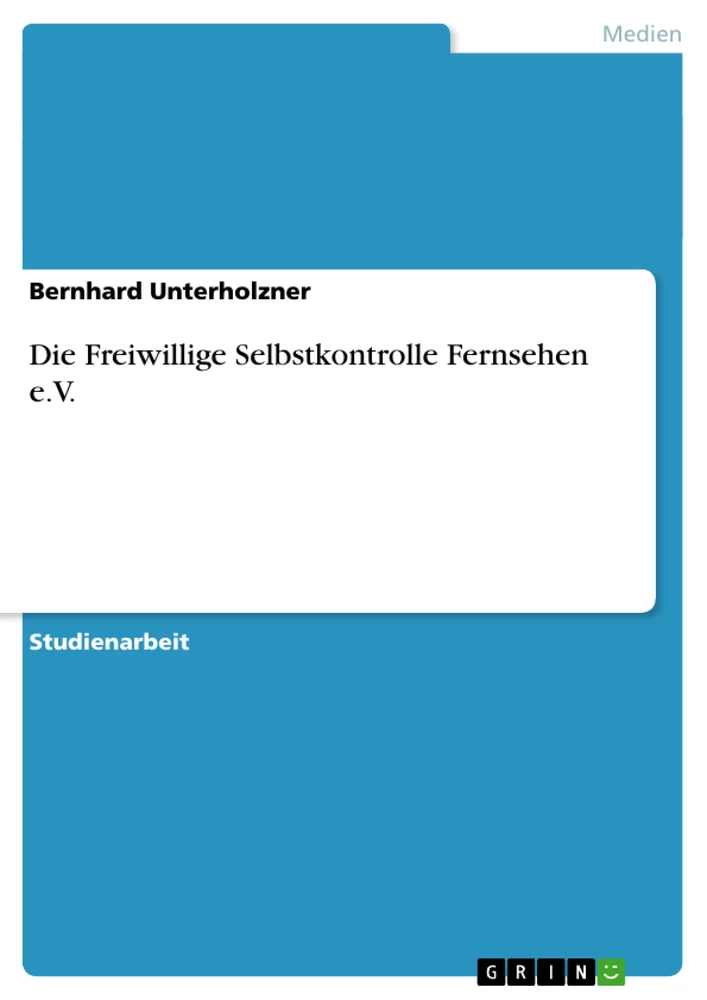[...]
Immer wieder kommen öffentliche Debatten auf, vor allem geht es dabei um den
Jugendschutz. Jedes neu entstehende Medium, sei es das Kino, das Radio oder
insbesondere das Fernsehen hat stets aufs Neue „pädagogische Besorgnis“2 erweckt.
Diese Besorgnis endet nicht mit der Etablierung des Mediums, sondern taucht in mehr oder
weniger regelmäßigen Abständen, unter veränderten Vorzeichen, in der öffentlichen
Diskussion auf. So hat Anfang der Neunziger Jahre das Thema Gewalt im Fernsehen für
einen Aufruhr in der Bevölkerung gesorgt. Da ein oberflächlich sichtbarer (wenn auch
faktisch zu stark vereinfachter) Kausalzusammenhang zwischen medialer und realer Gewalt
hergestellt wurde, verlangte die besorgte Öffentlichkeit nach strengerer Regulierung.
Politiker, Berufsmoralisten und nicht zuletzt die öffentlich-rechtlichen Sender, hatte man doch
hauptsächlich die Privaten im Visier, erkannten die Gunst der Stunde. Jedoch war es
schwierig schnell Handlungsfähigkeit zu beweisen und sich dadurch angemessen zu
profilieren.
Einerseits wollten die Länder als die eigentlich politisch Zuständige, keineswegs Gesetze
verschärfen, da dies ihren Standortinteressen widersprochen hätte. Auch die
Landesmedienanstalten als eigentliche Aufsichtsinstanz, wollten das System einer weichen
Steuerung, das sich zwischen ihnen und den Sendern etabliert hatte, nicht umstrukturieren.
Andererseits, hörten sich die Rufe nach stärkerer Regulierung stark nach der
Einforderung einer Vorzensur an, und diese ist in Deutschland definitiv verfassungswidrig.
Da aber der Druck sowohl auf die Landesregierungen als auch auf die Privatsender immer
mehr zunahm, einigt man sich auf ein verfassungskonformes Modell der Vorzensur: Die
Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen e.V. wird ins Leben gerufen.3
2 Bonfadelli, Heinz: Gewalt im Fernsehen- Gewalt durch Fernsehen. In: Bonfadelli, Heinz; Meier, Werner A.
(Hrsg.): Krieg, AIDS, Katastrophen- Gegenwartsprobleme als Herausforderung der Publizistikwissenschaft.
Konstanz: Universitätsverlag 1993. S. 149.
3 Vgl. Vowe, Gerhard: Medienpolitik im Spannungsfeld von staatlicher Steuerung und Selbstregulierung: das
Beispiel der „Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen“. In: Schatz, H. (Hrsg.): Machtkonzentration in der
Multimediagesellschaft?: Beiträge zu einer Neubestimmung des Verhältnisses von politischer und medialer
Macht. Opladen: Westdeutscher Verlag 1997, S. 216-243.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Struktur und Aufgaben der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen e. V.
- Die Struktur der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen e. V.
- Der Vorstand
- Die Geschäftsstelle
- Das Kuratorium
- Die Prüfausschüsse
- Die Berufungsausschüsse
- Hauptamtliche und Einzelprüfer
- Juristische Sachverständige
- Aufgaben der Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen e. V.
- Prüfung bisher nicht erfasster Programme
- Ausnahmeanträge
- Ablauf einer Programmprüfung
- Allgemeiner Ablauf
- Sonderfälle
- Juristische Prüfung
- Einzelprüfung
- Nachprüfung
- Anrufung des Kuratoriums
- Vorteile und Probleme des Systems „Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen e. V."
- Vorteile
- Probleme
- Neuerungen in der Programmaufsicht
- KJM statt LMA
- Der neue Status der FSF
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Struktur, die Aufgaben und die zukünftige Entwicklung der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen e. V. (FSF), einer Selbstkontrollinstitution für das private Fernsehen in Deutschland. Die Arbeit beleuchtet die Entstehung der FSF im Kontext öffentlicher Debatten über Jugendschutz und Mediengewalt sowie ihre Rolle als Instrument zur Selbstregulierung im deutschen Fernsehsystem.
- Die Entstehung der FSF als Reaktion auf öffentliche Besorgnis über Mediengewalt
- Die Struktur und Organisation der FSF, einschließlich Vorstand, Geschäftsstelle, Kuratorium, Prüf- und Berufungsausschüsse
- Die Aufgaben der FSF in der Programmprüfung und -kontrolle
- Die Funktionsweise und die verschiedenen Phasen des Programmprüfungsverfahrens
- Die Herausforderungen und Probleme der Selbstkontrolle im Fernsehbereich
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die FSF in den Kontext öffentlicher Debatten über Jugendschutz und Mediengewalt und beleuchtet ihre Entstehungsgeschichte. Kapitel 2 analysiert die Struktur der FSF, einschließlich ihrer Gremien und deren Aufgaben. Es befasst sich mit dem Vorstand, der Geschäftsstelle, dem Kuratorium, den Prüfausschüssen und den Berufungsausschüssen. Kapitel 3 beschreibt den Ablauf einer Programmprüfung, von der ersten Einreichung bis zur Entscheidung. Es werden sowohl der allgemeine Ablauf als auch die verschiedenen Sonderfälle erläutert. Kapitel 4 diskutiert die Vorteile und Probleme der Selbstkontrolle durch die FSF. Die Arbeit behandelt auch die jüngsten Entwicklungen in der Programmaufsicht, wie die Einführung der KJM statt der LMA und den neuen Status der FSF. Das Fazit bietet eine Zusammenfassung der Ergebnisse und blickt auf die zukünftige Rolle der FSF im deutschen Fernsehsystem.
Schlüsselwörter
Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen e. V., FSF, Medienpolitik, Jugendschutz, Mediengewalt, Programmprüfung, Selbstregulierung, Fernsehsystem, öffentlicher Druck, Prüfverfahren, Kuratorium, Prüfausschüsse, Berufungsausschüsse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen (FSF)?
Die FSF ist ein Verein zur Selbstregulierung des privaten Fernsehens in Deutschland, der Programme auf Jugendschutz und Gewaltinhalte prüft.
Warum wurde die FSF gegründet?
Sie entstand in den 90er Jahren als Reaktion auf die öffentliche Debatte über Gewalt im Fernsehen und als verfassungskonforme Alternative zur staatlichen Vorzensur.
Wie läuft eine Programmprüfung bei der FSF ab?
Prüfausschüsse begutachten Sendungen vor der Ausstrahlung und legen Altersfreigaben oder Sendezeitbeschränkungen fest.
Wer ist an den Entscheidungen der FSF beteiligt?
Neben dem Vorstand und der Geschäftsstelle gibt es ein Kuratorium sowie Prüf- und Berufungsausschüsse, die mit Experten besetzt sind.
Was ist der Unterschied zwischen FSF und der KJM?
Die FSF ist eine freiwillige Instanz der Sender, während die KJM (Kommission für Jugendmedienschutz) die staatlich-rechtliche Aufsicht über alle Medienangebote führt.
- Citation du texte
- Bernhard Unterholzner (Auteur), 2003, Die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen e.V., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19772