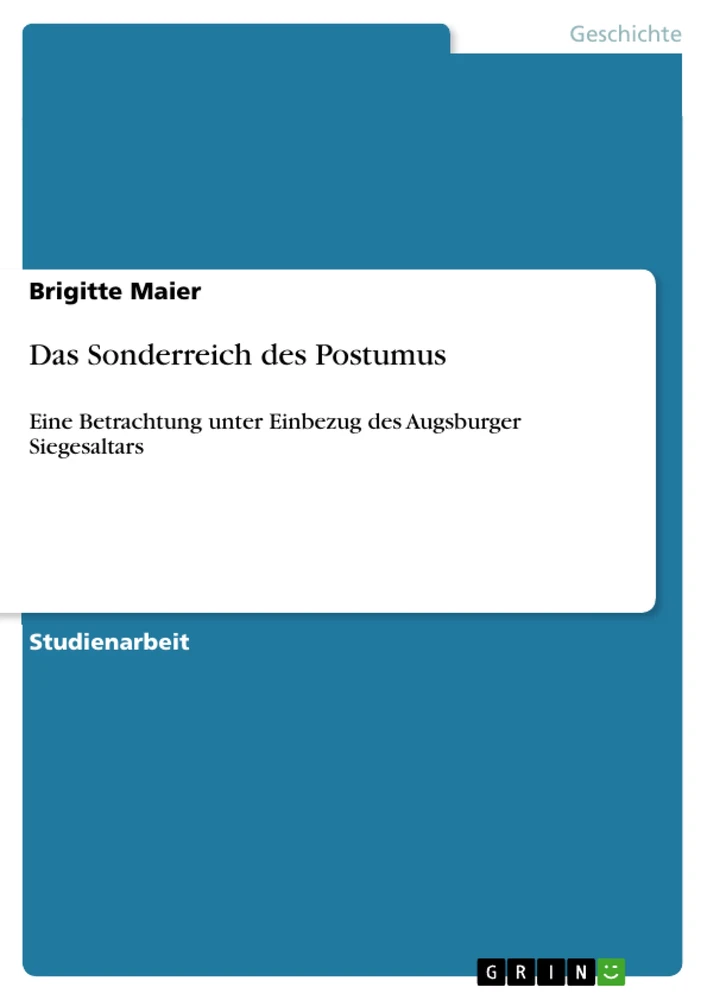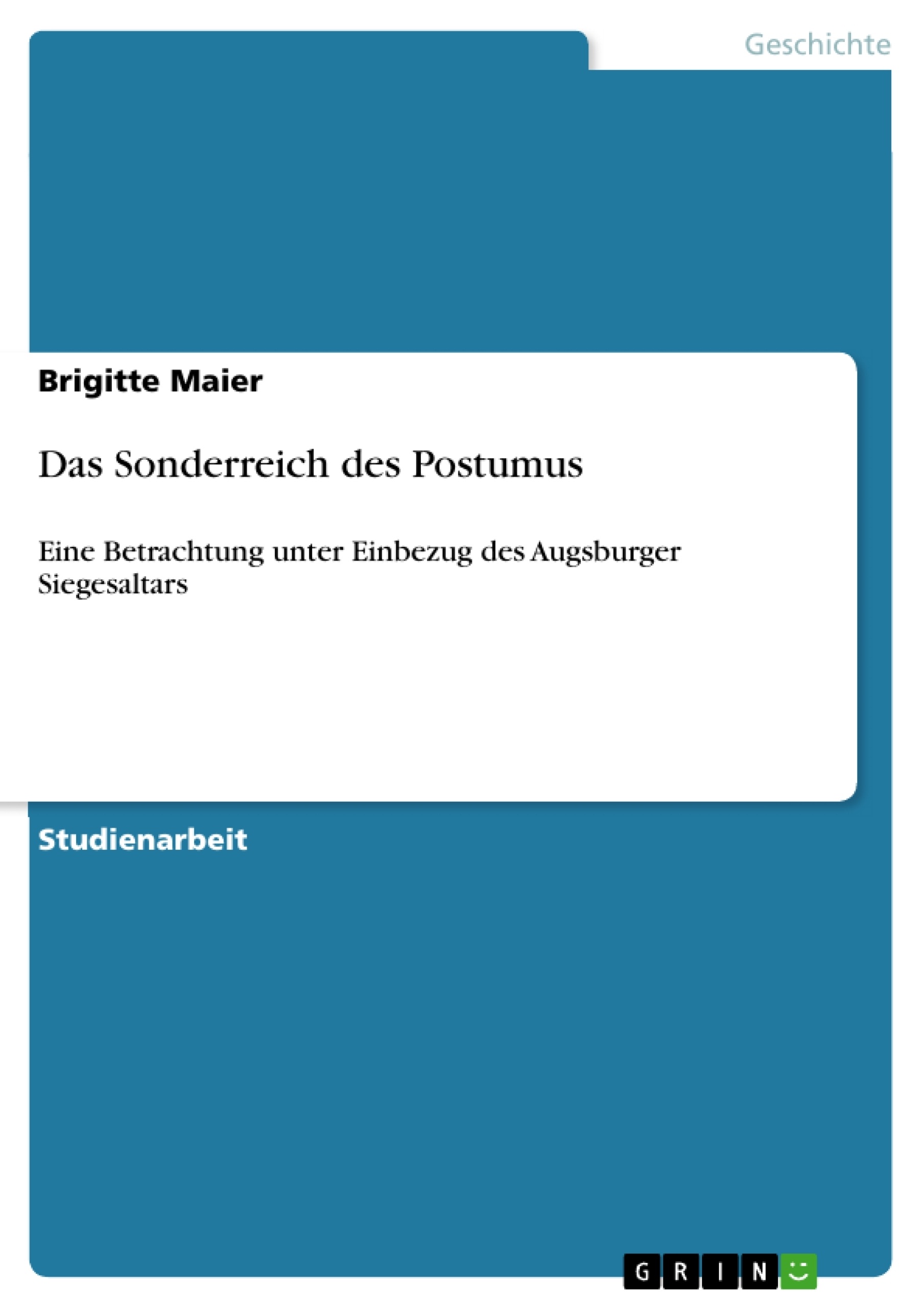Das Phänomen der Soldatenkaiser fällt in das krisenbehaftete 3. Jahrhundert, in welchem es zahlreiche Machtwechsel, Usurpationen, Einfälle feindlicher Stämme und möglicherweise auch Zerfallserscheinungen des Reiches gab.
In der Forschung wird diskutiert, ob die die Entstehung des gallischen Sonderreiches als solch eine Zerfallserscheinung gesehen werden kann. Zugleich ist der chronologische Verlauf, welcher zur Abspaltung des gallischen Sonderreiches geführt hat, trotz zahlreicher Quellen nicht endgültig geklärt.
Ziel dieser Arbeit wird es sein, unter Einbezug des erst kürzlich gefundenen Augsburger Siegesalter, etwas Licht in das Dunkel dieser Epoche zu bringen.
Doch bevor ich mich mit dem entscheidenden Jahr 260 nach Christus eingehender beschäftige, möchte ich zunächst einen Überblick über das Jahrhundert der Soldatenkaiser verschaffen. Ich hoffe, dass solch eine Analyse die dem Jahrhundert innewohnenden Probleme offen legen kann. Vor der Zeit der Soldatenkaiser (235-284) stieg unter Septimius Severus (193-211) der militärisch erfahrene Ritterstand auf Kosten der Senatoren in die höchsten Reichsämter auf. Caracalla (211- 217), sein Nachfolger, vergab in der ,,constitutio Antoniniana" das römische Vollbürgerrecht an alle freien Provinzialen und erschloss sich dadurch neue Einnahmequellen. Die Besoldung des Heeres wurde mehrmals erhöht, was zur Folge hatte, dass die Unterstützung des Heeres sich rasch zum größten Machtfaktor im Staat entwickelte. Die wachsende Bedeutung des Heeres hatte zur folge, dass die Kaiser von nun an gezwungen waren, sich die Loyalität ihrer Soldaten durch reichliche Besoldung zu erkaufen. Jedoch hatten die Truppen von nun an auch die Möglichkeit sich gegen den Kaiser zu stellen und den Heersführer als neuen Kaiser auszurufen.
Dies war aus finanzieller Sicht sehr lukrativ für die Truppen, daher starben nahezu alle Kaiser in der Zeit der Soldatenkaiser durch Verrat oder durch die Hand ihrer meuternden Soldaten. Zahlreiche Usurpationen und reichsinterne Konflikte um die Herrschaft waren die Folge. Nachdem Valerian als erster und einziger römischer Kaiser 262 nach Christus in persischer Kriegsgefangenschaft gestorben war, war der Höhepunkt der Krise erreicht. Das gallische Sonderreich, welches 15 Jahre lang neben Rom bestehen sollte, war entstanden. Daher trat Gallienus, von dem in den römischen Quellen (möglicherweise zu Unrecht) ein sehr negatives Bild entworfen wird, ein schwieriges Erbe an.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Zeit der Soldatenkaiser. Zeichen einer Veränderung! Anzeichen einer Krise?
- Das Gallische Sonderreich
- Das Gallische Sonderreich und die überdehnten Grenzen
- Das Problem eines Mehrfrontenkrieges
- Überlegungen zur Chronologie von 259 bis 261 nach Christus
- Die Postumus-Inschrift des Augsburger Siegesaltars
- Die Einordnung der luthungen – ein schwieriges Unterfangen
- Datierungsprobleme um das Jahr 260 nach Christus
- Die Häufung der Usurpationen – ein Erklärungsversuch
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Untersuchung befasst sich mit der Entstehung des gallischen Sonderreiches im 3. Jahrhundert n. Chr. und analysiert die chronologischen und kausalen Zusammenhänge zwischen diesem Ereignis und der Gefangennahme des römischen Kaisers Valerian im Jahr 260 n. Chr. Sie beleuchtet die politischen und militärischen Krisen des römischen Reiches während der Zeit der Soldatenkaiser und untersucht, ob das gallische Sonderreich als Zeichen einer Auflösung oder als eine Usurpation zu betrachten ist, die durch die Krise des Reiches nicht unterdrückt werden konnte.
- Die Zeit der Soldatenkaiser und die Krise des römischen Reiches
- Das Gallische Sonderreich und seine Einordnung in die Reichsgeschichte
- Die Chronologie der Ereignisse im Jahr 260 n. Chr.
- Die Rolle des Kaisers Valerian und seines Sohnes Gallienus
- Die Usurpation des Postumus und die Dauerhaftigkeit des gallischen Sonderreiches
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel liefert einen einleitenden Überblick über die krisenhafte Situation des römischen Reiches im 3. Jahrhundert n. Chr., insbesondere während der Zeit der Soldatenkaiser. Es werden die wichtigsten Herausforderungen des Reiches, wie z. B. die militärischen Bedrohungen an den Grenzen, innere Konflikte und die Instabilität des Herrschaftssystems, dargestellt.
- Die Zeit der Soldatenkaiser – Zeichen einer Veränderung! Anzeichen einer Krise?: Dieses Kapitel beleuchtet die Ursachen und Auswirkungen der Krise des römischen Reiches während der Zeit der Soldatenkaiser. Es analysiert die Rolle des Heeres, die Zunahme von Usurpationen und die Instabilität der Herrschaft.
- Das Gallische Sonderreich: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung des gallischen Sonderreiches, seinen Ursachen und seiner Einordnung in die Reichsgeschichte.
- Überlegungen zur Chronologie von 259 bis 261 nach Christus: Dieses Kapitel untersucht die chronologische Einordnung des gallischen Sonderreiches im Kontext der Ereignisse von 259 bis 261 n. Chr. und die Bedeutung des Augsburger Siegesaltars für die Rekonstruktion dieser Zeit.
- Die Häufung der Usurpationen – ein Erklärungsversuch: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Ursachen und Auswirkungen der vielen Usurpationen während der Zeit der Soldatenkaiser und untersucht die Frage, warum es dem gallischen Sonderreich gelang, so lange bestehen zu bleiben.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen dieser Untersuchung sind die Zeit der Soldatenkaiser, die Reichskrise des 3. Jahrhunderts, das gallische Sonderreich, Usurpationen, Chronologie, Kaiser Valerian, Gallienus, Postumus, Augsburger Siegesaltar und die Auswirkungen der Krise des römischen Reiches auf die politische und militärische Stabilität.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Gallische Sonderreich?
Das Gallische Sonderreich (Imperium Galliarum) war eine Abspaltung vom Römischen Reich, die von 260 bis 274 n. Chr. bestand. Es umfasste Gebiete in Gallien, Britannien und zeitweise Hispanien.
Wer war Postumus?
Postumus war der Begründer des Gallischen Sonderreiches. Er war ein Heeresführer, der sich nach dem Sieg über germanische Stämme zum Kaiser ausrufen ließ und erfolgreich die Grenzen gegen Einfälle verteidigte.
Warum kam es im 3. Jahrhundert zur Zeit der "Soldatenkaiser"?
Durch ständige Kriege wurde das Heer zum entscheidenden Machtfaktor. Soldaten riefen ihre Generäle zu Kaisern aus, um Belohnungen zu erhalten, was zu politischer Instabilität und häufigen Usurpationen führte.
Welche Bedeutung hat der Augsburger Siegesaltar für die Forschung?
Der erst kürzlich gefundene Siegesaltar liefert wichtige chronologische Hinweise auf die Ereignisse des Jahres 260 n. Chr. und die Kämpfe gegen die Juthungen im Kontext der Entstehung des Sonderreichs.
Galt das Sonderreich als Zeichen für den Zerfall des Römischen Reiches?
In der Forschung wird diskutiert, ob es eine Zerfallserscheinung war oder eher eine pragmatische Reaktion lokaler Eliten und Truppen, um den Schutz der Grenzen zu gewährleisten, den Rom nicht mehr garantieren konnte.
- Citar trabajo
- Brigitte Maier (Autor), 2007, Das Sonderreich des Postumus, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197745