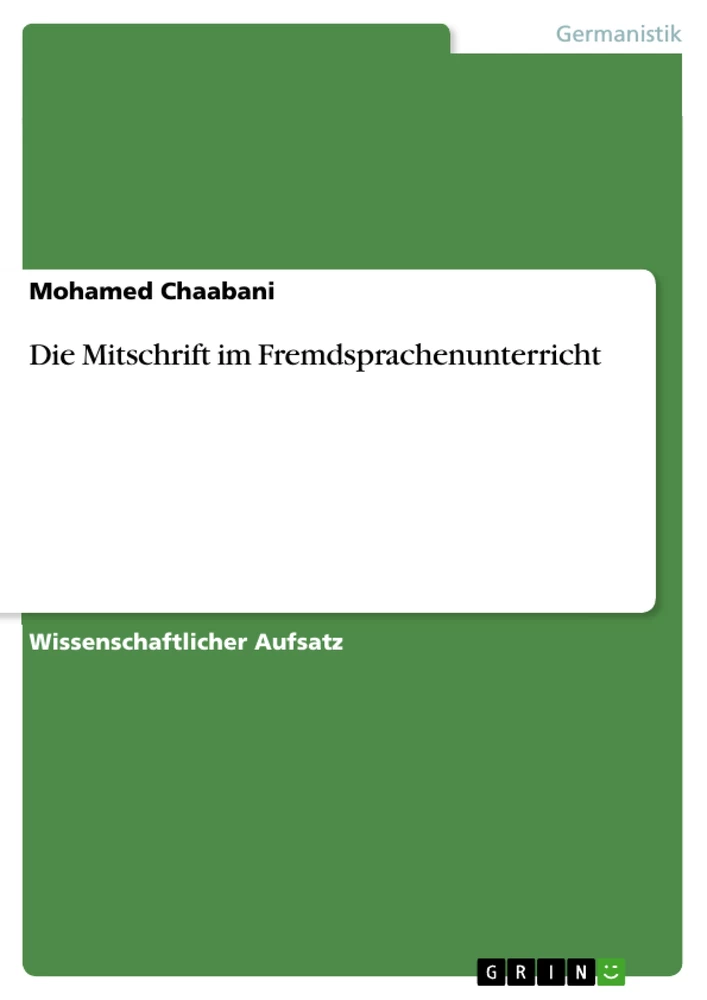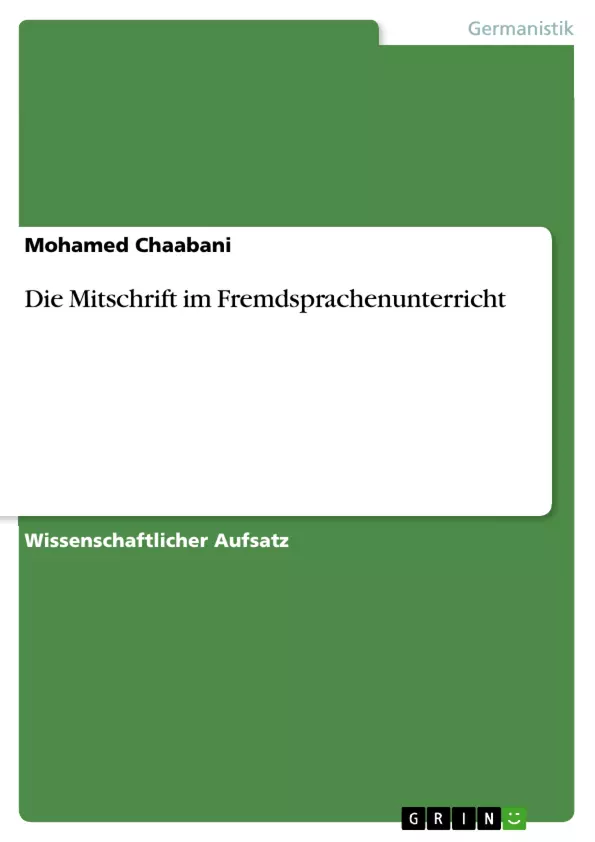Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Textsorte Mitschrift im Fremdsprachenunterricht. Das Schreiben von Mitschriften im Fremdsprachenunterricht spielt eine zentrale Rolle im Studium. Vor diesem Hintergrund erhebt sich die Notwendigkeit, diese Textsorte zu untersuchen. Anliegen dieser Arbeit ist es ebenfalls, die Schreibkompetenz der Studenten beim Verfassen von Mitschriften zu erfassen. Für diesen Zweck wurden Mitschriften einer näheren Analyse unterzogen. Dazu wurde auch eine schriftliche Befragung durchgeführt, um die Einstellung der Studierenden über diese Textsorten zu erfassen.
Die Mitschrift im Fremdsprachenunterricht
Chaabani Mohamed
Abstract
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Textsorte Mitschrift im Fremdsprachenunterricht. Das Schreiben von Mitschriften im Fremdsprachenunterricht spielt eine zentrale Rolle im Studium. Vor diesem Hintergrund erhebt sich die Notwendigkeit, diese Textsorte zu untersuchen. Anliegen dieser Arbeit ist es ebenfalls, die Schreibkompetenz der Studenten beim Verfassen von Mitschriften zu erfassen. Für diesen Zweck wurden Mitschriften einer näheren Analyse unterzogen. Dazu wurde auch eine schriftliche Befragung durchgeführt, um die Einstellung der Studierenden über diese Textsorten zu erfassen.
Zur Mitschrift
Die Mitschrift gehört zu den reproduktiven Textarten, wo sie sich auf mündliche Äußerungen bezieht. In diesem Zusammenhang ist auf die Ausführungen von Steets (2003, 221), die die Mitschrift als reproduktive Schreibform beschreibt, zu verweisen.[1] Der Ausgangspunkt bei der Anfertigung von Mitschriften sind die mündlichen Äußerungen wie in einer Vorlesung oder in einem Seminar. Die Mitschrift ist dafür gedacht, die mündlichen Äußerungen schriftlich zu fixieren, sodass sie nicht verloren gehen, weil die gesprochene Sprache in einem ziemlich schnellen Tempo im Vergleich zu der geschriebenen Sprache verläuft. Darüber hinaus sollte man bei der Ausarbeitung einer Mitschrift nicht die ganzen Sätze mitschreiben, sondern die Inhalte der mündlichen Äußerungen reduzieren und komprimieren. Dem Schreiber einer Mitschrift werden hohe Schreibanforderungen gestellt so Steets (2003, 221) und zwar aufgrund der Schnelligkeit dieses Prozesses, denn er soll zuhören und gleichzeitig mitschreiben. Beim Schreiben von einer Mitschrift geht es in erster Linie darum, das Gehörte wie z.B. Diskussion oder Vortrag mitzuhören und dabei wichtige Informationen zu nehmen bzw. aufzuschreiben. Allerdings ist dieser Vorgang kompliziert, denn es geht darüber hinaus um das Verstehen, was der Schreiber hört. Ferner könnten laut Frank, A., u.a. (2007, 151) die Lernenden bei der Mitschrift folgenden Fragen nachgehen: was findet der Lerner dabei spannend oder nicht? Wo liegt der rote Faden? Welche interessanten Formulierungen wurden mitgehört? Was versteht er und was nicht? Welche Formulierungen scheinen zweifelhaft zu sein? Was möchte der Schreiber als Ziel dabei klären? Die Mitschrift hilft demnach beim Zuhören und Verstehen. In der Regel schreibt man Mitschriften, um Informationen, die für spätere Verwendung gedacht sind, schriftlich festzuhalten. Im Weiteren bietet das Schreiben von Mitschriften viele Vorteile für den Schreiber. Bei den Zuhören und Schreiben gleichzeitig wird die Konzentration beim Lerner gefördert. Überdies befähigt sie die Lernenden dazu, sich das Wesentliche von Unwesentlichen zu unterscheiden. Hierbei werden sie trainiert, Informationen für kommende Prüfungen zu nutzen. Außerdem liefert die Mitschrift die Lerner mit den nötigen Informationen, mit denen sie in einer Diskussion verwenden können. Die Mitschrift ist für die Lerner selbst gedacht und somit wird ihre Gestaltung je nach persönlichen Notwendigkeiten erstellt. Einen wichtigen Punkt besteht darin, dass der Inhalt der Mitschrift je nach Funktionen variieren könnte. In diesem Gedankengang schließe ich mich den Überlegungen von Kroeger[2], H. (2000, 52) an. Er differenziert drei Funktionen von Mitschriften, die wiederum ihre eigenen Inhalte haben. Die erste Funktion besteht darin, einen Vortrag mitzuhören und dann an einer Diskussion teilzunehmen. Bezogen auf diese Funktion sollte folgendes aufgeschrieben werden, indem die Lernenden sich an diesen folgenden Fragen orientieren: was fällt dem Schreiber auf? Was hat der Schreiber nicht verstanden? Und möglicherweise wonach will er sich erkundigen? Welche Ideen sind dem Lernenden dabei eingefallen? Es könnte auch wortwörtlich zitiert werden und zwar für die spätere Anwendung an einer Diskussion. Die zweite Funktion besteht darin, Informationen zu lagern. Diese werden für bevorstehende Hausarbeiten oder Klausuren bearbeitet. Bezogen auf diese Funktion sollte folgendes notiert werden: alle Begriffe und Definitionen, die für die kommende Arbeit von Nutzen sein könnten. Des Weiteren könnten ebenfalls methodische Hinweise, Anregungen sowie bibliographische Angaben aufgenommen werden. Die dritte Funktion besteht darin, das Festhalten von Informationen für spätere unbekannte Anwendungen. Hier werden Informationen bezüglich der Person, die den Vortrag gehalten hat, sowie die Zeit, in der der Vortrag stattgefunden wurde. Im Weiteren werden sowohl die wesentlichen Informationen als auch die Gliederung des Vortrages vermerkt.
Laut Ehlich, K.[3] (2003, 19) sollte man nicht ganze Sätze mitschreiben, sondern Stichwörter, Aufzählungszeichen, Abkürzungen und Symbole verwenden. Um komplexe Argumentationen mitzuschreiben, sollte man einfache Techniken zur Visualisierung verwenden, wie z.B. Unterstreichungen oder Pfeile.
Besser wäre, wenn man sein eigenes System zum Mitschreiben entwickelt. Dabei benutzt man spezielle Piktogramme und Verweisembleme.
In der Auseinandersetzung mit diesem Thema hat Sommer, R (2006, 29) darauf hingewiesen, dass man in Nachbereitung von Notizen genug Zeit investieren sollte, um sie zu überarbeiten. Dies verbessert die Qualität und die Brauchbarkeit dieser Notizen, die man später gebrauchen könnte. Für eine bessere Qualität der Mitschrift ist laut Sommer, R[4] (2006, 29) auch eine professionelle Ablage sehr empfehlenswert. Die Notizen können ferner abgetippt und elektronisch gespeichert werden, damit sie bei Bedarf schnell gefunden werden können.
In Anlehnung an Beste[5], G., (2007, 258) gibt es zwei Möglichkeiten beim Mitschreiben. Entweder schreibt man wortwörtlich mit oder verfasst man die Informationen mit eigenen Worten. Beim wortwörtlichen Notieren ist es möglich, dass man fachliche Informationen korrekt registriert. Anders verhält es, wenn man mit eigenen Worten verfasst. Es könnte passieren, dass man etwas nicht verstanden habe.
[...]
[1] Steets, Angelika In: Konrad Ehlich, Schulische Textarten, universitäre Textarten und das Problem ihrer Passung, Mitteilungen des Deutschen Germanistikverbandes, 50 Jahrgang, Heft 2-3 /2003.
[2] Kroeger, H. Mitschreiben und Mitschrift. In : Horst, Uwe und Ohly Karl P. (Hrg). Lernbox. Lernmethoden-Arbeittechniken. Seelze, Velber. Friedrich Verlag. 2000
[3] Ehlich, K., Steets, A. (Hgg.) 2003. wissenschaftlich schreiben- lehren und lernen. Bln.: de Gruyter
[4] Sommer, R. 2006. Schreibkompetenzen. Erfolgreich wissenschaftlich schreiben. Klett. Stuttgart
[5] Beste, Gisela, (2007) Deutsch Methodik. Handbuch für die Sekundarstufe 1 und 2. Leistungen feststellen und beurteilen. . Cornelsen Scriptor. Berlin.
- Quote paper
- Mohamed Chaabani (Author), 2012, Die Mitschrift im Fremdsprachenunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197881