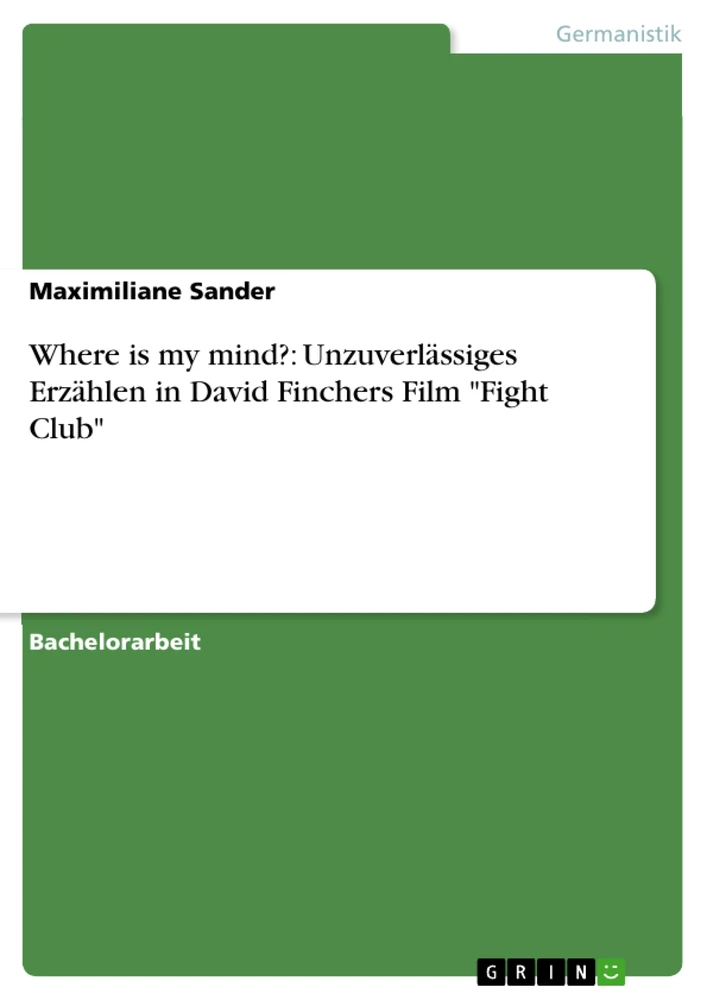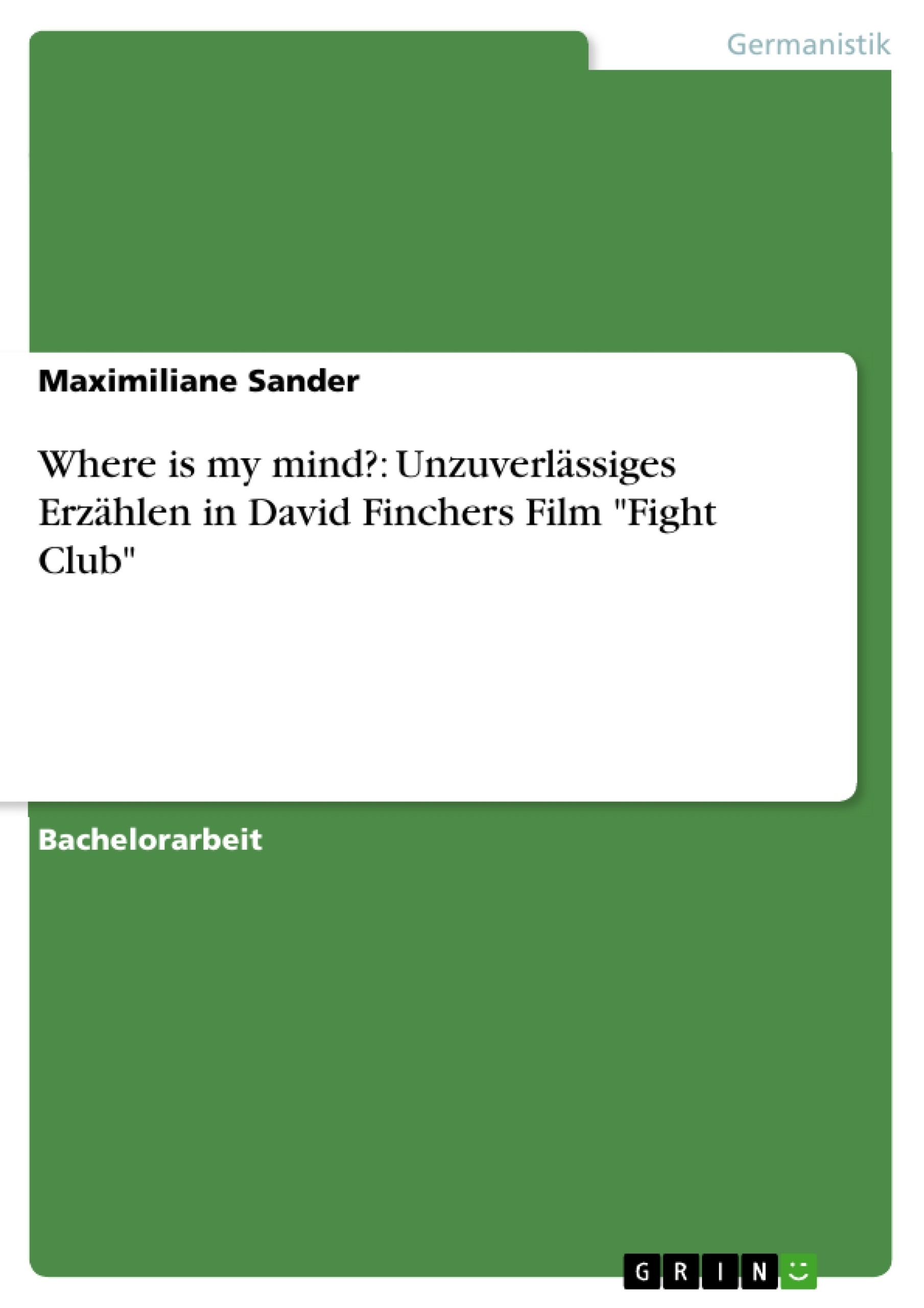1. Einleitung
With your feet in the air and your head on the ground
try this trick and spin it, yeah
your head will collapse, but there's nothing in it
and you'll ask yourself:
Where is my mind?
(Where is my mind – The Pixies)
Der Film FIGHT CLUB von David Fincher aus dem Jahre 1999 gilt als einer der besten Filme der 1990er Jahre1. Daher ist es verständlich, dass auch in der literaturwissenschaftlichen Forschung Interesse an FIGHT CLUB besteht.
(...)
In dieser Arbeit soll zunächst die in der Literaturwissenschaft etablierte Erzähltheorie nach Genette vorgestellt werden, die als Leitfaden dient, um Erzählsituation analysieren zu können und somit auch einen direkten Bezug zum unzuverlässigen Erzählen besitzt.
Hierbei werde ich mich bei der Darstellung Genettes Theorien weitestgehend auf die Aspekte beschränken, die im Hinblick auf die Analyse des Filmes FIGHT CLUB nutzbar gemacht werden können. Des Weiteren werde ich filmspezifische Erzähltechniken vorstellen, welche in der Eigenart des Filmes, sich durch sowohl visuelle als auch auditive Formen auszudrücken, begründet liegen. Daraufhin werde ich verschiedene Theorien zum unzuverlässigen Erzählen im Film vorstellen. Hierbei werde ich mich aus Platzgründen ebenfalls auf die für meine Analyse wichtigsten Theorien beschränken, welche jedoch einen guten Überblick über das Thema der Unzuverlässigkeit im Film gewährleisten.
Durch eine Sequenzanalyse des Filmes FIGHT CLUB, die sich sowohl inhaltlichen, erzählerischen als auch – wenn auch nur im geringeren Maße – filmanalytischen Aspekten widmet, sowie durch die Interpretation der Analyseergebnisse, möchte ich herausarbeiten, wie das unzuverlässige Erzählen in FIGHT CLUB eingesetzt ist und welche Lesarten der Film anbietet. Die Analyse der erzählerischen Aspekte erfolgt hierbei auf Grundlage der Theorie Genettes, da ich mich, im Gegensatz zu Hickethier29, der diese im Hinblick auf den Film für unfruchtbar hält, den Arbeiten anschließe, welche davon ausgehen, dass Genettes Begrifflichkeiten auf den Film übertragen werden können und die Unterscheidung von Narration und Fokalisation für eine differenzierte Analyse hilfreich ist30. In einem abschließenden Fazit werde ich meine Ergebnisse sammeln und einen Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten geben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erzähltheoretischer Hintergrund
- Erzähltheorie nach Genette
- Erzählen im Film
- Unzuverlässiges Erzählen im Film
- Funktionen des unzuverlässigen Erzählens
- FIGHT CLUB
- Inhaltsangabe
- Analyse ausgesuchter Sequenzen und Interpretation im Hinblick auf unzuverlässiges Erzählen
- Lesarten
- Psychologisierte Lesart
- Gesellschaftskritische Lesart
- Medienspezifische Lesart
- Geschlechterspezifische Lesart
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die narrative Strategie des unzuverlässigen Erzählens in David Finchers Film "Fight Club" (1999) und erforscht, wie diese Strategie den Film prägt und welche Lesarten sich daraus ergeben. Die Analyse stützt sich auf erzähltheoretische Konzepte und untersucht die Funktionen des unzuverlässigen Erzählens im Film. Die Arbeit berücksichtigt die Interpretationsmöglichkeiten, die durch die narrative Unzuverlässigkeit geschaffen werden, und beleuchtet verschiedene Lesarten des Films.
- Unzuverlässiges Erzählen im Film
- Analyse der narrativen Strategien in "Fight Club"
- Interpretation der Lesarten, die durch die Unzuverlässigkeit entstehen
- Die Rolle des Erzählers in der Konstruktion der Bedeutung
- Die Verbindung zwischen narrativer Strategie und filmischer Gestaltung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema "Unzuverlässiges Erzählen in David Finchers Film 'Fight Club'" ein und beleuchtet die Relevanz des Films in der literaturwissenschaftlichen Forschung. Kapitel 2 befasst sich mit dem erzähltheoretischen Hintergrund und stellt verschiedene Ansätze zur Unzuverlässigkeit im Film vor, insbesondere die Theorien von Genette, Booth und Nünning. Kapitel 3 analysiert ausgewählte Sequenzen aus "Fight Club" und interpretiert diese im Hinblick auf unzuverlässiges Erzählen. Es werden unterschiedliche Lesarten des Films betrachtet, darunter die psychologisierte, gesellschaftskritische, medienspezifische und geschlechterspezifische Lesart. Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Analyse zusammen und diskutiert die Relevanz des unzuverlässigen Erzählens in "Fight Club" im Kontext der filmischen Erzählkunst.
Schlüsselwörter
Unzuverlässiges Erzählen, David Fincher, Fight Club, Film, Erzähltheorie, Genette, Booth, Nünning, Lesarten, Psychologisierte Lesart, Gesellschaftskritische Lesart, Medienspezifische Lesart, Geschlechterspezifische Lesart, Narrative Strategien, Filmische Gestaltung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „unzuverlässigem Erzählen“?
Es ist eine Erzählstrategie, bei der die Glaubwürdigkeit des Erzählers in Frage gestellt wird. Der Zuschauer oder Leser erfährt erst später, dass die gezeigten oder erzählten Ereignisse nicht der Realität der fiktiven Welt entsprechen.
Welche erzähltheoretischen Grundlagen werden für die Analyse von „Fight Club“ genutzt?
Die Arbeit stützt sich primär auf die Erzähltheorie von Gérard Genette, insbesondere auf die Unterscheidung zwischen Narration (wer spricht?) und Fokalisation (wer sieht?).
Wie setzt David Fincher Unzuverlässigkeit filmisch um?
Durch visuelle und auditive Techniken, die die subjektive Wahrnehmung des Protagonisten widerspiegeln, sowie durch subtile Hinweise (Flashes), die erst bei wiederholtem Sehen verständlich werden.
Welche Lesarten bietet der Film „Fight Club“ an?
Die Arbeit diskutiert eine psychologisierte Lesart (Schizophrenie), eine gesellschaftskritische (Konsumkritik), eine medienspezifische und eine geschlechterspezifische Lesart.
Warum ist die Schlussszene (begleitet von „Where is my mind?“) so bedeutsam?
Sie markiert den Moment der endgültigen Auflösung der unzuverlässigen Erzählstruktur und symbolisiert den Zusammenbruch der bisherigen Identitätskonstruktion des Protagonisten.
- Citation du texte
- Maximiliane Sander (Auteur), 2011, Where is my mind?: Unzuverlässiges Erzählen in David Finchers Film "Fight Club", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197893