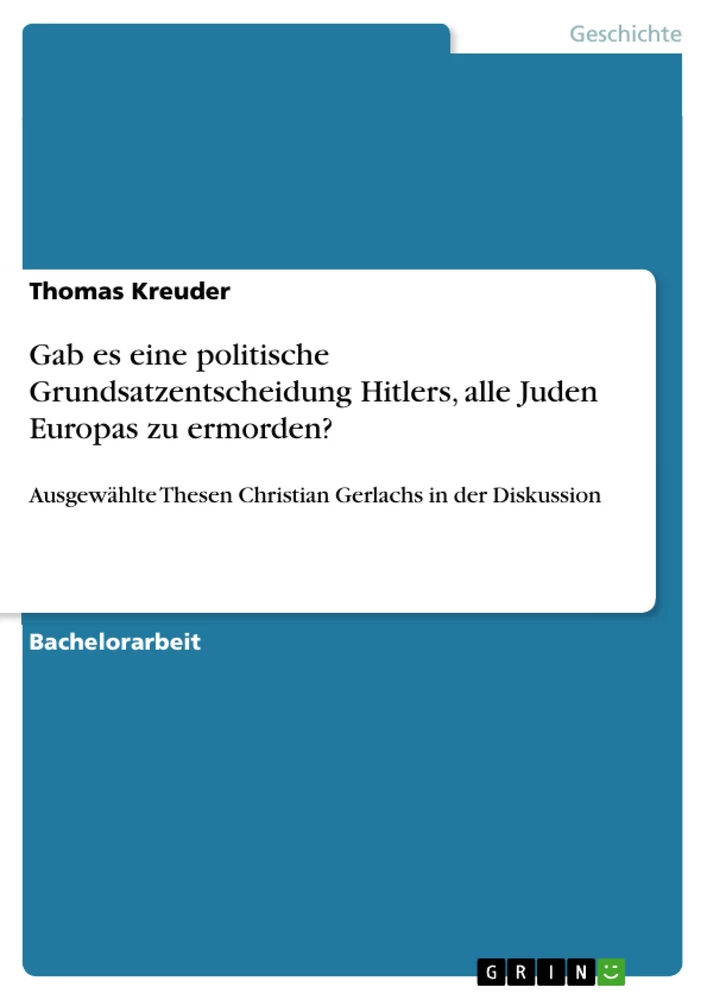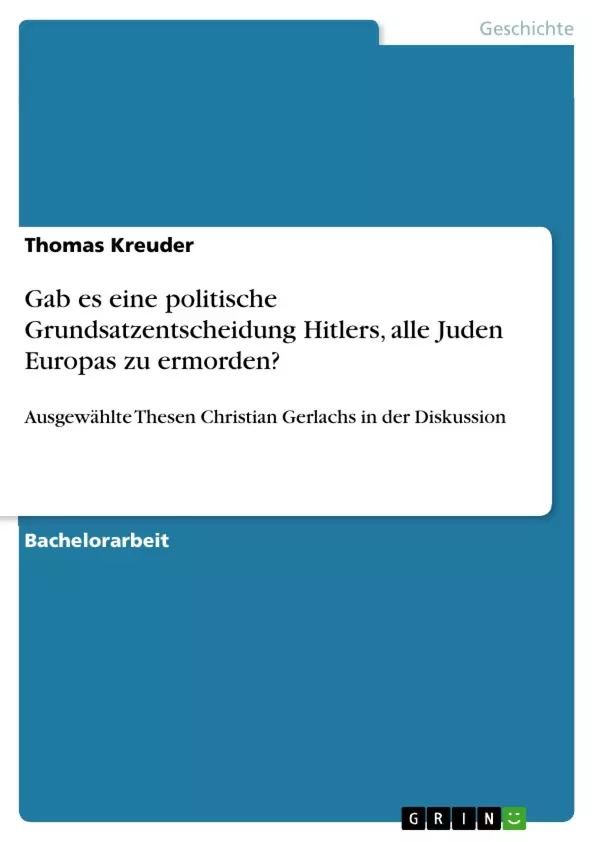Allgemeine anerkannte Gültigkeit scheint die These zu besitzen, dass Menschen interessiert daran sind, historische Ereignisse an bzw. ab einem bestimmten Zeitpunkt verorten zu können. Dieses, so wird angenommen, hilft in der Gegenwart sich mit den historischen Ereignissen, so negativ oder positiv sie auch waren, auseinanderzusetzen und dient dazu problematische Sachverhalte zu klären. Es entsteht somit ein Bedürfnis seitens der Bevölkerung nach diesen ‘bestimmten‘ Zeitpunkten. Historiker und Historikerinnen versuchen diese Bedürfnisse durch ihre Forschungen und die damit verbundenen Veröffentlichungen zu stillen. Unterschiedliche Ergebnisse von verschiedenen Forschern zu einer Forschungsfrage deuten auf ungleiche Herangehensweisen und Lesarten zu dem untersuchten Themenkomplex hin und können mitunter zu öffentlich ausgetragenen Kontroversen führen.
Die Frage nach einer politischen Grundsatzentscheidung alle europäischen Juden zu ermorden stellt mit eine der zentralen Herausforderungen der NS-Forschung dar. Da bis dato kein schriftlicher Befehl der NS-Obrigkeit, speziell von Adolf Hitler, gefunden wurde an dem sich der Zeitpunkt der politischen Grundsatzentscheidung ausmachen lassen könnte, versucht die Forschung anhand verschiedener Indizien diesen Punkt zu bestimmen. Des Weiteren findet sich neben den Verbrechen des NS-Regimes nichts Vergleichbares innerhalb der Globalgeschichte. Ihnen kann, zu Recht, der Status der Einzigartigkeit zugesprochen werden. Dieser Umstand erfordert es aufgeklärt zu werden, um von den Ergebnissen für die Gegenwart und Zukunft zu lernen, damit sich so etwas wie der Holocaust niemals wiederholt.
Ein weiteres Argument, warum die Frage nach einer Grundsatzentscheidung eine der zentralen Herausforderungen der NS-Forschung darstellt, ist die Art der Methodik, mithilfe derer versucht wird eine Antwort auf diese Frage zu geben. Durch diese unterschiedlichen Herangehensweisen unterliegt das gegenwärtige Bild auf die nationalsozialistische Diktatur ständigen Veränderungen.
Der Aufsatz von Christian Gerlach ist der Versuch einer Antwort auf die Frage, wann und ob Adolf Hitler eine politische Grundsatzentscheidung zum Völkermord bekannt gab. Aufgrund „neuer“ Quellen, die er verwendet, und der Verknüpfung der möglichen politischen Grundsatzentscheidung Hitlers mit belegbaren Daten aus dem Umfeld seiner Führungsgenossen gelingt ihm eine in sich logische Indizienkette, mit der er seine These zu belegen vermag.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Entwicklung des Forschungsstandes und Annahmen zur Entschlussbildung zum Völkermord vor dem Aufsatz von Gerlach
- 2.1 Exkurs: Zur Begrifflichkeit der „Endlösung der Judenfrage“ – eine Bezeichnung mit mehreren Synonymen?
- 3. Christian Gerlachs Thesen im Aufsatz „Die Wannsee-Konferenz, das Schicksal der deutschen Juden und Hitlers politische Grundsatzentscheidung, alle Juden Europas zu ermorden“
- 3.1 Hitlers Grundsatzentscheidung zur Ermordung der europäischen Juden
- 4. Ablehnung vs. Akzeptanz - Die Thesendiskussion in den freien Medien und fachspezifischer Literatur
- 4.1 Die Jahre 1997-2004
- 4.2 Die Jahre 2005-2011
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage nach einer politischen Grundsatzentscheidung Hitlers zur Ermordung aller europäischen Juden, insbesondere im Kontext der Thesen von Christian Gerlach. Sie analysiert den bisherigen Forschungsstand, Gerlachs Argumentation und die darauf folgenden Reaktionen in Medien und Fachliteratur.
- Entwicklung des Forschungsstandes zur Frage nach Hitlers Entscheidung zum Völkermord.
- Analyse der Thesen von Christian Gerlach und seiner Interpretation der Wannsee-Konferenz.
- Bewertung der Kontroverse um Gerlachs Thesen in der Öffentlichkeit und der Fachwelt.
- Untersuchung verschiedener methodischer Ansätze in der NS-Forschung zur Thematik.
- Die Bedeutung der Begrifflichkeit „Endlösung der Judenfrage“.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach einer politischen Grundsatzentscheidung Hitlers zum Völkermord an den europäischen Juden. Sie vergleicht zwei Reden von Richard von Weizsäcker und Christian Wulff zur Wannsee-Konferenz, um unterschiedliche Interpretationen des Ereignisses und des damit verbundenen Entschlusses zu verdeutlichen. Die Einleitung betont die Bedeutung der Frage nach dem Zeitpunkt der Entscheidung für das Verständnis des Holocaust und die Notwendigkeit, die unterschiedlichen methodischen Ansätze in der NS-Forschung zu berücksichtigen.
2. Entwicklung des Forschungsstandes und Annahmen zur Entschlussbildung zum Völkermord vor dem Aufsatz von Gerlach: Dieses Kapitel beleuchtet den Forschungsstand zur Frage nach Hitlers Entscheidung zum Holocaust vor dem Erscheinen von Gerlachs Aufsatz. Es diskutiert die unterschiedlichen methodischen Ansätze – den intentional bzw. hitleristischen und den strukturalistischen – und deren jeweilige Bedeutung für die Interpretation der historischen Ereignisse. Der Exkurs zu 2.1 beleuchtet die vielschichtige Bedeutung der „Endlösung der Judenfrage“ und deren verschiedene Synonyme, was die Komplexität der Forschungsfrage unterstreicht.
3. Christian Gerlachs Thesen im Aufsatz „Die Wannsee-Konferenz, das Schicksal der deutschen Juden und Hitlers politische Grundsatzentscheidung, alle Juden Europas zu ermorden“: Dieses Kapitel analysiert detailliert die Thesen von Christian Gerlach in seinem Aufsatz. Der Fokus liegt auf Gerlachs Argumentation zur Frage einer politischen Grundsatzentscheidung Hitlers zur Ermordung aller europäischen Juden, und wie er diese These anhand von Quellen und Analysen zu belegen versucht. Besonderes Augenmerk wird auf die Interpretation der Wannsee-Konferenz gelegt und deren Bedeutung im Kontext der Gesamtstrategie des NS-Regimes.
4. Ablehnung vs. Akzeptanz - Die Thesendiskussion in den freien Medien und fachspezifischer Literatur: Dieses Kapitel beschreibt die Reaktionen auf Gerlachs Thesen in den Medien und der Fachliteratur, getrennt nach den Zeiträumen 1997-2004 und 2005-2011. Es analysiert die verschiedenen Positionen und Argumente, die in der Diskussion vorgebracht wurden, und beleuchtet die Kontroverse um Gerlachs Interpretationen. Die Entwicklung der Debatte über die Zeit wird nachgezeichnet und zeigt die unterschiedlichen Perspektiven und den Wandel der wissenschaftlichen Diskussion auf.
Schlüsselwörter
Holocaust, NS-Forschung, Wannsee-Konferenz, Christian Gerlach, Adolf Hitler, politische Grundsatzentscheidung, Völkermord, Endlösung der Judenfrage, intentionaler Ansatz, strukturalistischer Ansatz, Historikerstreit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Thesen von Christian Gerlach zur „Grundsatzentscheidung“ Hitlers
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Frage nach einer politischen Grundsatzentscheidung Adolf Hitlers zur Ermordung aller europäischen Juden. Im Zentrum steht die Analyse der Thesen von Christian Gerlach und die darauf folgenden Reaktionen in Medien und Fachliteratur.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung des Forschungsstandes zur Frage nach Hitlers Entscheidung zum Völkermord, analysiert Gerlachs Argumentation und seine Interpretation der Wannsee-Konferenz, bewertet die Kontroverse um seine Thesen und untersucht verschiedene methodische Ansätze in der NS-Forschung (intentionaler vs. strukturalistischer Ansatz). Die Bedeutung der Begrifflichkeit „Endlösung der Judenfrage“ wird ebenfalls thematisiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Entwicklung des Forschungsstandes vor Gerlachs Aufsatz (inkl. Exkurs zur Begrifflichkeit „Endlösung“), Analyse von Gerlachs Thesen, Diskussion der Reaktionen in Medien und Fachliteratur (gegliedert nach 1997-2004 und 2005-2011) und Fazit.
Wie wird der Forschungsstand vor Gerlach dargestellt?
Das zweite Kapitel beschreibt den Forschungsstand zur Frage nach Hitlers Entscheidung zum Holocaust vor Veröffentlichung von Gerlachs Aufsatz. Es werden unterschiedliche methodische Ansätze, der intentionale und der strukturalistische Ansatz, und deren Bedeutung für die Interpretation der historischen Ereignisse diskutiert.
Wie werden Gerlachs Thesen analysiert?
Kapitel drei analysiert detailliert Gerlachs Thesen in seinem Aufsatz „Die Wannsee-Konferenz, das Schicksal der deutschen Juden und Hitlers politische Grundsatzentscheidung, alle Juden Europas zu ermorden“. Der Fokus liegt auf seiner Argumentation für eine politische Grundsatzentscheidung Hitlers und der Interpretation der Wannsee-Konferenz.
Wie wird die Debatte um Gerlachs Thesen dargestellt?
Kapitel vier beschreibt die Reaktionen auf Gerlachs Thesen in Medien und Fachliteratur, getrennt nach den Zeiträumen 1997-2004 und 2005-2011. Es analysiert die verschiedenen Positionen und Argumente und zeichnet die Entwicklung der Debatte über die Zeit nach.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Holocaust, NS-Forschung, Wannsee-Konferenz, Christian Gerlach, Adolf Hitler, politische Grundsatzentscheidung, Völkermord, Endlösung der Judenfrage, intentionaler Ansatz, strukturalistischer Ansatz, Historikerstreit.
Welche methodischen Ansätze werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht den intentional bzw. hitleristischen und den strukturalistischen Ansatz in der NS-Forschung und deren Bedeutung für die Interpretation der historischen Ereignisse.
Welche Bedeutung hat die Begrifflichkeit „Endlösung der Judenfrage“?
Die Arbeit widmet einen Exkurs der vielschichtigen Bedeutung der „Endlösung der Judenfrage“ und ihren verschiedenen Synonymen, um die Komplexität der Forschungsfrage zu unterstreichen.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage ist, ob es eine politische Grundsatzentscheidung Hitlers zur Ermordung aller europäischen Juden gab, insbesondere im Kontext der Thesen von Christian Gerlach.
- Citar trabajo
- Thomas Kreuder (Autor), 2012, Gab es eine politische Grundsatzentscheidung Hitlers, alle Juden Europas zu ermorden?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197897