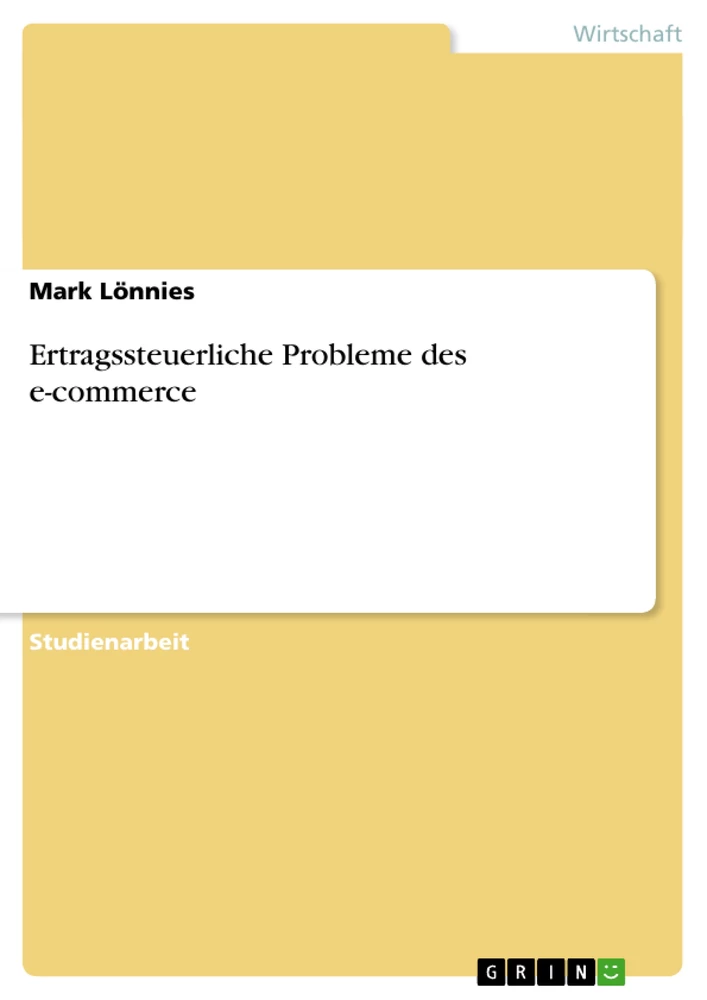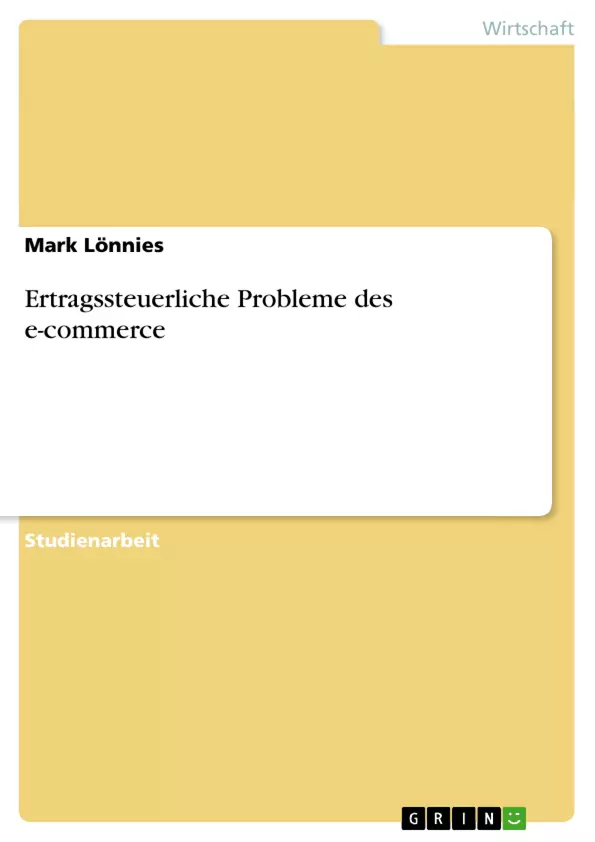Die voranschreitende Globalisierung der Märkte wird in besonderem Maße durch den
E-Commerce angetrieben. Eine Übersetzung mit „elektronischer Handel“ erscheint
simpel, umso vielfältiger ist das, was unter dem Begriff verstanden wird. E-Commerce
i.e.S. beschreibt die Bestellung einer „digitalen Ware“ via elektronischem Medium,
dessen Lieferung ebenfalls auf diesem Wege erfolgt,1 also z.B. der „Download“ von
Software.2 Vollzieht sich die Lieferung einer Ware auf traditionellem Weg und wurde
nur die Bestellung elektronisch aufgegeben, so bezeichnet diese Konstellation die etwas
weiter gefasste Betrachtungsweise des E-Commerce.
Steuerrechtlich kommt es durch die weltweite Verbindung von Computern über das
Internet zu erheblichen Problemen. Für diese Kommunikationsform ist es
bedeutungslos, ob der betroffene Rechner physisch am anderen Ende der Welt oder
nebenan steht. Bei den betrachteten Transaktionen des E-Commerce kommt es
dementsprechend zu einer vollständigen Trennung von räumlichen
Anknüpfungspunkten. Gerade dieser Aspekt bildet einen starken Gegensatz zum
Steuerrecht, das üblicherweise an die Grenzen eines Staates anknüpft. Dieser territoriale
Anknüpfungspunkt bildet die Grundlage der Besteuerung ausländischer Unternehmen
sowohl nach nationalem deutschen Steuerrecht, als auch nach den meisten durch
Deutschland abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen (DBA).3
Im Kern wird dieser territoriale Anknüpfungspunkt durch das Vorhandensein einer
Betriebsstätte oder eines ständigen Vertreters manifestiert. Im Mittelpunkt dieser Arbeit
steht die Frage, ob ein Internet-Server eine Betriebsstätte oder einen ständigen Vertreter
begründen kann, und ob daraus eine beschränkte inländische Steuerpflicht resultiert.
Einerseits wird die Qualifizierung der Einkünfte nach nationalem Steuerrecht geprüft,
andererseits anhand des OECD-Musterabkommens (OECD-MA), das hier als
Prüfungsmaßstab für die Vielzahl unterschiedlicher DBA dient.4
Die Analyse ertragsteuerlicher Probleme des E-Commerce macht die Darstellung
verschiedener Lösungsansätze seitens der Gesetzgebung notwendig. Die vorliegenden
Ausführungen schließen mit einer kurzen Illustration dieser Möglichkeiten ab.
1 Vgl. Schwager, S., E-Commerce, 2001, S. 478
2 Vgl. Endriss, A./Käbisch, V./Labermeier, A., Problemfelder, 1999, S. 2276
3 Vgl. Bernütz, S., Ertragsbesteuerung, 1997, S. 353
4 Vgl. Holler, G./Heerspink, F., Betriebstättenbegründung, 1998, S. 772
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitender Teil
- B. Einkünftequalifizierung bei der beschränkten Steuerpflicht
- I. Einkünfte aus Gewerbebetrieb
- 1. Nationales Recht
- a. Erfordernis einer Betriebsstätte
- b. Erfordernis eines ständigen Vertreters
- 2. Ergänzungen durch das Abkommensrecht
- 1. Nationales Recht
- II. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung/sonstige Einkünfte
- 1. Nationales Recht
- 2. Abkommensrechtliche Behandlung
- I. Einkünfte aus Gewerbebetrieb
- C. Reaktionsmöglichkeiten der Gesetzgebung
- I. Übernahme des Verwertungs- und Ausübungstatbestandes
- II. Einführung neuer Anknüpfungspunkte einer inländischen Besteuerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den ertragssteuerlichen Problemen des E-Commerce im deutschen Recht. Sie analysiert, wie Einkünfte aus E-Commerce-Aktivitäten im Rahmen der beschränkten Steuerpflicht qualifiziert werden und welche Reaktionsmöglichkeiten die Gesetzgebung auf die spezifischen Herausforderungen des E-Commerce bietet.
- Einkünftequalifizierung bei der beschränkten Steuerpflicht
- Anknüpfungspunkte einer inländischen Besteuerung
- Reaktionsmöglichkeiten der Gesetzgebung
- Nationale und internationale Rechtsnormen
- Steuerliche Auswirkungen des E-Commerce
Zusammenfassung der Kapitel
Der einleitende Teil führt in die Thematik des E-Commerce und seine steuerlichen Besonderheiten ein. Kapitel B befasst sich mit der Einkünftequalifizierung bei der beschränkten Steuerpflicht. Es analysiert die Einordnung von E-Commerce-Einkünften nach nationalem und internationalem Recht, insbesondere die Bedeutung von Betriebsstätten und ständigen Vertretern. Kapitel C untersucht Reaktionsmöglichkeiten der Gesetzgebung auf die steuerlichen Herausforderungen des E-Commerce, wie beispielsweise die Einführung neuer Anknüpfungspunkte für eine inländische Besteuerung.
Schlüsselwörter
E-Commerce, beschränkte Steuerpflicht, Einkünftequalifizierung, Betriebsstätte, ständiger Vertreter, Abkommensrecht, Reaktionsmöglichkeiten der Gesetzgebung, inländische Besteuerung, internationale Besteuerung, Steuerrecht, Digitalisierung
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptproblem bei der Besteuerung von E-Commerce?
Das Steuerrecht knüpft traditionell an territoriale Grenzen an, während E-Commerce-Transaktionen oft keinen physischen bzw. räumlichen Anknüpfungspunkt mehr besitzen.
Wann begründet ein Server eine Betriebsstätte?
Die Arbeit untersucht, unter welchen Bedingungen ein Internet-Server als Betriebsstätte oder ständiger Vertreter gilt und somit eine beschränkte Steuerpflicht auslösen kann.
Was ist der Unterschied zwischen E-Commerce im engen und weiten Sinne?
Im engen Sinne erfolgt auch die Lieferung digital (z.B. Download), im weiten Sinne wird nur die Bestellung elektronisch aufgegeben, die Lieferung erfolgt traditionell.
Welche Rolle spielt das OECD-Musterabkommen (OECD-MA)?
Es dient als internationaler Prüfungsmaßstab für Doppelbesteuerungsabkommen, um zu klären, welcher Staat das Besteuerungsrecht bei grenzüberschreitendem Handel hat.
Was versteht man unter beschränkter Steuerpflicht?
Sie betrifft ausländische Unternehmen, die im Inland (Deutschland) Einkünfte erzielen, ohne dort ihren Hauptsitz zu haben.
Welche neuen Anknüpfungspunkte diskutiert der Gesetzgeber?
Diskutiert werden Möglichkeiten wie die Einführung neuer Tatbestände für die inländische Besteuerung, die über die physische Präsenz hinausgehen.
- Citation du texte
- Mark Lönnies (Auteur), 2002, Ertragssteuerliche Probleme des e-commerce, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19790