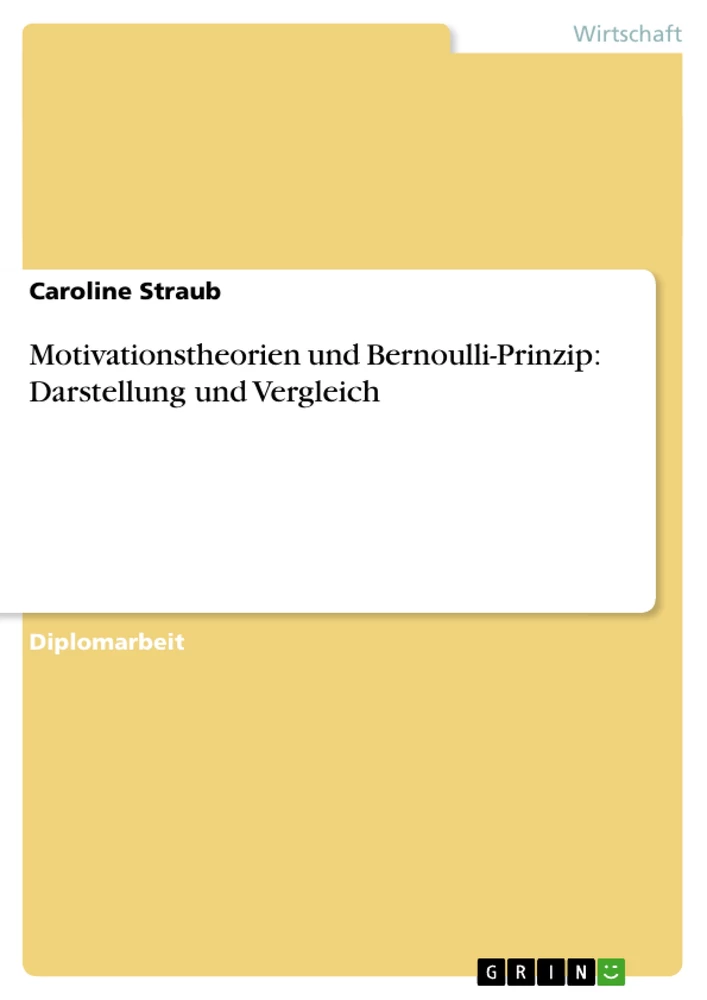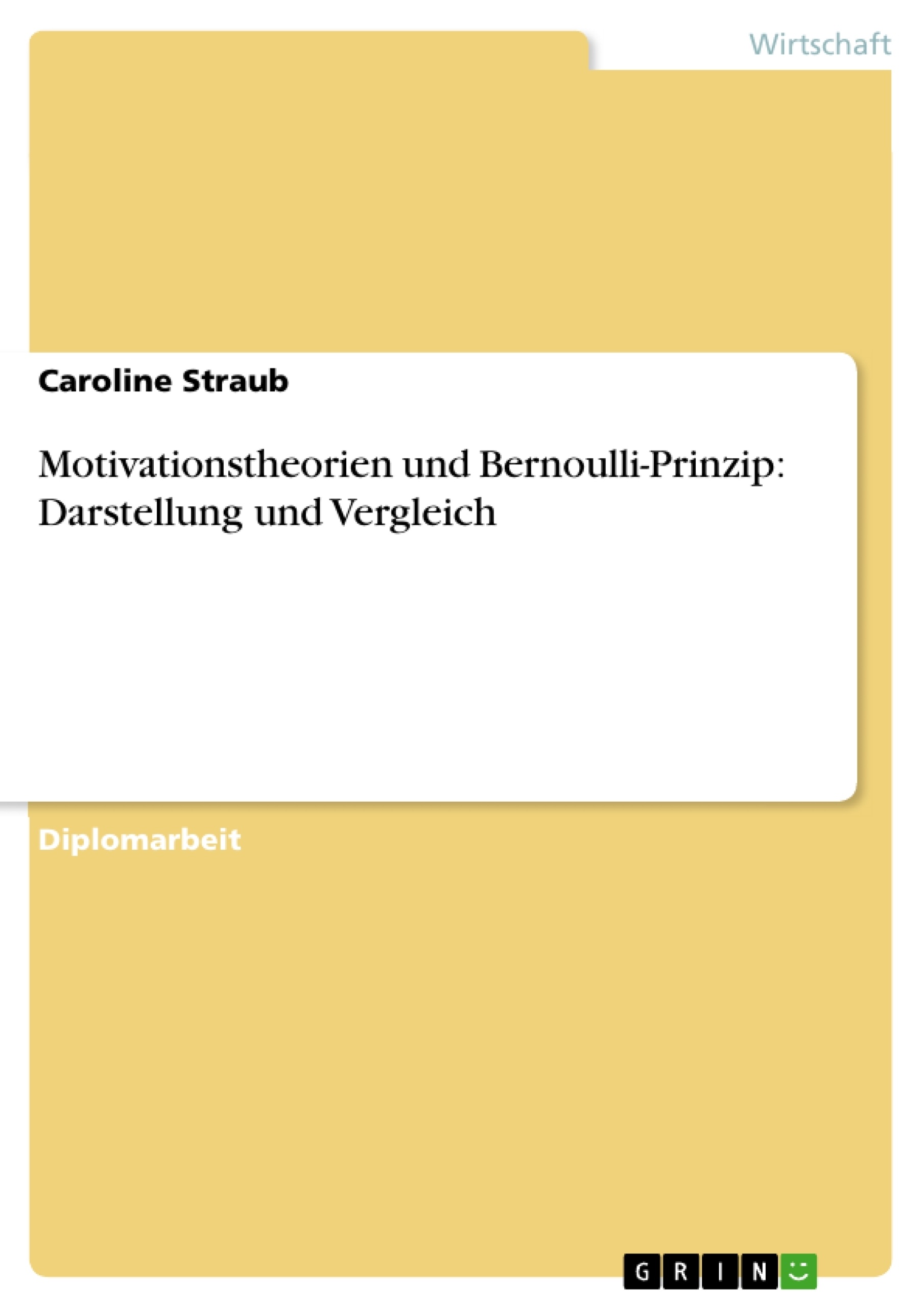[...]
Ausschlaggebend für die stetig zunehmende Beschäftigung mit der Frage, „wie
motiviere ich meine Mitarbeiter richtig?“, sind mehrere Dinge:
• Organisationen haben erkannt, dass mit dem Wandel von der Industrie -
hin zur Dienstleistungsgesellschaft der Mitarbeiter - als direktes Bindeglied
zum Kunden - einer der zentralen Erfolgsfaktoren ist.
• Sich verändernde Umweltbedingungen wie z. B. verschärfter Kostendruck
und erhöhte internationale Konkurrenz führen zu der Notwendigkeit,
die Effizienz und Effektivität der Mitarbeiter immer weiter zu erhöhen.
• Entscheidend für den Erfolg einer Organisation ist die Kontinuität des
Personalstamms. Der Kunde erwartet heute eine enge partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit einem ihm vertrauten Ansprechpartner, der ihm
stets das Gefühl vermittelt, individuell und persönlich betreut zu werden.
Die Sicherstellung dieser für die Organisation notwendige personelle
Kontinuität bedeutet daher, dass sie Anreize schaffen muss, die den Mitarbeiter
zum Verbleib und zum größtmöglichen Einsatz für die Interessen
der Organisation motivieren. Zum Überleben von Organisationen ist es daher notwendig, dafür zu sorgen,
dass Menschen sich nicht nur entscheiden, in die Organisation einzutreten,
sondern vor allem die ihnen übertragenen Aufgaben im Sinne der Organisation
auszuführen und darüber hinaus kreativ, spontan und innovativ zu handeln.
Diese Aufgabe ist mit der Fähigkeit verbunden, Mitarbeiter dazu zu
motivieren, ihre Qualifikationen in die Arbeit einzubringen und zielgerichtet
einzusetzen. Um dies zu gewährleisten, sind motivierende Anreizsysteme
unabdingbar.
Damit Unternehmen ihre Mitarbeiter in Form von Anreizen so motivieren, dass
deren Handeln mit den Unternehmenszielen im Einklang steht, müssen sie die
motivationalen Aspekte von menschlichem Verhalten kennen und in ihrer Personalpolitik
berücksichtigen. Sie müssen wissen, welche Kräfte Menschen
dazu bewegen, Energie in eine Handlung zu investieren, eine Handlung
überhaupt aufzunehmen, gewisse Leistungen zu vollbringen oder an der
Fertigstellung einer Aufgabe mit Initiative und Interesse zu arbeiten.
In der Wissenschaft wurden zahlreiche Theorien entwickelt, die das Verhalten
bzw. die Motivationsprozesse von Individuen beschreiben und zu erklären versuchen.
Ziel dieser Arbeit ist es, diese Theorien darzustellen, die Organisationen
als Hilfestellung dienen können, motivationale Prozesse ihrer Mitarbeiter
besser zu verstehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Gang der Untersuchung
- 2 Die Motivationstheorien
- 2.1 Einführung in die Motivationstheorien
- 2.2 Die Valenz-Instrumentalitäts-Erwartungstheorie von Vroom
- 2.2.1 Modelldarstellung
- 2.2.2 Empirische Befunde
- 2.2.3 Kritik
- 2.3 Das hybride Erwartungsmodell von Campbell et al.
- 2.3.1 Modelldarstellung
- 2.3.2 Empirische Befunde
- 2.3.3 Kritik
- 2.4 Die Motivationstheorie von Porter & Lawler
- 2.4.1 Modelldarstellung
- 2.4.2 Empirische Befunde
- 2.4.3 Kritik
- 2.5 Das Risikowahlmodell von Atkinson
- 2.5.1 Modelldarstellung
- 2.5.2 Empirische Befunde
- 2.5.3 Kritik
- 2.6 Der Weg-Ziel-Ansatz nach Neuberger
- 2.6.1 Modelldarstellung
- 2.6.2 Empirische Befunde
- 2.6.3 Kritik
- 2.7 Allgemeine Schlussbemerkung zu den Motivationstheorien
- 3 Das Bernoulli-Prinzip
- 3.1 Begriff und Inhalt
- 3.2 Messverfahren zur Bestimmung der Nutzenfunktion
- 3.3 Die Rationalität des Bernoulli-Prinzips
- 3.4 Empirische Befunde
- 3.5 Kritik
- 4 Ähnlichkeiten und Äquivalenzen: Ein Vergleich der Motivationstheorien mit dem Bernoulli-Prinzip
- 4.1 Grundlegende Gemeinsamkeiten
- 4.1.1 Eine einheitliche Grundstruktur
- 4.1.2 Die Annahme der Rationalität
- 4.2 Vergleich der einzelnen Komponenten der Ansätze
- 4.2.1 Die Wertkomponente
- 4.2.1.1 Begriffliche und inhaltliche Unterschiede
- 4.2.1.2 Unterschiede in der Bestimmung der Wertkomponente
- 4.2.2 Die Erwartungskomponente
- 4.2.2.1 Begriffliche und inhaltliche Unterschiede
- 4.2.2.2 Determinanten der Erwartungskomponente
- 4.2.3 Die Erwartungs-Wert-Komponente
- 4.2.1 Die Wertkomponente
- 4.3 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 4.1 Grundlegende Gemeinsamkeiten
- 5 Implikationen für die Gestaltung betrieblicher Anreizsysteme
- 5.1 Implikationen für das Führungsverhalten von Managern
- 5.1.1 Beeinflussung der subjektiven Erfolgswahrscheinlichkeit
- 5.1.2 Beeinflussung der Valenzen
- 5.1.3 Beeinflussung der Instrumentalitäten
- 5.2 Implikationen für Maßnahmen der organisatorischen Gestaltung
- 5.2.1 Beeinflussung der subjektiven Erfolgswahrscheinlichkeit
- 5.2.2 Beeinflussung der Valenzen
- 5.2.3 Beeinflussung der Instrumentalitäten
- 5.3 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 5.1 Implikationen für das Führungsverhalten von Managern
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit verfolgt das Ziel, verschiedene Motivationstheorien mit dem Bernoulli-Prinzip zu vergleichen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede aufzuzeigen. Die Arbeit untersucht die Anwendbarkeit der theoretischen Modelle auf die Gestaltung betrieblicher Anreizsysteme.
- Vergleich verschiedener Motivationstheorien (Vroom, Campbell et al., Porter & Lawler, Atkinson, Neuberger)
- Darstellung und Analyse des Bernoulli-Prinzips
- Identifizierung von Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen den Motivationstheorien und dem Bernoulli-Prinzip
- Ableitung von Implikationen für die Gestaltung betrieblicher Anreizsysteme
- Analyse der jeweiligen empirischen Befunde und Kritikpunkte der Modelle
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Arbeit ein und beschreibt die Problemstellung. Es wird die Relevanz des Themas im Kontext der betrieblichen Praxis herausgestellt und der Aufbau der Arbeit skizziert. Der Gang der Untersuchung wird dargelegt, um dem Leser einen klaren Überblick über den weiteren Verlauf zu geben.
2 Die Motivationstheorien: Dieses Kapitel präsentiert eine umfassende Darstellung verschiedener Motivationstheorien. Es werden die Modelle von Vroom, Campbell et al., Porter & Lawler, Atkinson und Neuberger detailliert beschrieben, inklusive ihrer Modelldarstellungen, empirischer Befunde und Kritikpunkte. Die einzelnen Theorien werden im Hinblick auf ihre jeweiligen Annahmen, Vorhersagen und Limitationen analysiert und miteinander verglichen, um ein umfassendes Verständnis des Forschungsstands zu ermöglichen. Die Kapitelstruktur ermöglicht es, die einzelnen Theorien systematisch zu betrachten und ihre Stärken und Schwächen herauszuarbeiten. Der Vergleich der Modelle dient dazu, die jeweiligen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu beleuchten und die Komplexität des Themas Motivation zu verdeutlichen.
3 Das Bernoulli-Prinzip: Dieses Kapitel erläutert das Bernoulli-Prinzip, seine zugrundeliegenden Annahmen und seine Anwendung in Entscheidungssituationen unter Risiko. Es werden verschiedene Messverfahren zur Bestimmung der Nutzenfunktion vorgestellt und die Rationalität des Prinzips diskutiert. Empirische Befunde und Kritikpunkte werden ebenfalls umfassend behandelt. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Kernidee des Bernoulli-Prinzips sowie auf den damit verbundenen methodischen und konzeptionellen Herausforderungen.
4 Ähnlichkeiten und Äquivalenzen: Ein Vergleich der Motivationstheorien mit dem Bernoulli-Prinzip: Dieses Kapitel stellt einen detaillierten Vergleich der in Kapitel 2 und 3 vorgestellten Konzepte dar. Es untersucht grundlegende Gemeinsamkeiten, insbesondere die Annahme einer einheitlichen Grundstruktur und der Rationalität der Entscheidungsträger. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich der einzelnen Komponenten (Wertkomponente, Erwartungskomponente und Erwartungs-Wert-Komponente) der verschiedenen Ansätze. Begriffliche und inhaltliche Unterschiede sowie Unterschiede in der Bestimmung der jeweiligen Komponenten werden systematisch analysiert und in Tabellen übersichtlich dargestellt, um die komplexen Zusammenhänge für den Leser verständlich zu machen. Die Ergebnisse dieses Vergleichs legen die Grundlage für die Schlussfolgerungen in den folgenden Kapiteln.
5 Implikationen für die Gestaltung betrieblicher Anreizsysteme: Kapitel 5 leitet aus dem Vergleich der Motivationstheorien und des Bernoulli-Prinzips Implikationen für die Gestaltung betrieblicher Anreizsysteme ab. Es wird untersucht, wie Führungskräfte die einzelnen Komponenten der Motivationstheorien (subjektive Erfolgswahrscheinlichkeit, Valenzen, Instrumentalitäten) beeinflussen können. Zusätzlich werden Implikationen für Maßnahmen der organisatorischen Gestaltung erörtert. Dieses Kapitel übersetzt die theoretischen Erkenntnisse in praktische Handlungsempfehlungen für die Gestaltung von motivierenden Arbeitsbedingungen und effizienten Anreizsystemen.
Schlüsselwörter
Motivationstheorien, Bernoulli-Prinzip, Erwartungstheorie, Risikowahlmodell, Weg-Ziel-Ansatz, Valenz, Instrumentalität, Erwartung, Nutzenfunktion, Anreizsysteme, Führungsverhalten, organisatorische Gestaltung, empirische Befunde, Rationalität.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Vergleich von Motivationstheorien und dem Bernoulli-Prinzip
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit vergleicht verschiedene Motivationstheorien (Vroom, Campbell et al., Porter & Lawler, Atkinson, Neuberger) mit dem Bernoulli-Prinzip. Sie untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen diesen Ansätzen und leitet daraus Implikationen für die Gestaltung betrieblicher Anreizsysteme ab.
Welche Motivationstheorien werden untersucht?
Die Arbeit analysiert detailliert die Modelle von Vroom (Valenz-Instrumentalitäts-Erwartungstheorie), Campbell et al. (hybrides Erwartungsmodell), Porter & Lawler, Atkinson (Risikowahlmodell) und Neuberger (Weg-Ziel-Ansatz). Für jedes Modell werden Modelldarstellung, empirische Befunde und Kritikpunkte diskutiert.
Wie wird das Bernoulli-Prinzip in die Analyse einbezogen?
Das Bernoulli-Prinzip wird als ein weiteres Entscheidungsmodell vorgestellt und mit den Motivationstheorien verglichen. Die Arbeit erläutert den Begriff, den Inhalt, Messverfahren zur Bestimmung der Nutzenfunktion, die Rationalität des Prinzips, empirische Befunde und Kritikpunkte.
Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Motivationstheorien und dem Bernoulli-Prinzip werden aufgezeigt?
Die Arbeit identifiziert grundlegende Gemeinsamkeiten wie eine einheitliche Grundstruktur und die Annahme der Rationalität. Ein detaillierter Vergleich der einzelnen Komponenten (Wertkomponente, Erwartungskomponente, Erwartungs-Wert-Komponente) der verschiedenen Ansätze deckt begriffliche und inhaltliche Unterschiede sowie Unterschiede in der Bestimmung der jeweiligen Komponenten auf.
Welche Implikationen ergeben sich für die Gestaltung betrieblicher Anreizsysteme?
Aus dem Vergleich werden Implikationen für die Gestaltung betrieblicher Anreizsysteme abgeleitet. Die Arbeit untersucht, wie Führungskräfte die Komponenten der Motivationstheorien (subjektive Erfolgswahrscheinlichkeit, Valenzen, Instrumentalitäten) beeinflussen können und erörtert Implikationen für Maßnahmen der organisatorischen Gestaltung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Motivationstheorien, Bernoulli-Prinzip, Erwartungstheorie, Risikowahlmodell, Weg-Ziel-Ansatz, Valenz, Instrumentalität, Erwartung, Nutzenfunktion, Anreizsysteme, Führungsverhalten, organisatorische Gestaltung, empirische Befunde, Rationalität.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung (Problemstellung, Gang der Untersuchung), Motivationstheorien, Bernoulli-Prinzip, Vergleich der Motivationstheorien mit dem Bernoulli-Prinzip, Implikationen für die Gestaltung betrieblicher Anreizsysteme und Fazit. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende, Wissenschaftler und Praktiker, die sich mit Motivationstheorien, Entscheidungsfindung unter Risiko und der Gestaltung von Anreizsystemen beschäftigen.
Wo finde ich den vollständigen Inhaltsverzeichnis?
Der vollständige und detaillierte Inhaltsverzeichnis ist im HTML-Dokument enthalten und zeigt die Struktur der Arbeit mit allen Unterkapiteln auf.
- Citation du texte
- Caroline Straub (Auteur), 2003, Motivationstheorien und Bernoulli-Prinzip: Darstellung und Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19792