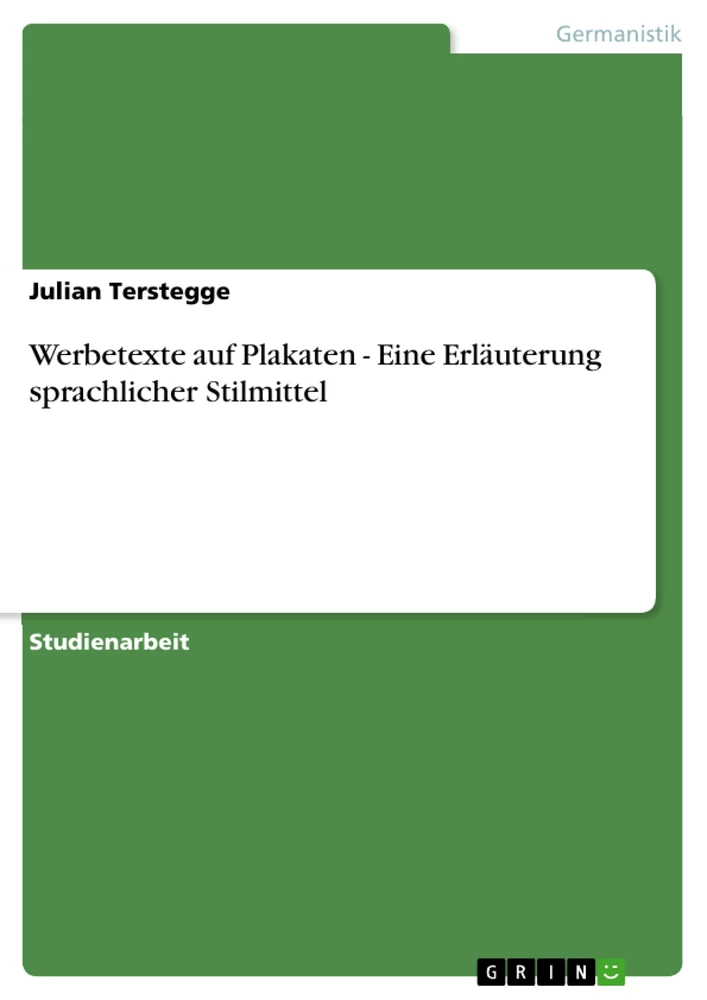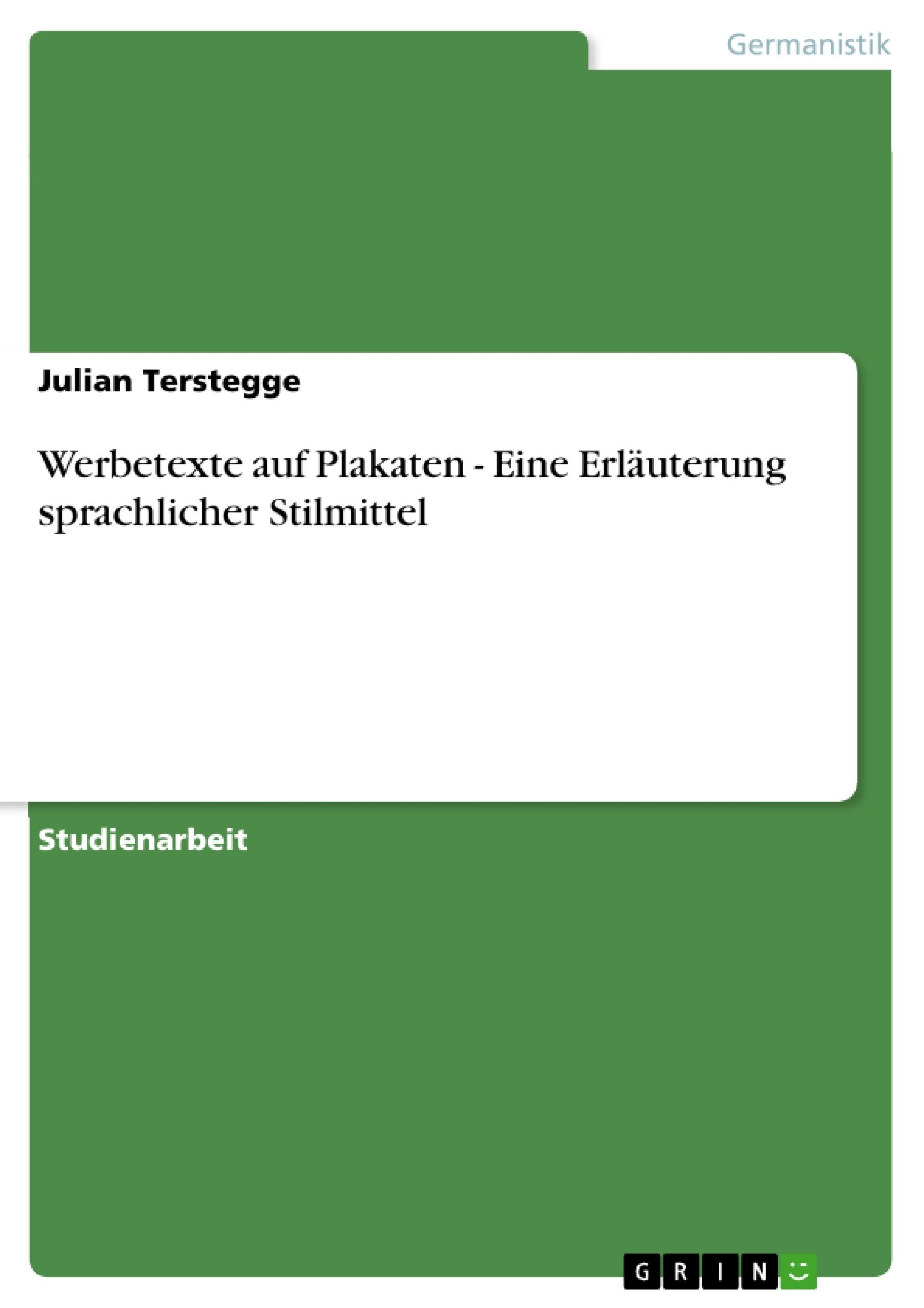"Werbung ist inzwischen in unserer Gesellschaft ein Phänomen, das nicht nur als Kulisse (auf Plakaten [...]) überall präsent ist und beim Medienkonsum zwangsläufig mitrezipiert wird [...], sondern das auch immer mehr Kult- und Kunststatus und damit ausdrückliche Aufmerksamkeit erhält." (Nina Janich)
Das gesellschaftliche Ansehen, das die Werbung inzwischen genießt zeigt sich deutlich in den zahlreichen, zum Teil internationalen, Ausschreibungen, welche herausragende Werbeleistungen ehren. Werbung ist also Kunst und gute Werbung wirkt oft ähnlich bewegend wie eine gelungene Malerei. Erstere nimmt dabei jedoch viel mehr am täglichen Leben teil und fordert mehr Kreativität, da neben der Bildebene immer auch der schriftliche Teil konzipiert werden muss. Das Zusammenspiel von Sprache, Bild und Aufbau macht Werbung zu einem komplexen Gebilde, dessen ausführliche Erläuterung den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Aus diesem Grund beschränke ich mich hier auf den sprachlichen Aspekt, welcher hinsichtlich der kreativen Möglichkeiten ergiebiger scheint. Ich werde im Folgenden, nachdem ich einen allgemeinen Überblick über die Werbung auf Plakaten gegeben habe, jene sprachlichen Mittel analysieren, die, meiner Meinung nach, besonders geeignet sind um Plakatwerbung „aufmerksamkeitsstark, ver-ständlich, glaubwürdig und prägnant“ zu gestalten und seine praktische Anwendung jeweils anhand eines Plakates aus Wirtschaft oder Politik erläutern. Abschließend werde ich begründet Stellung dazu nehmen, welches Stilmittel inwieweit für die Plakatwerbung geeignet ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ein Einstieg in die Plakatwerbung
- Lexik
- Wortarten
- Beispiel (Mc Donald's)
- Neue Wörter
- Beispiel (Schwalbe)
- (Pseudo-) Fachsprache
- Beispiel (Bank Coop)
- Fremdsprachen
- Beispiel (Apple)
- Jugendsprache
- Beispiel (Bündnis90/Die Grünen)
- Wortarten
- Rhetorik
- Beispiel (Bündnis90/Die Grünen)
- Sprachspiele
- Beispiel (Berliner Stadtreinigungsbetriebe)
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert sprachliche Stilmittel in der Plakatwerbung. Ziel ist es, aufzuzeigen, wie diese Mittel eingesetzt werden, um Aufmerksamkeit zu erregen, Verständlichkeit, Glaubwürdigkeit und Prägnanz zu erreichen. Die Analyse konzentriert sich auf den sprachlichen Aspekt der Plakatgestaltung und erläutert die Wirkung ausgewählter Stilmittel anhand konkreter Beispiele aus Wirtschaft und Politik.
- Analyse sprachlicher Stilmittel in der Plakatwerbung
- Wirkung verschiedener Wortarten und deren Anordnung
- Einsatz von rhetorischen Mitteln zur Steigerung der Aufmerksamkeit
- Die Rolle von Sprachspielen in der Plakatwerbung
- Bewertung der Eignung verschiedener Stilmittel für die Plakatwerbung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der sprachlichen Gestaltung von Plakatwerbung ein. Sie betont die zunehmende gesellschaftliche Bedeutung von Werbung und deren komplexen Aufbau aus Sprache, Bild und Gestaltung. Der Fokus der Arbeit wird auf die sprachlichen Aspekte gelegt, da diese als besonders ergiebig für kreative Gestaltungsmöglichkeiten angesehen werden. Die Arbeit kündigt die Analyse sprachlicher Mittel an, die für eine aufmerksamkeitsstarke, verständliche, glaubwürdige und prägnante Plakatwerbung geeignet sind, mit Beispielen aus Wirtschaft und Politik. Abschließend wird eine Bewertung der Eignung der Stilmittel für die Plakatwerbung erfolgen.
Ein Einstieg in die Plakatwerbung: Dieses Kapitel definiert den Begriff Werbung und differenziert ihn von bloßer Beeinflussung. Es werden die Besonderheiten der Plakatwerbung im Vergleich zu anderen Medien beleuchtet. Die kurze Betrachtungsdauer und der Wettbewerb mit anderen Plakaten betonen die Bedeutung von Prägnanz und Aufmerksamkeitserzeugung. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit, einen nachhaltigen Eindruck im Gedächtnis der Zielgruppe zu hinterlassen, was durch unerwartete und ungewöhnliche sprachliche Mittel erreicht werden soll.
Lexik: Dieses Kapitel analysiert die Verwendung von Wortarten in der Plakatwerbung. Es wird festgestellt, dass Substantive und Adjektive zahlenmäßig dominieren, wobei letztere oft ohne eindeutigen Bezug aneinandergereiht werden. Diese Technik ermöglicht die Interpretation als Eigenschaft des Produkts wie des Rezipienten und fördert so die Identifikation. Die Verwendung von Vollverben erzeugt Dynamik. Die Analyse zeigt, wie die gezielte Verwendung von Wortarten einen nachhaltigen Eindruck hinterlässt.
Schlüsselwörter
Plakatwerbung, Sprachliche Stilmittel, Wortarten, Rhetorik, Sprachspiele, Aufmerksamkeit, Prägnanz, Glaubwürdigkeit, Verständlichkeit, Identifikation, Wirkung, Werbesprache, Beispielanalysen.
Häufig gestellte Fragen zur sprachlichen Analyse von Plakatwerbung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert sprachliche Stilmittel in der Plakatwerbung. Der Fokus liegt auf der Untersuchung, wie diese Mittel eingesetzt werden, um Aufmerksamkeit zu erregen und Verständlichkeit, Glaubwürdigkeit und Prägnanz zu erreichen. Die Analyse konzentriert sich auf den sprachlichen Aspekt der Plakatgestaltung und erläutert die Wirkung ausgewählter Stilmittel anhand konkreter Beispiele aus Wirtschaft und Politik.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Analyse sprachlicher Stilmittel in der Plakatwerbung, die Wirkung verschiedener Wortarten und deren Anordnung, den Einsatz rhetorischer Mittel zur Steigerung der Aufmerksamkeit, die Rolle von Sprachspielen in der Plakatwerbung und die Bewertung der Eignung verschiedener Stilmittel für die Plakatwerbung. Konkrete Beispiele aus verschiedenen Bereichen (z.B. McDonald's, Apple, Bündnis90/Die Grünen) veranschaulichen die Anwendung der analysierten sprachlichen Mittel.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Einstieg in die Plakatwerbung, ein Kapitel zur Lexik (Wortarten, Neologismen, Fachsprache, Fremdsprachen, Jugendsprache), ein Kapitel zur Rhetorik, ein Kapitel zu Sprachspielen und ein Fazit. Jedes Kapitel analysiert die Verwendung spezifischer sprachlicher Mittel und deren Wirkung in der Plakatwerbung.
Wie wird die Lexik in der Plakatwerbung analysiert?
Das Kapitel "Lexik" analysiert die Verwendung verschiedener Wortarten (insbesondere Substantive und Adjektive), Neologismen, (Pseudo-)Fachsprache, Fremdsprachen und Jugendsprache in der Plakatwerbung. Es wird untersucht, wie diese Elemente zur Erzeugung von Aufmerksamkeit, zur Identifikation mit der Zielgruppe und zur Vermittlung von Botschaften beitragen.
Welche Rolle spielen Rhetorik und Sprachspiele?
Die Kapitel "Rhetorik" und "Sprachspiele" untersuchen den Einsatz rhetorischer Mittel und sprachlicher Spielereien in der Plakatwerbung. Es wird gezeigt, wie diese Mittel eingesetzt werden, um die Aufmerksamkeit des Betrachters zu gewinnen und die Botschaft nachhaltig im Gedächtnis zu verankern. Beispiele aus der Praxis illustrieren die Wirkung dieser Techniken.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und bewertet die Eignung der untersuchten sprachlichen Stilmittel für die Plakatwerbung. Es wird herausgestellt, wie wichtig eine prägnante, verständliche und glaubwürdige Sprache für den Erfolg von Plakatkampagnen ist.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Plakatwerbung, Sprachliche Stilmittel, Wortarten, Rhetorik, Sprachspiele, Aufmerksamkeit, Prägnanz, Glaubwürdigkeit, Verständlichkeit, Identifikation, Wirkung, Werbesprache, Beispielanalysen.
- Quote paper
- Julian Terstegge (Author), 2012, Werbetexte auf Plakaten - Eine Erläuterung sprachlicher Stilmittel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198014