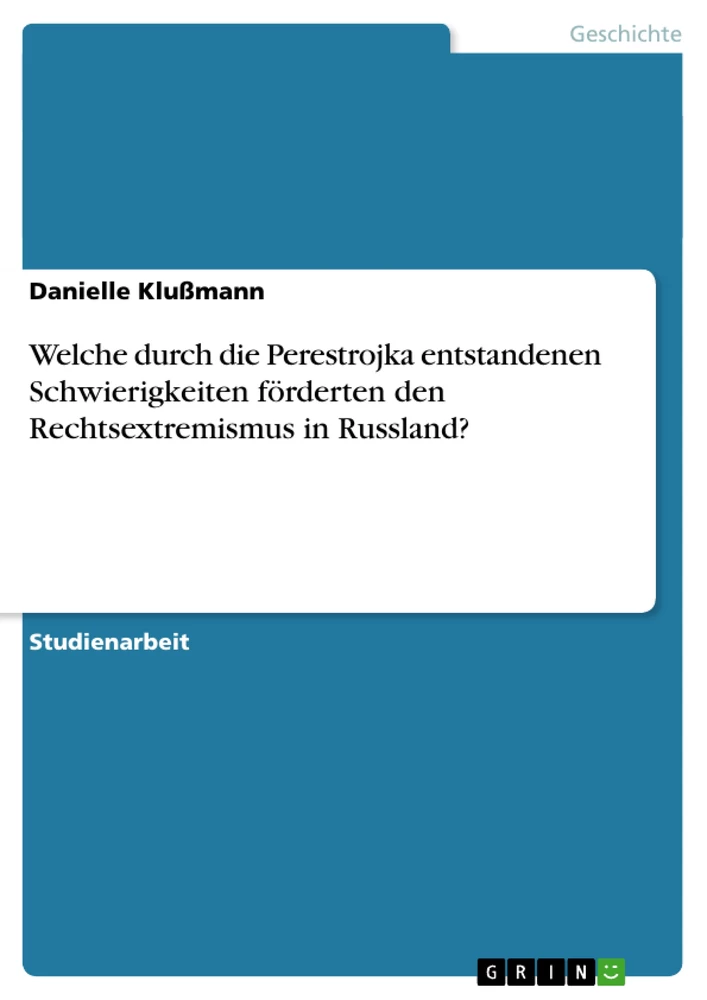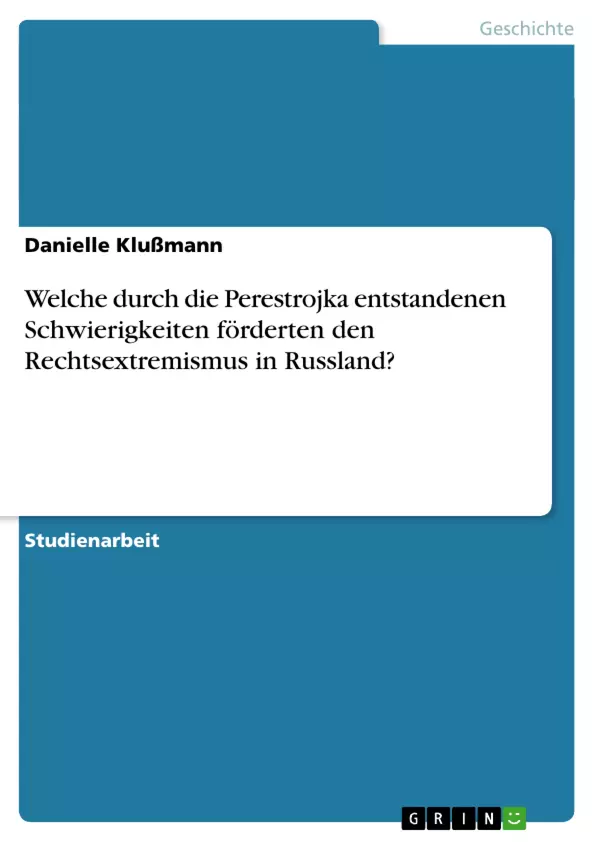„In St. Petersburg wird ein Schwarzafrikaner von Skinheads erstochen.“ „In Moskau werden zwei ermordete Tadschiken gefunden.“ Immer wieder veröffentlichen Forschungsstellen für Osteuropa solche und ähnliche Schlagzeilen. Dies macht deutlich, dass Rechtsextremismus kein rein deutsches Phänomen ist. Vielmehr findet er auch in Russland immer mehr Anhänger. Opfer sind meist Migranten, Schwarzafrikaner und Menschen mit kaukasischem Aussehen. Hier scheint es keine Rolle zu spielen, dass diese teilweise aus den ehemaligen Sowjetrepubliken kommen. Die Empörung über solche Übergriffe bleibt meist aus, die Medien berichten nur wenig darüber. Auch bei der Forschungsliteratur fällt auf, dass sich fast ausschließlich westliche Wissenschaftler mit diesem Problem beschäftigen.
Da der Rechtsextremismus in Russland seit dem Zerfall der UdSSR stark zugenommen hat, werde ich mich in dieser Arbeit mit dem Thema beschäftigen, welche durch die Perestrojka ausgelösten Schwierigkeiten diesen Anstieg des Rechtsextremismus in Russland förderten. Zu Beginn werde ich den Begriff der politischen Transformation klären und einen kurzen Abriss über die Ereignisse der Perestrojka geben. Im zweiten Teil werde ich die fünf größten Probleme der Nachperestrojka beleuchten. Die sozialen Problemen und die Glaubwürdigkeitskrise der Politik, die wirtschaftlichen Probleme, das Problem der Gleichzeitigkeit von sozialem und wirtschaftlichem Umbruch, der russische Nationalismus und der schwere Stand der Demokratie. Die unterschiedlichen Gruppen von Rechtsextremen und ihre Einstellung zum Zerfall des Imperiums schließen den Hauptteil ab. Die Quellen beruhen hier ausschließlich auf internationalen und russischen Statistiken.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Hauptteil
2.1 Was versteht man unter Transformation?
2.1. Wie veränderte die Perestrojka die Sowjetunion?.
2.1.1. Gorbatschows Pläne
2.1.2. Der Zusammenbruch der Sowjetunion
2.2. Welche Probleme entstanden durch die Perestrojka?
2.2.1. Soziale Desorientierung und die Glaubwürdigkeitskrise der Politik
2.2.2. Die Wirtschaftskrise und die materielle Armut
2.2.3. Die Gleichzeitigkeit von ökonomischer und politischer Neuorientierung
2.2.4. Der russische Nationalismus
2.2.5. Der schwere Stand der Demokratie
2.4. Die Rechtsextremen und der Zusammenbruch der UdSSR
3. Schluss.
Quellen- und Literaturverzeichnis
Quellen
Literatur
Anhang
1. Einleitung
„In St. Petersburg wird ein Schwarzafrikaner von Skinheads erstochen.“1 „In Moskau werden zwei ermordete Tadschiken gefunden.“2 Immer wieder veröffentlichen Forschungsstellen für Osteuropa solche und ähnliche Schlagzeilen. Dies macht deutlich, dass Rechtsextremismus kein rein deutsches Phänomen ist. Vielmehr findet er auch in Russland immer mehr Anhänger. Opfer sind meist Migranten, Schwarzafrikaner und Menschen mit kaukasischem Aussehen. Hier scheint es keine Rolle zu spielen, dass diese teilweise aus den ehemaligen Sowjetrepubliken kommen. Die Empörung über solche Übergriffe bleibt meist aus, die Medien berichten nur wenig darüber. Auch bei der Forschungsliteratur fällt auf, dass sich fast ausschließlich westliche Wissenschaftler mit diesem Problem beschäftigen.
Da der Rechtsextremismus in Russland seit dem Zerfall der UdSSR stark zugenommen hat, werde ich mich in dieser Arbeit mit dem Thema beschäftigen, welche durch die Perestrojka ausgelösten Schwierigkeiten diesen Anstieg des Rechtsextremismus in Russland förderten. Zu Beginn werde ich den Begriff der politischen Transformation klären und einen kurzen Abriss über die Ereignisse der Perestrojka geben. Im zweiten Teil werde ich die fünf größten Probleme der Nachperestrojka beleuchten. Die sozialen Problemen und die Glaubwürdigkeitskrise der Politik, die wirtschaftlichen Probleme, das Problem der Gleichzeitigkeit von sozialem und wirtschaftlichem Umbruch, der russische Nationalismus und der schwere Stand der Demokratie. Die unterschiedlichen Gruppen von Rechtsextremen und ihre Einstellung zum Zerfall des Imperiums schließen den Hauptteil ab. Die Quellen beruhen hier ausschließlich auf internationalen und russischen Statistiken. Diese können als Stimmungsbild der Bevölkerung gesehen werden und sind aus diesem Grund gut als Quellen zu gebrauchen. Medien berichten kaum über das Problem des russischen Rechtsextremismus und stehen daher nicht als Quellen zur Verfügung. Als wichtigste Sekundärliteratur sind die Aufsätze von Timm Beichelt und Michael Minkenberg, die in der Zeitschrift Osteuropa erschienen sind, zu nennen. Sämtliche verwendete Sekundärliteratur ist zwischen 1991 und 2007 erschienen. Einzige Ausnahme ist das Buch von Boris Meissner, das im Jahre 1988 erschienen ist, aber sehr schön zeigt, wie die Probleme bereits am Anfang wahrgenommen wurden.
2. Hauptteil
2.1 Was versteht man unter Transformation?
Transformation kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Umformung oder Umwandlung. In der Politikwissenschaft versteht man unter Transformation einen Systemwechsel, d.h. die Umwandlung oder der Wechsel eines Regierungssystems, häufig verbunden mit einer grundlegenden Änderung des Gesellschafts- und Wirtschaftssystems. In der Regel ist hiermit die Umwandlung eines nicht-demokratischen Systems mit Zentralverwaltungswirtschaft zu einer Demokratie mit Marktwirtschaft gemeint. Seit den 1990er Jahren werden hauptsächlich die Umbrüche in den ehemaligen sozialistischen Republiken Osteuropas als Transformation bezeichnet. Da jedoch auch die Demokratisierungen der letzten europäischen Diktaturen in Portugal, Spanien und Griechenland, ebenso wie die Systemwechsel in Ostasien, Süd- und Mittelamerika am Ende des 20. Jahrhunderts politische Transformationsprozesse waren, sind die Sozialwissenschaften inzwischen dazu übergegangen, die Entwicklungen in Osteuropa als ‚postkommunistische Systemtransformation’ zu bezeichnen.3
2.1. Wie veränderte die Perestrojka die Sowjetunion?
2.1.1. Gorbatschows Pläne
Schon seit Beginn der 1980er Jahre war der KPdSU bewusst, dass die Sowjetunion weit hinter dem Westen zurücklag. Doch erst mit Gorbatschow wurde eine Veränderung aktiv vorangetrieben. Gorbatschows Ziel, das durch die Schlagworte ‚Perestrojka’ und ‚Glasnost’ populär wurde, war eine Wirtschaft ohne Mängel und Defizite.4 Durch die Umgestaltung der ‚diktierten Planwirtschaft’ zu einer ‚gelenkten Planwirtschaft’ mit marktwirtschaftlichen Elementen, sollte der Lebensstandard der sowjetischen Bevölkerung verbessert und die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem Westen und damit die Weltmachtstellung der Sowjetunion gesichert werden.5 Diese Reformvorschläge des neuen Präsidenten fanden zu Beginn auch in der Bevölkerung großen Anklang. 1987 erachteten 86,4% das Programm für notwendig.6
Jedoch war eine erfolgreiche Perestrojka nur mit einer Demokratisierung der Wirtschaft zu realisieren. Dies sollte durch eine „ Umgestaltung des bestehenden sowjetischen Herrschafts- und Gesellschaftssystems “7 geschehen. Am Einparteienstaat und den staatssozialistischen Prinzipien wollte man aber keinesfalls rütteln.8 Demokratisierung hieß für Gorbatschow eine Selbstverwaltung des Volkes vereint mit den leninistischen Demokratievorstellungen.9 Es sollte „ nicht nur eine Verwaltung im Interesse des Volkes sein, sondern auch durch das Volk selbst in einem stÄrkeren Maße in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens und auf allen Ebenen des politischen Systems verwirklicht werden. “10 Im Januar 1987 scheiterte Gorbatschow mit seinem Vorschlag, mehrere Kandidaten bei einer Wahl zuzulassen am Widerstand der Partei. Dieser revolutionäre Vorschlag Gorbatschows auf dem KPdSU-Parteitag wurde nicht ausdrücklich gebilligt. Es folgten jedoch Experimente auf regionaler und lokaler Ebene, die sich aber lediglich auf kommunaler Ebene teilweise stärker bemerkbar machten.11
2.1.2. Der Zusammenbruch der Sowjetunion
Wolfgang Merkel sieht sechs verschiedene Gründe für den Zusammenbruch eines autoritären Regimes. Im Fall des Ostblocks lassen sich besonders die „ existenzgefÄhrdende LegitimitÄtskrise aufgrundÖkonomischer Ineffizienz “12 und der anschließende Dominoeffekt hervorheben.13 Aufgerüttelt durch die Reformen Gorbatschows und die Proteste Solidarnoscs 14 in Polen begannen die Bürger der Satellitenstaaten und den unterdrückten sowjetischen Teilrepubliken gegen das aufgedrängte System zu protestieren. Hier traf die sowjetische Führung vermutlich die schwerwiegendste Entscheidung während der kompletten Umbruchszeit, die den Untergang der Sowjetunion einleiten sollte. Gorbatschow hatte 1988 die Aufgabe der Breschnew-Doktrin verkündet, daher sah die Sowjetführung keine Veranlassung zu einer Intervention in den Bruderstaaten und überließ das Vorgehen gegen die Demonstranten der nationalen Führung. Diese hatten sich allerdings auf Moskau verlassen.15 So setzte in diesen Staaten eine Protestbewegung ein, die nicht mehr aufzuhalten war und schließlich zur Unabhängigkeit der Republiken und zum Zerfall der Sowjetunion und des Ostblocks führte.
Die anfängliche Freude der russischen Bevölkerung über den Reformwillen des Kremls16 schwand nach dem Zusammenbruch jedoch schnell. Im Jahr 1991 sank die Zustimmung zur Perestrojka auf 45,7%. Nach der endgültigen Auflösung der UdSSR stimmten sogar nur noch 22,7% den Reformen zu.17 Auch die Zustimmung zu den Erfolgen der Perestrojka sank nach dem Systemwechsel stark. Erkannten 1988 noch 51,8% gewisse Erfolge der Reform, waren es 1992 nur noch 8,2%. Auch zweifelten zu diesem Zeitpunkt bereits 80% an positiven Ergebnissen der Veränderung.18 Ebenso wie die Reform hatte es auch die Marktwirtschaft schwer in Russland anerkannt zu werden. Akzeptierten im ebenfalls ehemals sozialistischen Osten Deutschlands 86% die neue Wirtschaftsform, so waren es in Russland nur wenig mehr als die Hälfte (54%).19
2.2. Welche Probleme entstanden durch die Perestrojka?
Doch warum waren besonders die Menschen in Russland so negativ gegenüber dem neuen Regierungs- und Wirtschaftssystem eingestellt? Die Gründe hierfür sind vielfältig. Russland war vermutlich das einzige Land des Ostblocks, das immer an den Erfolg des Sozialismus und der Sowjetunion geglaubt und sich darauf verlassen hatte. Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Folgen der Perestrojka und den Problemen, die Russland bis heute nicht ganz überwunden hat.
2.2.1. Soziale Desorientierung und die Glaubwürdigkeitskrise der Politik
Nach fast 70 Jahren Sowjetunion hatten sich die Menschen an den Sozialismus und seine Regierungsweise gewöhnt. Sie taten sich nun schwer damit „ erwachsen, selbstÄndig und sozial unabhÄngig zu werden. “20 Das Gefühl von Individualität und Autonomie war ihnen, die bisher alles vom Staat vorgeschrieben bekommen hatten, neu. Dies führte besonders im Zusammenleben der Generationen zu Problemen. Die Jugendlichen wuchsen mit der neuen Lebensweise auf und reagierten häufig mit Unduldsamkeit und Ungeduld auf das Festhalten der Älteren an traditionellen Werten.21 Diese gesellschaftliche Verunsicherung, besonders bei den älteren Menschen, darf keinesfalls überraschen. Der „ komplette Austausch eines Gesellschaftssystems “22 führt fast zwangsläufig zu einer gewissen „ sozialen Desorientierung und Ambivalenz. “23 Das große Problem in Russland bestand vielmehr darin, dass diese großen Veränderungen in einer sehr konservativen Gesellschaft geschahen und die neue Staatsführung es verpasste die Menschen von der neuen Gesellschaftsform zu überzeugen.24 Es darf nicht vergessen werden, dass es in Russland keine „ gefestigte demokratische politische Kultur “25 gab, d.h. die Menschen wurden mit einer völlig neuen und von Grund auf andern Gesellschaftsform konfrontiert und erhielten keine Unterstützung bei der Orientierung. Es kann allerdings bezweifelt werden, dass die neue Staatsspitze überhaupt in der Lage gewesen wäre, ihre Bürger bei der Neuorientierung zu helfen, denn die soziale Desorientierung und Unsicherheit im Umgang mit der ‚neugewonnenen Freiheit’ wurde verstärkt durch die Glaubwürdigkeitskrise der Politik. Mit dem Niedergang der Sowjetunion verschwanden das Komitee für Staatssicherheit (KGB), der Parteiapparat der KPdSU und das Militär und damit scheinbar auch das Sicherheitsgefühl der Bürger,26 wie eine Umfrage der European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) aus diesem Jahr verdeutlicht. Hiernach fühlen sich die Bürger heutzutage weniger sicher als zu Zeiten der UdSSR. Waren es vor dem Zerfall der Sowjetunion noch über 70%, sind es heute gerade noch knapp über 30%.27 Dies dürfte vor allem auf die instabile Regierung unter einem schwachen Präsidenten Boris Jelzin zurückzuführen sein. Hinzu kamen Streitigkeiten und Machtkämpfe innerhalb der Regierung und der Parteien.28
2.2.2. Die Wirtschaftskrise und die materielle Armut
Auch wenn die Sowjetbürger im Jahre 1991 bei der Frage nach positiven Veränderungen hauptsächlich die „ Volle[n] Regale [ … ], stabile[n] Preise [ … ] und die MÖglichkeit, <<soviel wie nÖtig zu verdienen>> “29 nannten, brachte die Perestrojka eine der größten Wirtschaftskrise der Welt mit sich. Die schon lange beobachtete Verlangsamung des Wirtschaftswachstums ging mit dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums komplett in Stagnation und Leistungsrückgang über. Neben den seit der Breschnew-Zeit nicht überwundenen Fehlentwicklungen wie Rückgang des Wirtschaftswachstums, Stagnation in der Produktivität, mangelnde Produktqualität und kaum technischer Fortschritt brachte die Perestrojka weitere neue Probleme mit sich.
Versorgungsengpässe, anwachsende Probleme im Sozialwesen, zunehmende Kriminalisierung der Wirtschaft sowie der Verfall der Währung ließen die Verarmung schnell fortschreiten, wie eine Statistik der Weltbank zeigt. Hiernach stieg die Zahl der armen Haushalte30 von 25,2% im Jahr 1992 auf 35,0% im Jahr 1995. Bei den sehr armen Haushalten war der Anstieg noch extremer. So lebten im Jahr 1992 8,4% der Haushalte mit Weniger als der Hälfte des Existenzminimums, im Jahr darauf waren es bereits 12,0%.31 Hinzu kam eine schnell steigende Arbeitslosigkeit, die ihren Ursprung in der sozialistischen Schwerindustrie hatte. Diese war nicht einmal annähernd auf dem neuesten technischen Stand und in keiner Weise auf dem internationalen Markt konkurrenzfähig.
[...]
1 http://www.russlandanalysen.de/content/media/Russlandanalysen105.pdf, S. 7.
2 http://www.dgo-online.org/fileadmin/Laenderanalysen/Russland/2007/russlandanalysen134-07.pdf, S. 15.
3 Vgl. Nohlen, Lexikon der Politik, S. 368-369, Macków, Der Wandel des kommunistischen Totalitarismus, S. 1358.
4 Vgl. Meissner, Die Sowjetunion im Umbruch, S. 212-214.
5 Vgl. Ebd.
6 Vgl. Beyme, Systemwechsel in Osteuropa, S. 333.
7 Meissner, Sowjetunion, S. 239.
8 Vgl. Ders., S. 240.
9 Vgl. Ders., S. 245.
10 Ebd.
11 Vgl. Ders., S. 248-249.
12 Merkel, Systemtransformation, S. 397.
13 Vgl. Ebd.
14 Solidarnosc ist eine polnische Gewerkschaft, die im Jahr 1980 aus einer Protestbewegung heraus entstand und entscheidend am Zusammenbruch des Systems beteiligt war.
15 Vgl. Beyme, Systemwechsel, S. 53-54, Merkel, Systemtransformation, S. 398.
16 Vgl. Kapitel 2.1.1.
17 Vgl. Beyme, Systemwechsel, S. 333.
18 Vgl. Ebd.
19 Vgl. Ders., S. 335.
20 Melzer, Osteuropäische Jugend im Wandel, S. 33.
21 Vgl. Ebd., S. 33, Beichelt-Minkenberg, Rechtsradikalismus in Transformationsgesellschaften, S. 248.
22 Beichelt-Minkenberg, Rechtsradikalismus, S. 251.
23 Ebd., S. 251.
24 Vgl. Melzer, Osteuropäische Jugend, S. 33.
25 Beichelt-Minkenberg, Rechtsradikalismus, S. 251.
26 Vgl. Ramet, The Radical Right in Central and Eastern Europe since 1989, S. 262-263.
27 http://www.ebrd.com/pubs/econo/lits.pdf, Chart 8.
28 Vgl. Ramet, The Radical Right, S. 257, 263.
29 Dietz - Sörgel, Mehr Sorgen als Hoffnungen, S. 234.
30 Haushalte, deren Einkommen unterhalb des Existenzminimums liegt.
31 http://www.worldbank.org/research/journals/wbro/obsfeb98/pdf/article3.pdf, Table 3.
Häufig gestellte Fragen
Warum nahm der Rechtsextremismus in Russland nach der Perestrojka zu?
Gründe waren soziale Desorientierung, die Wirtschaftskrise, materielle Armut und die Glaubwürdigkeitskrise der Politik nach dem Zerfall der Sowjetunion.
Was bedeutet "postkommunistische Systemtransformation"?
Es beschreibt den Wechsel von einem nicht-demokratischen System mit Planwirtschaft zu einer Demokratie mit Marktwirtschaft in ehemaligen sozialistischen Staaten.
Welche Rolle spielten Gorbatschows Reformen?
Gorbatschows Ziele (Perestrojka und Glasnost) führten ungewollt zum Zusammenbruch der UdSSR, was bei vielen Russen zu einem Gefühl des imperialen Verlustes führte.
Wer sind die Opfer von rechtsextremer Gewalt in Russland?
Opfer sind meist Migranten aus ehemaligen Sowjetrepubliken, Schwarzafrikaner und Menschen mit kaukasischem Aussehen.
Warum hat Demokratie in Russland einen schweren Stand?
Die Gleichzeitigkeit von ökonomischem und politischem Umbruch überforderte viele Bürger, was zu einer Sehnsucht nach nationaler Stärke und autoritären Strukturen führte.
- Arbeit zitieren
- Danielle Klußmann (Autor:in), 2007, Welche durch die Perestrojka entstandenen Schwierigkeiten förderten den Rechtsextremismus in Russland?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198052