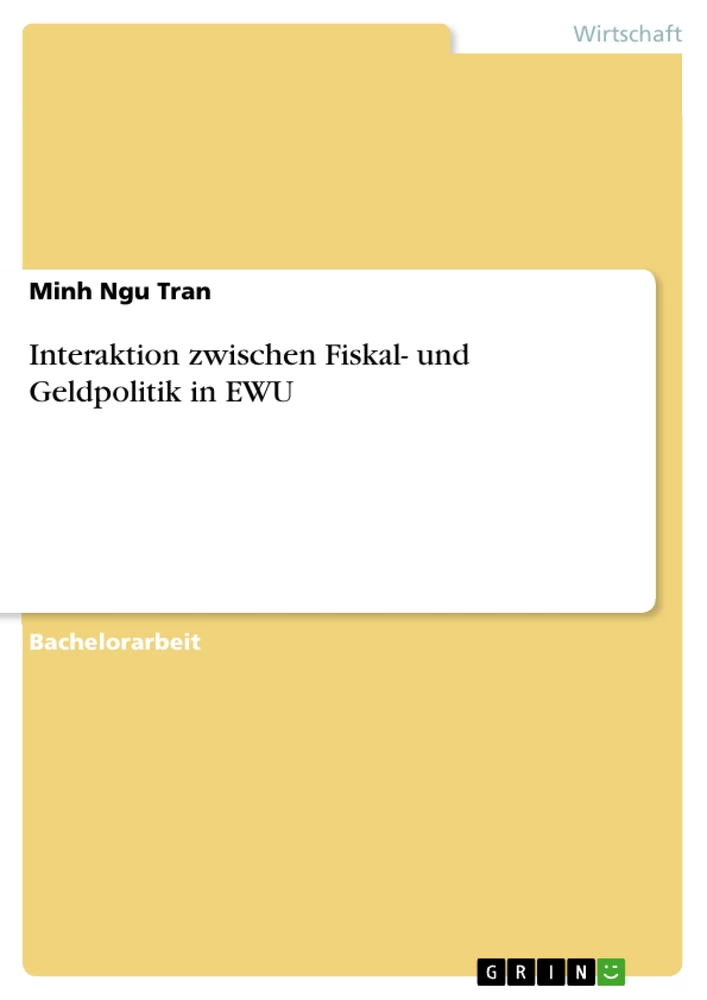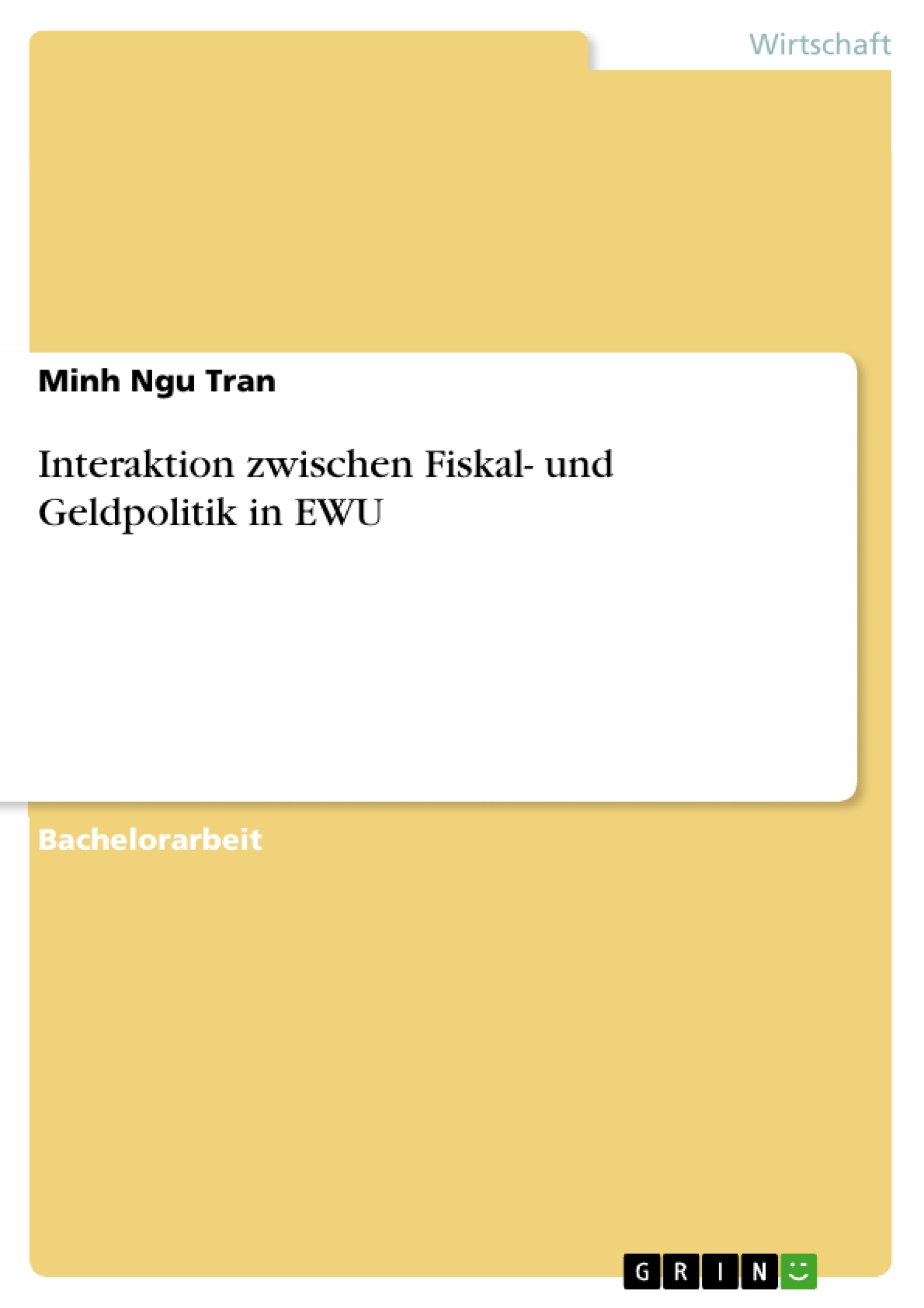1.1 Problemstellung
Ab 1.1.1999 begann die dritte Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion mit der Umsetzung eines einheitlichen Währungssystems in Europa. Dabei wurden die verschiedenen Währungen der Mitgliedstaaten in einer einzigen Währung umgestellt, und wird die Europäische Zentralbank auch gegründet, um die einheitliche Geldpolitik in EWU durchzuführen. Im Gegensatz dazu blieb die nationale Fiskalpolitik noch in den Staaten, die für Regulierung des nationalen Outputs verantwortlich sind. Weil die Europäische Währungsunion voll integriert ist, kann irgend Spillover von einem Staat anderen Staaten sogar ganze Union beeinflussen. Um daher eine expansive extreme Fiskalpolitik von einem Mitgliedstaat zu verhindern sowie die Stabilität der Union zu gewährleisten, ist der SGP 1997 in Kraft getreten. Dadurch darf das jährliche Haushaltdefizit 3% des Bruttoinlandsproduktes nicht überschreiten oder muss die Staatsschuld weniger als 60% des Bruttoinlandsproduktes sein. Jedoch ist in der Praxis der Überwachungs- und Sanktionsmechanismus von SGP nicht erfolgreich. Denn es gibt immer mehr Länder, die bereit sind, diese Grenze für das Haushaltsdefizit zu überschreiten. Dabei wird die Regel für die Staatsschuld von SGP nicht richtig eingehalten, was zur ernsten Staatsverschuldung führt, die gerade der Zukunft der EWU droht. Bei der EWU mit einer einheitlichen Geldpolitik und differenzierten Fiskalpolitiken besteht in der Tat immer ein Konflikt zwischen den nationalen und gemeinsamen Interessen. Um daher dieses Problem zu lösen, wird eine Frage hier gestellt, ob die Koordination zwischen den nationalen Fiskalpolitiken und der einheitlichen Geldpolitik nötig sei, und welcher Form der Koordination die angemessen ist. Im Kern dieser Arbeit wird dieses Problem untersucht, wobei die unterschieden Regime der Koordination der Geld- und Fiskalpolitiken präsentiert und ihre Ergebnisse miteinander verglichen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Gang der Untersuchung
- 2. Die Geld- und Fiskalpolitik in EWU
- 2.1 Gestaltung der Geld- und Fiskalpolitik in der EWU
- 2.2 Koordination der makroökonomischen Politiken
- 3 Interaktion zwischen Geld- und Fiskalpolitik im Modell der EWU in der kurzfristigen Perspektive
- 3.1 Gestaltung des Modells der EWU
- 3.2 Das dynamische System im Modell der EWU
- 3.3 Die Spieltheorie
- 3.4 Das infinite horizontale lineare quadratische Steuerungsproblem
- 3.5 Die Regime der Koordination der Geld- und Fiskalpolitik
- 3.5.1 Das non-kooperative Regime
- 3.5.2 Das vollkommende kooperative Regime
- 3.5.3 Das anteilige kooperative Regime
- 3.5.4 Die symmetrischen Ergebnisse
- 3.5.5 Simulation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Interaktion zwischen Fiskal- und Geldpolitik in der Europäischen Währungsunion (EWU). Die zentrale Fragestellung ist, ob und in welcher Form eine Koordination zwischen den nationalen Fiskalpolitiken und der einheitlichen Geldpolitik notwendig ist. Die Arbeit analysiert verschiedene Koordinationsregime und vergleicht deren Ergebnisse.
- Gestaltung der Geld- und Fiskalpolitik in der EWU
- Koordination makroökonomischer Politiken in der EWU
- Modellierung der Interaktion von Geld- und Fiskalpolitik mittels Spieltheorie
- Analyse verschiedener Kooperationsregime (non-kooperativ, vollkooperativ, anteilig kooperativ)
- Simulation der Ergebnisse und Vergleich der verschiedenen Regime
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Problemstellung ein. Es beschreibt die Entstehung der EWU und den Konflikt zwischen einheitlicher Geldpolitik und differenzierten Fiskalpolitiken. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt (SGP) wird als Versuch zur Vermeidung expansiver Fiskalpolitiken vorgestellt, dessen Wirksamkeit jedoch kritisch hinterfragt wird. Die zentrale Forschungsfrage nach der Notwendigkeit und der optimalen Form der Koordination von Fiskal- und Geldpolitik wird formuliert. Der Aufbau der Arbeit wird skizziert.
2. Die Geld- und Fiskalpolitik in EWU: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Geld- und Fiskalpolitik innerhalb der EWU. Es beschreibt die Gestaltung der Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank (EZB), deren primäres Ziel die Preisstabilität ist, und die Rolle des EZB-Rats. Die nationale Verantwortung für die Fiskalpolitik wird erläutert, ebenso wie die Beschränkungen durch den Maastricht-Vertrag und den SGP. Die Notwendigkeit der Koordination makroökonomischer Politiken aufgrund von Spillover-Effekten wird begründet. Verschiedene Arten der Koordination werden angesprochen, einschließlich der fiskalpolitischen Koordination und der geld- und fiskalpolitischen Koordination auf aggregierter EMU-Ebene.
3 Interaktion zwischen Geld- und Fiskalpolitik im Modell der EWU in der kurzfristigen Perspektive: Das Kapitel beschreibt das in der Arbeit verwendete Modell der EWU mit zwei symmetrischen Ländern und einer EZB. Es erläutert die Annahmen des Modells, wie beispielsweise die volle Kapitalmarktintegration und die eingeschränkte Arbeitsmobilität. Das Kapitel entwickelt ein dynamisches System zur Beschreibung der Interaktion der Politiken basierend auf der Spieltheorie. Es werden die Kostenfunktionen der beteiligten Akteure (Staaten und EZB) definiert. Das infinite horizontale lineare quadratische Steuerungsproblem wird als methodischer Ansatz zur Minimierung der Kostenfunktionen eingeführt.
Schlüsselwörter
Europäische Währungsunion (EWU), Geldpolitik, Fiskalpolitik, Koordination, Spieltheorie, dynamisches System, Stabilitäts- und Wachstumspakt (SGP), lineare quadratische Steuerung, Kooperation, Nash-Gleichgewicht, Pareto-Effizienz, Simulation.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Interaktion zwischen Geld- und Fiskalpolitik in der EWU
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Interaktion zwischen Fiskal- und Geldpolitik in der Europäischen Währungsunion (EWU) und die Frage, ob und wie eine Koordination dieser Politiken notwendig ist. Sie analysiert verschiedene Koordinationsregime und vergleicht deren Ergebnisse mithilfe eines dynamischen Modells und spieltheoretischer Ansätze.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Gestaltung der Geld- und Fiskalpolitik in der EWU, die Koordination makroökonomischer Politiken, die Modellierung der Interaktion von Geld- und Fiskalpolitik mittels Spieltheorie, die Analyse verschiedener Kooperationsregime (non-kooperativ, vollkooperativ, anteilig kooperativ), die Simulation der Ergebnisse und den Vergleich der verschiedenen Regime. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt (SGP) wird kritisch beleuchtet.
Welches Modell wird verwendet?
Die Arbeit verwendet ein dynamisches Modell der EWU mit zwei symmetrischen Ländern und einer EZB. Das Modell berücksichtigt die volle Kapitalmarktintegration und die eingeschränkte Arbeitsmobilität. Die Interaktion der Politiken wird mithilfe der Spieltheorie beschrieben, und das infinite horizontale lineare quadratische Steuerungsproblem dient als methodischer Ansatz zur Minimierung der Kostenfunktionen der beteiligten Akteure.
Welche Kooperationsregime werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht drei Kooperationsregime: ein non-kooperatives Regime, ein vollkommen kooperatives Regime und ein anteilig kooperatives Regime. Die Ergebnisse dieser Regime werden simuliert und verglichen.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet spieltheoretische Ansätze, ein dynamisches System zur Modellierung der Interaktion von Geld- und Fiskalpolitik, und das infinite horizontale lineare quadratische Steuerungsproblem zur Optimierung der Politiken. Simulationen werden eingesetzt, um die Ergebnisse der verschiedenen Kooperationsregime zu vergleichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Europäische Währungsunion (EWU), Geldpolitik, Fiskalpolitik, Koordination, Spieltheorie, dynamisches System, Stabilitäts- und Wachstumspakt (SGP), lineare quadratische Steuerung, Kooperation, Nash-Gleichgewicht, Pareto-Effizienz, Simulation.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, die die Problemstellung und den Aufbau der Arbeit beschreibt. Es folgt ein Kapitel über die Geld- und Fiskalpolitik in der EWU, und ein zentrales Kapitel, das das Modell, die Methodik und die Ergebnisse der Analyse der verschiedenen Kooperationsregime präsentiert. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse.
- Citation du texte
- Minh Ngu Tran (Auteur), 2011, Interaktion zwischen Fiskal- und Geldpolitik in EWU, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198146