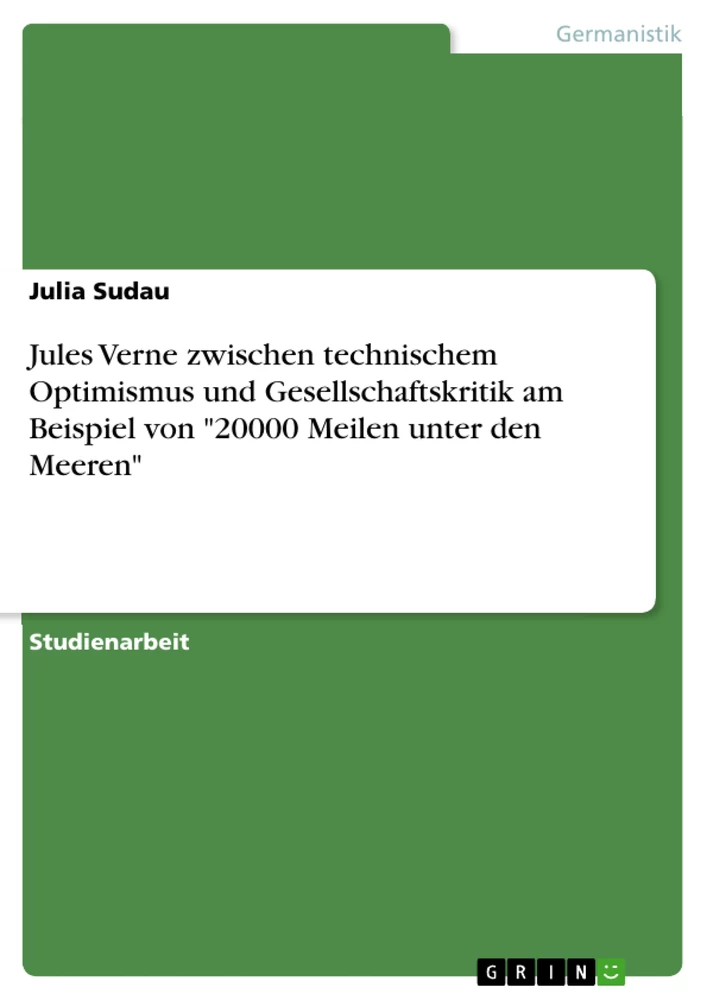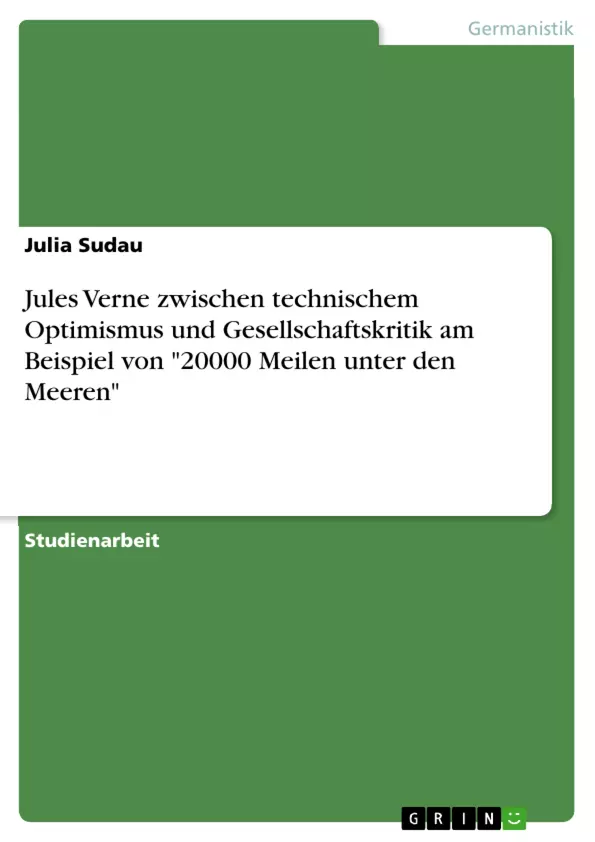Einleitung
Jules Verne kann unbestritten als ein klassischer und wohl auch einer der bekanntesten Vertreter der frühen Science-Fiction Literatur bezeichnet werden. Auch wenn sich seine Romane allgemein gefasst dem Genre der Abenteuerromane zuordnen lassen, so spielen doch in einigen von seinen Werken faszinierende technologische Innovationen, welche zum größten Teil der Fantasie des Autors entspringen, eine maßgebliche Rolle. Meist sind diese technischen Errungenschaften weniger als Schreckgespenster, sondern als bewundernswerte und von einem genialen Geist ihres Erschaffers zeugende Wunderwerke, welche innerhalb der Handlung eine faszinierende Wirkung auf die übrigen Charaktere ausüben. Diese Wirkung vollzog sich sowohl bei vielen Lesern zu Jules Vernes Zeit als auch noch bei der heutigen Leserschaft. 20000 Meilen unter den Meeren aus dem Jahre 1871 ist eines der bekanntesten Werke Jules Vernes, auf welche die vorangegangene Beschreibung zutrifft. Im Zentrum der Geschichte steht ein äußerst intelligenter, gebildeter aber auch zynischer und brutaler Mann, welcher ausschließlich das Innere seines U-Bootes mit dem Namen NAUTILUS sein Zuhause und die Weltmeere seine Heimat nennt. Das Besondere an diesem Roman sind die entstehenden Spannungsverhältnisse. So besteht ein Kontrast zwischen utopischen Technikinnovationen und Kritik an der Gesellschaft. Dabei ist es doch die Zivilisation, welche hinter der Entstehung und dem Fortschritt der modernen Technik steht und eben diese auch als Mittel der Zerstörung und Unterdrückung missbraucht. Beide Aspekte sind im Charakter des KAPITÄN NEMO zu finden. Des Weiteren treffen im Roman die Welt der Technik und die Welt der Natur aufeinander, wobei es keiner von beiden an ästhetischer Beschreibung mangelt. Nun ist die Frage, ob Jules Verne in diesem Roman einer bestimmten Richtung den Vorrang einräumt, der des technischen Optimismus und Fortschrittglaubens oder der der besinnten Bescheidenheit gegenüber Mensch und Natur.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
I. Naturwissenschaft und Technik im Roman
1.Jules Vernes Begeisterung für Technik und die Anfänge des Science-Fiction Genres
2.Ästhetik von Natur und Technik - Ein Widerspruch?
II. Figuren im Zwiespalt
1. Kapitän Nemo zwischen Gut und Böse
2. Professor Aronnax und seine Funktion als Medium zwischen zwei Polen
III. Utopische und Dystopische Züge des Werks
IV. Fazit
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Technik in Jules Vernes Roman?
Die Technik, verkörpert durch das U-Boot NAUTILUS, wird als bewundernswertes Wunderwerk dargestellt, das den Fortschrittsglauben der Zeit widerspiegelt.
Wer ist Kapitän Nemo als Charakter?
Nemo ist ein hochintelligenter, aber zynischer Mann, der im Zwiespalt zwischen Genie und Brutalität steht und die Zivilisation ablehnt.
Gibt es in "20000 Meilen unter den Meeren" Kritik an der Gesellschaft?
Ja, der Roman kontrastiert utopischen technischen Fortschritt mit der Kritik an einer Zivilisation, die Technik für Zerstörung und Unterdrückung missbraucht.
Welche Funktion hat Professor Aronnax im Buch?
Aronnax dient als Medium zwischen den Polen, der die faszinierende Unterwasserwelt und die Technik wissenschaftlich beobachtet und bewertet.
Ist der Roman eher utopisch oder dystopisch?
Er enthält beide Züge: Die Utopie der technischen Möglichkeiten und die Dystopie der menschlichen Natur und deren Missbrauch der Macht.
- Quote paper
- Julia Sudau (Author), 2011, Jules Verne zwischen technischem Optimismus und Gesellschaftskritik am Beispiel von "20000 Meilen unter den Meeren", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198158