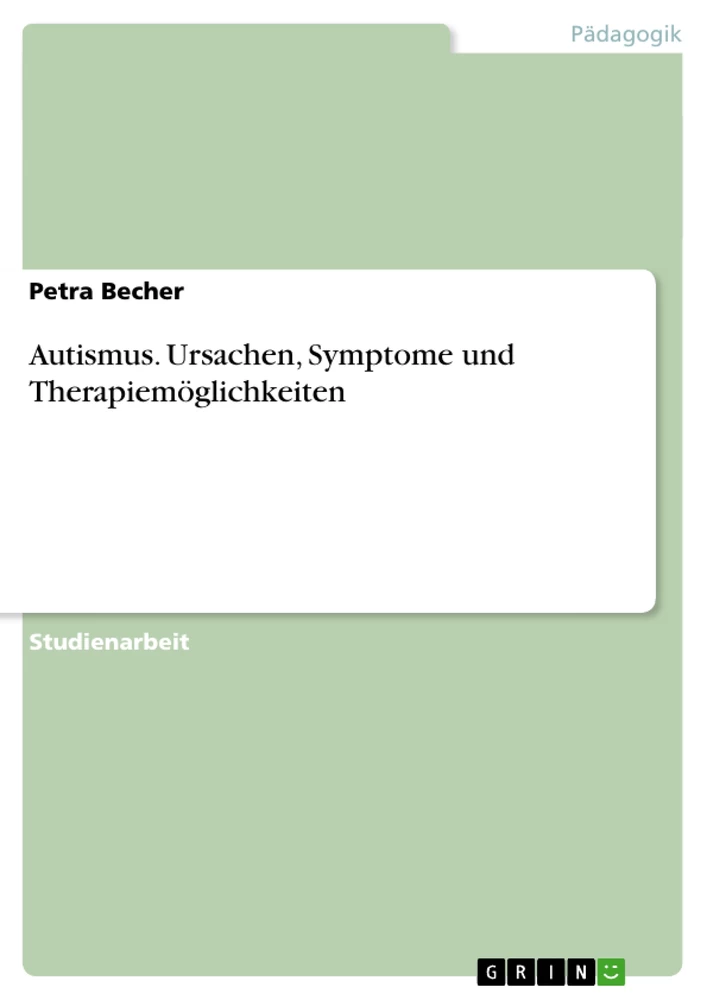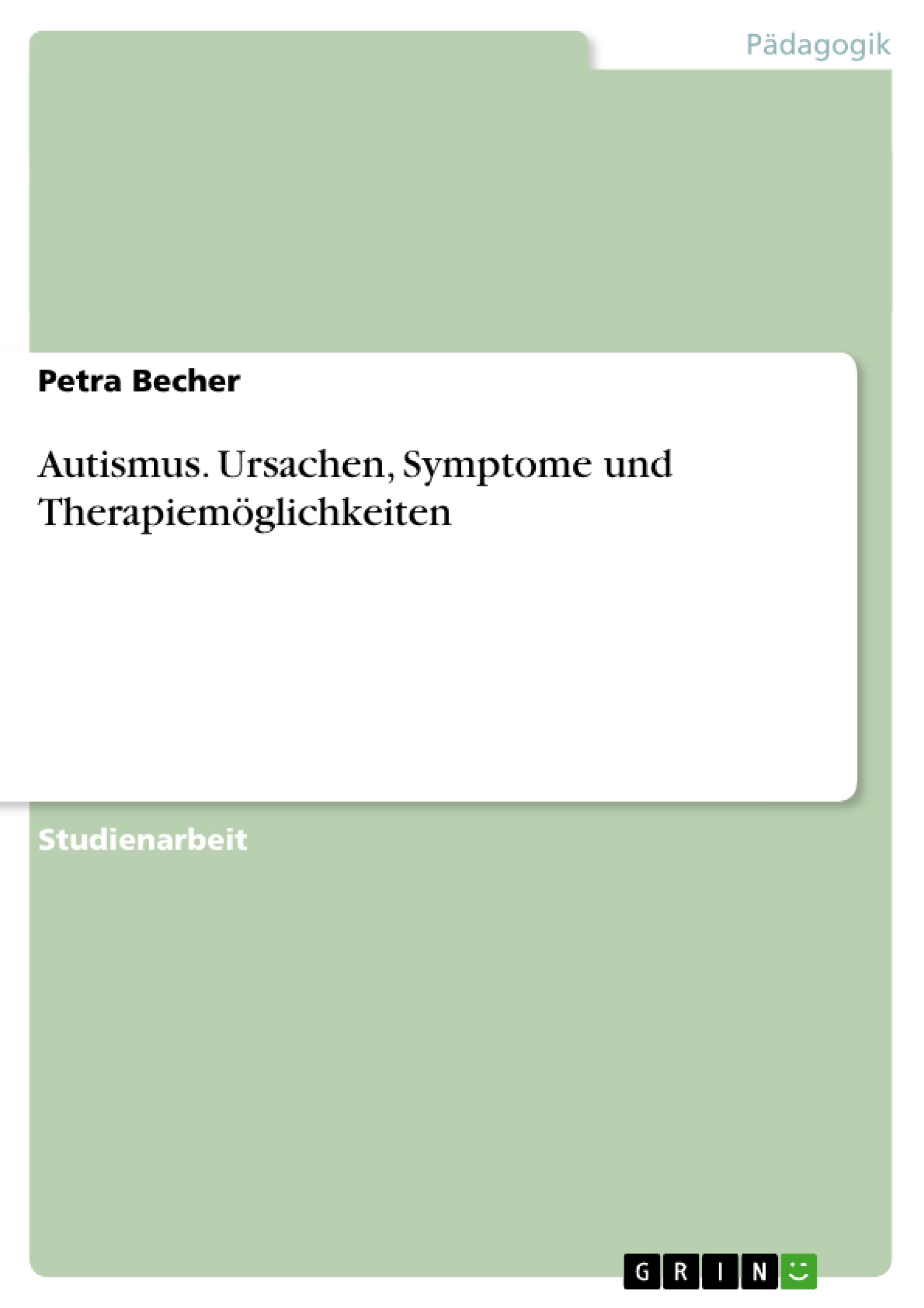Die Wortschöpfung Autismus geht auf den Schweizer Psychologen Eugen Bleuler zurück, der 1911 die Begriffe „autistisch“ und „Autismus“ prägte. Autismus kommt vom griechischen Wort „autos“ und bedeutet „selbst“. Das heißt dieses Krankheitsbild kann als ein in sich gekehrt sein und ein auf sich selbst bezogenes Denken definiert werden. (vgl. www.autismus/def/htm.de.) Folgende Beschreibung wird in der internationalen Klassifikation der Erkrankungen aufgeführt:
Eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, die durch eine abnorme oder beeinträchtigte Entwicklung definiert ist und sich vor dem 3. Lebensjahr manifestiert. Außerdem
ist sie durch eine gestörte Funktionsfähigkeit in den drei folgenden Bereichen charakterisiert: in der sozialen Interaktion, der Kommunikation und in eingeschränktem
repetitivem Verhalten. Die Störung tritt bei Jungen drei- bis viermal häufiger auf als bei Mädchen.
Im Weiteren sind bei autistischen Kindern oft „Intelligenzdefizite“ beobachtbar, die unabhängig von den autistischen Verhaltensstörungen zu sein scheinen. Das bedeutet, dass neben der autismusspezifischen Behinderung häufig auch eine geistige Behinderung besteht.
Unabhängig vom Intelligenzniveau findet man bei autistischen Kindern die sogenannten autismusspezifischen Störungen der Sprach- und Sozialentwicklung. Diese Störungsanteile werden wiederum auf die tiefgreifende Entwicklungsstörung zurückgeführt, bei der es sich um eine schwere qualitative Abweichung vom normalen Entwicklungsverlauf handelt, die in keinem Entwicklungsstadium normal ist.
Das eigentliche Merkmal der autistischen Störungen ist die qualitative Verformung der Entwicklung, die sowohl das Sozialverhalten, die verbale und nonverbale Kommunikation als auch das vorstellungsmäßige Denken betrifft. Die entwicklungspsychologische Sichtweise ermöglicht es, das gestörte Verhalten autistischer Kinder als Ausdruck der Entwicklungsveränderung zu erklären, auf Grund derer die eingeschränkten und stereotypen Verhaltensweisen als qualitativ anders und nicht bloß als „sinnlos“ betrachtet werden. (vgl. www.autismus/def/htm.de.)
Inhaltsverzeichnis
- Definition
- Was ist Autismus?
- Früherkennung
- Frühförderung
- Abgrenzung von anderen Störungen
- Ursachen
- Psychologische Aspekte
- Biologische Ursachen
- Häufigkeit
- Gegenüberstellung des Kanner-Syndroms dem Asperger-Syndrom
- Das Kanner-Syndrom
- Das Wesen
- Beschreibung
- Das Asperger-Syndrom
- Die Unterscheidung
- Verhaltensstörungen
- Verhalten im 1. Lebensjahr
- Abnormitäten in Gefühlen und Stimmungen
- Fähigkeiten
- Sprechen und Sprache
- Sprachentwicklung
- Sensorische Funktionen
- Sequentielle und rhythmische Fähigkeiten
- Besondere Begabungen
- Entwicklung autistischer Jugendlicher und Erwachsener
- Therapiemöglichkeiten
- Geeignete und zuständige Therapeuten
- Basistherapie
- Festhaltetherapie
- Mutter-und-Kind-Haltetherapie nach WELCH
- Theoretische Hintergründe
- Methode
- Anspruch auf Heilung
- Musiktherapie
- Medikamentöse Therapie
- Für die Schule
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Thema Autismus und soll ein umfassendes Verständnis dieser tiefgreifenden Entwicklungsstörung vermitteln. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte von Autismus, von der Definition und den Ursachen bis hin zu den Verhaltensstörungen, Fähigkeiten und Therapiemöglichkeiten.
- Definition und Charakteristika von Autismus
- Ursachen und Entstehungsmechanismen von Autismus
- Verhaltensmerkmale und Fähigkeiten von autistischen Kindern und Erwachsenen
- Frühzeitige Erkennung und Förderung von Autismus
- Therapiemöglichkeiten und Behandlungsansätze für Autismus
Zusammenfassung der Kapitel
Definition
Die Arbeit beginnt mit der Definition des Begriffs „Autismus“ und erläutert seine historischen Wurzeln. Sie beschreibt die charakteristischen Merkmale der Störung und bezieht sich auf die internationale Klassifikation der Erkrankungen.
Früherkennung und Frühförderung
Dieses Kapitel befasst sich mit der Bedeutung der Früherkennung und Frühförderung bei Autismus. Es werden wichtige Hinweise gegeben, wie man Autismus erkennen kann und welche Maßnahmen frühzeitig ergriffen werden sollten.
Abgrenzung von anderen Störungen
Die Arbeit beleuchtet die Abgrenzung von Autismus zu anderen Entwicklungsstörungen und erläutert die Unterschiede in den Symptomen und der Diagnostik.
Ursachen
Dieses Kapitel untersucht verschiedene Ursachen von Autismus, sowohl aus psychologischer als auch aus biologischer Sicht. Es werden verschiedene Theorien und Forschungsergebnisse vorgestellt.
Häufigkeit
Die Arbeit geht auf die Häufigkeit von Autismus ein und zeigt auf, dass die Störung bei Jungen häufiger vorkommt als bei Mädchen.
Gegenüberstellung des Kanner-Syndroms dem Asperger-Syndrom
Dieses Kapitel vergleicht das Kanner-Syndrom und das Asperger-Syndrom, zwei Formen von Autismus, die sich in ihren Merkmalen und Ausprägungen unterscheiden.
Verhaltensstörungen
Die Arbeit beschreibt verschiedene Verhaltensstörungen, die bei autistischen Kindern und Erwachsenen auftreten können. Sie beleuchtet die Besonderheiten im Verhalten im ersten Lebensjahr und im Bereich von Gefühlen und Stimmungen.
Fähigkeiten
Dieses Kapitel untersucht verschiedene Fähigkeiten, die bei autistischen Menschen vorhanden sein können, wie z.B. im Bereich der Sprache, der sensorischen Funktionen, der sequentiellen und rhythmischen Fähigkeiten. Es wird auch auf besondere Begabungen hingewiesen.
Schlüsselwörter
Autismus, tiefgreifende Entwicklungsstörung, Frühförderung, Kanner-Syndrom, Asperger-Syndrom, Verhaltensstörungen, Fähigkeiten, Therapiemöglichkeiten, Mutter-und-Kind-Haltetherapie, Musiktherapie, Medikamentöse Therapie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Definition von Autismus?
Autismus ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, die durch Beeinträchtigungen in der sozialen Interaktion, der Kommunikation und durch repetitive Verhaltensweisen gekennzeichnet ist.
Was unterscheidet das Kanner-Syndrom vom Asperger-Syndrom?
Das Kanner-Syndrom (frühkindlicher Autismus) äußert sich oft früher und geht häufig mit Sprachentwicklungsverzögerungen einher, während das Asperger-Syndrom meist keine Intelligenzminderung oder Sprachverzögerung zeigt.
Welche Ursachen für Autismus werden diskutiert?
Man unterscheidet zwischen biologischen Ursachen (genetische Faktoren, Hirnentwicklung) und psychologischen Aspekten, wobei heute die biologische Komponente im Vordergrund steht.
Was ist die Mutter-und-Kind-Haltetherapie nach Welch?
Es ist eine Therapiemethode (Festhaltetherapie), die darauf abzielt, die emotionale Bindung zwischen Mutter und Kind durch physisches Halten zu stärken, um autistische Barrieren zu durchbrechen.
Ab wann manifestiert sich Autismus in der Regel?
Die Symptome einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung manifestieren sich üblicherweise vor dem dritten Lebensjahr.
Haben alle autistischen Menschen Intelligenzdefizite?
Nein. Während bei einigen Formen eine geistige Behinderung vorliegen kann, gibt es viele Autisten mit normaler oder sogar überdurchschnittlicher Intelligenz (Inselbegabungen).
- Citar trabajo
- Petra Becher (Autor), 2001, Autismus. Ursachen, Symptome und Therapiemöglichkeiten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19815