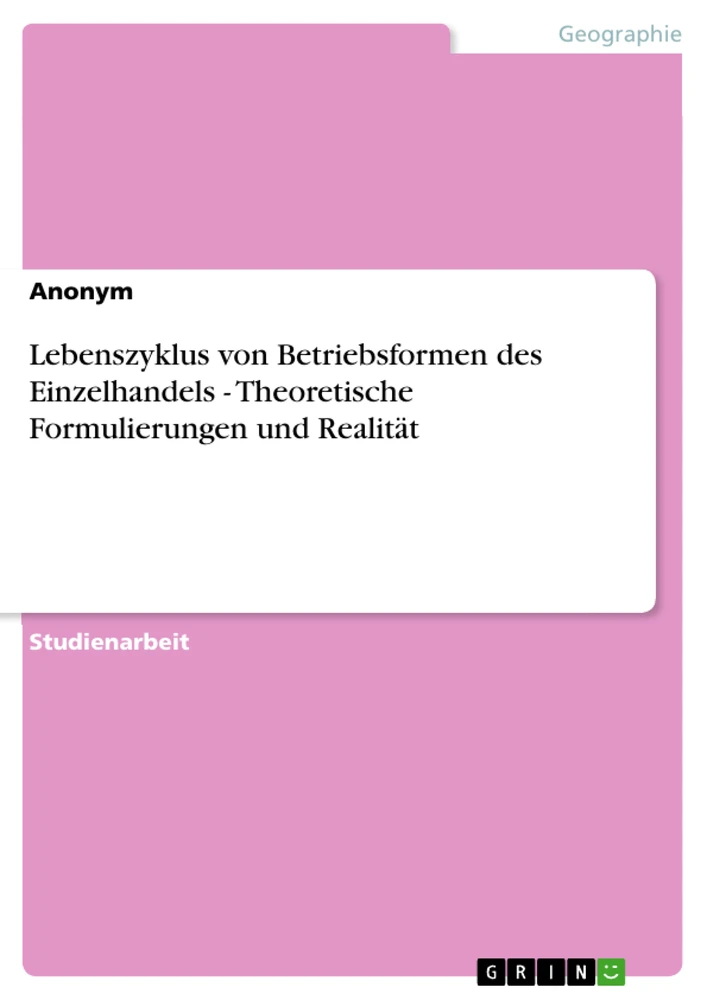Der Einzelhandel spielt in Deutschland eine bedeutende Rolle. Da er sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert hat, stellt sich die Frage, ob die Veränderungen des Einzelhandels gewisse Regelmäßigkeiten aufweisen, die es möglich machen, Entwicklungen für die Zukunft vorhersagen zu können.
Unter dem Schlagwort ‚Wandel im Handel‘ (vgl. u.a. Heinritz 1989: 15) wurden in den zurückliegenden Jahren eine Vielzahl von wirtschaftsgeographischen und betriebswirtschaftlichen Analysen und Theorien zu diesem Thema verfasst. Dabei handelt es sich um den Versuch, den existierenden Betriebsformenwandel nach gewissen Gesetzen ordnen zu können, um die historischen Veränderungen zu verstehen und zukünftige Entwicklungen prognostizieren zu können. Eine dieser Theorien ist die sog. Lebenszyklushypothese von Betriebsformen, die in dieser Arbeit analysiert und bewertet werden soll.
Im ersten Teil der Arbeit wird die Bedeutung des Einzelhandles für die deutsche Wirtschaft herausgestellt, damit die Relevanz von Modellen und Theorien zur Entwicklung und zu Prognosen möglicher Veränderungen deutlich wird. Im Anschluss daran soll die Theorie des Lebenszyklus von Betriebsformen zunächst theoretisch erläutert werden.
Im zweiten Teil wird dargestellt, wie sich der Betriebsformenwandel in Deutschland seit 1945 vollzogen hat. Diese Darstellung der realen Einzelhandelsstrukturen und deren Veränderungen ist notwendig, um im dritten Teil die Theorie der Lebenszyklushypothese an der Realität messen zu können. Schlussendlich soll die Frage beantwortet werden, ob die Lebenszyklushypothese den Betriebsformenwandel im Einzelhandel in Deutschland ausreichend darstellen und erläutern kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Formulierungen
- Der Begriff des Einzelhandels
- Betriebsformen und Betriebsformenwandel
- Die Lebenszyklushypothese
- Betriebsformenwandel in der Realität
- Beeinflussende Faktoren des Einzelhandels
- Vollzogener Betriebsformenwandel in Deutschland
- Tante-Emma-Läden und die ersten SB-Läden
- Kauf- und Warenhäuser
- Der Einzelhandel auf der ‚Grünen Wiese‘
- Die Discounter
- Fachgeschäft und Fachmarkt
- Versand- und Onlinehandel
- Die aktuelle und zukünftige Situation des Einzelhandels
- Schlussbetrachtung: Kann die Lebenszyklushypothese den Betriebsformenwandel erklären?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Wandel von Betriebsformen im deutschen Einzelhandel seit 1945. Ziel ist es, die Lebenszyklushypothese als Erklärungsmodell für diesen Wandel zu analysieren und zu bewerten. Die Arbeit beleuchtet sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die reale Entwicklung verschiedener Betriebsformen.
- Der Begriff des Einzelhandels und seine Bedeutung für die deutsche Wirtschaft
- Die Lebenszyklushypothese als Erklärungsmodell für den Betriebsformenwandel
- Die Entwicklung verschiedener Einzelhandelsbetriebe (z.B. Tante-Emma-Läden, SB-Läden, Kaufhäuser, Discounter, Fachmärkte, Onlinehandel)
- Einflussfaktoren auf den Betriebsformenwandel (Wettbewerb, Konsumverhalten, staatliche Regulierung)
- Die aktuelle Situation und zukünftige Entwicklungen im deutschen Einzelhandel
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Bedeutung des Einzelhandels für die deutsche Wirtschaft heraus und führt in die Thematik des Betriebsformenwandels und die Lebenszyklushypothese als Erklärungsmodell ein. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und die Forschungsfrage.
Theoretische Formulierungen: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie Einzelhandel, Betriebsform und Betriebsformenwandel. Es erläutert die Lebenszyklushypothese mit ihren Phasen (Entstehung, Aufstieg, Reife, Rückbildung) und diskutiert ihre Anwendbarkeit auf den Einzelhandel. Der Fokus liegt auf der theoretischen Fundierung der späteren empirischen Analyse.
Betriebsformenwandel in der Realität: Dieses Kapitel beschreibt den tatsächlichen Wandel der Betriebsformen im deutschen Einzelhandel seit 1945. Es analysiert die Entwicklung verschiedener Betriebsformen wie Tante-Emma-Läden, SB-Läden, Kaufhäuser, Discounter, Fachgeschäfte, Fachmärkte und den Onlinehandel. Der Einfluss von Faktoren wie Konsumverhalten, Wettbewerb und staatlicher Regulierung wird beleuchtet. Der Abschnitt bietet eine detaillierte Darstellung der historischen Entwicklung und der damit verbundenen Veränderungen.
Schlussbetrachtung: Kann die Lebenszyklushypothese den Betriebsformenwandel erklären?: Dieses Kapitel bewertet die Erklärungskraft der Lebenszyklushypothese im Hinblick auf die im vorherigen Kapitel beschriebenen realen Entwicklungen. Es diskutiert Stärken und Schwächen des Modells und zieht ein Fazit zur Anwendbarkeit der Hypothese auf den komplexen Prozess des Betriebsformenwandels.
Schlüsselwörter
Einzelhandel, Betriebsformenwandel, Lebenszyklushypothese, Discounter, Fachmarkt, Kaufhaus, Onlinehandel, Konsumverhalten, Wettbewerb, staatliche Regulierung, Wirtschaftsgeographie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Betriebsformenwandel im deutschen Einzelhandel
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Wandel von Betriebsformen im deutschen Einzelhandel seit 1945. Sie analysiert die Lebenszyklushypothese als Erklärungsmodell für diesen Wandel und beleuchtet sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die reale Entwicklung verschiedener Betriebsformen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Begriff des Einzelhandels, die Lebenszyklushypothese, die Entwicklung verschiedener Einzelhandelsbetriebe (z.B. Tante-Emma-Läden, SB-Läden, Kaufhäuser, Discounter, Fachmärkte, Onlinehandel), Einflussfaktoren auf den Betriebsformenwandel (Wettbewerb, Konsumverhalten, staatliche Regulierung), sowie die aktuelle Situation und zukünftige Entwicklungen im deutschen Einzelhandel.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Lebenszyklushypothese als Erklärungsmodell für den Betriebsformenwandel. Diese Hypothese wird ausführlich erläutert und auf ihre Anwendbarkeit im Kontext des deutschen Einzelhandels untersucht.
Welche Betriebsformen werden im Detail betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Entwicklung verschiedener Betriebsformen, darunter Tante-Emma-Läden, Selbstbedienungsläden (SB-Läden), Kaufhäuser, Discounter, Fachgeschäfte, Fachmärkte und den Onlinehandel. Für jede Betriebsform wird die historische Entwicklung und deren Einflussfaktoren beleuchtet.
Welche Einflussfaktoren auf den Betriebsformenwandel werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt Einflussfaktoren wie Wettbewerb, Konsumverhalten und staatliche Regulierung, um den Betriebsformenwandel umfassend zu erklären.
Wie wird die Lebenszyklushypothese bewertet?
Die Arbeit bewertet die Erklärungskraft der Lebenszyklushypothese anhand der realen Entwicklungen im deutschen Einzelhandel. Stärken und Schwächen des Modells werden diskutiert und ein Fazit zur Anwendbarkeit der Hypothese gezogen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel mit theoretischen Formulierungen (inkl. Definitionen und Erklärung der Lebenszyklushypothese), ein Kapitel zum Betriebsformenwandel in der Realität, eine Schlussbetrachtung zur Erklärungskraft der Lebenszyklushypothese und ein Fazit. Zusätzlich beinhaltet sie ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Einzelhandel, Betriebsformenwandel, Lebenszyklushypothese, Discounter, Fachmarkt, Kaufhaus, Onlinehandel, Konsumverhalten, Wettbewerb, staatliche Regulierung, Wirtschaftsgeographie.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Zielsetzung ist die Analyse und Bewertung der Lebenszyklushypothese als Erklärungsmodell für den Betriebsformenwandel im deutschen Einzelhandel seit 1945.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2011, Lebenszyklus von Betriebsformen des Einzelhandels - Theoretische Formulierungen und Realität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198193