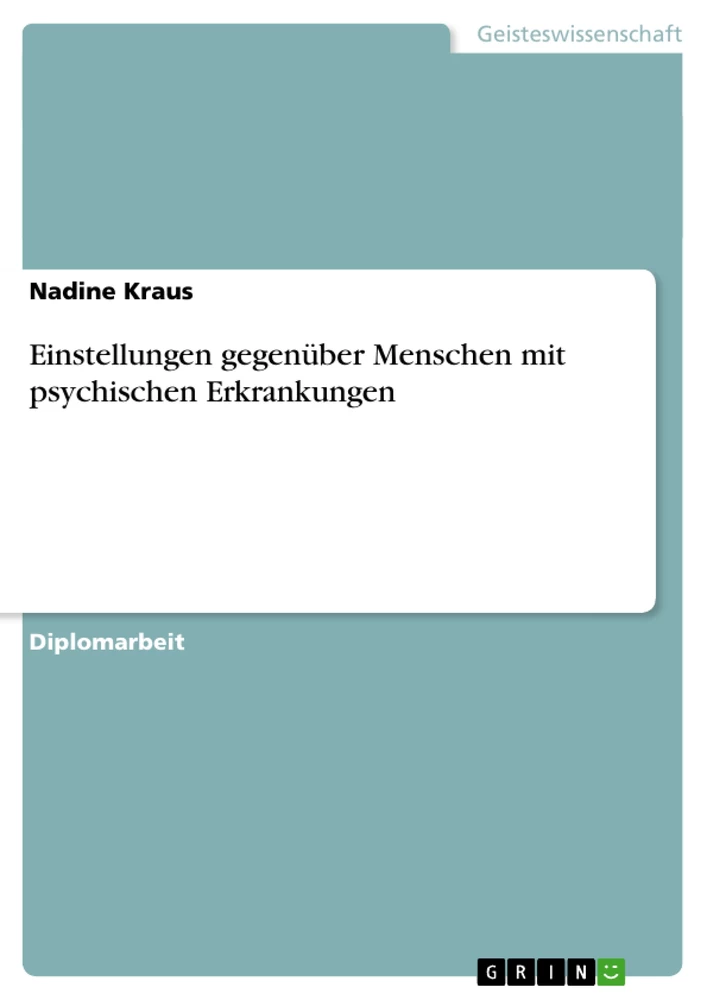VORWORT1
Diskriminierung und Stigmatisierung sind schmerzhafte Erfahrungen für Betroffene. Viele
Menschen müssen dies ihr ganzes Leben oder zumindest eine lange Zeit ertragen.
In der 9. Klasse der Realschule in Herten wurde ein Workshop, der sich „Blue-Eyed“
nennt, durchgeführt. Das Ziel des Workshops war den Rassismus gegenüber ausländischen
Mitbürgern einzudämmen. Die Schüler sollen am eigenen Leib erfahren, wie es sich
anfühlt diskriminiert zu werden, da dies oft wirksamer ist als tausend Worte. Die Idee
einen derartigen Workshop durchzuführen entstand aus der Hilflosigkeit einer Lehrerin
gegenüber dem Verhalten vieler Schüler. Diese beschimpften und diskriminierten verstärkt
türkische Bewohner mit Sprüchen wie: „Ich habe nichts gegen Ausländer, aber Türken
sind Scheiße, die machen einen immer ganz übel an.“2 Daher lud sie den Politologen
JÜRGEN SCHLICHER zu ihrer Klasse ein, der von der Entwicklerin dieses Konzepts, einer
amerikanischen Lehrerin namens JANE ELLIOT, darauf geschult wurde.
Zur ersten Schulstunde wurden die Schüler von SCHLICHER mit dem Kommando
„hinsetzen, Klappe halten, Beine zusammen!“ begrüßt. Anschließend wurden sie in die
Gruppen „Blauäugige“ und „Braunäugige“ aufgeteilt. Die Blauäugigen wurden in ein
Zimmer geschickt und mussten dort über eine Stunde warten ohne den Grund dafür zu
kennen oder zu wissen was auf sie zukommt. Währenddessen wurden die Braunäugigen
mit Saft und Keksen versorgt, und es wurde ihnen der Ablauf des Schultages erklärt. Die
Schüler sollten an jenem Tag in einer praktischen Übung ihre blauäugigen Mitschüler
aufgrund ihrer Augenfarbe diskriminieren. SCHLICHER „begründete“ es damit, dass
Menschen mit blauen Augen faul, dumm und aufsässig seien und nicht zuhören oder lernen
könnten. Dies läge am niedrigen Melaningehalt in ihren Augen. Den Schülern solle heute
das zugemutet werden, was manche Personengruppen ihr ganzes Leben lang ertragen
müssen, wie z. B. Homosexuelle, Ausländer oder Menschen mit psychischen
Erkrankungen.
Die Regeln für diese Übung sind folgendermaßen: Die braunäugigen Schüler dürfen die
Blauäugigen nicht anlächeln, sich nicht mit ihnen solidarisieren und ihnen keine Hilfe oder
Erklärungen anbieten. [...]
1 vgl. Koch, S. (2001): Dumm, aufsässig und faul? Blauäugig!, Sozialmagazin 26, S. 36-39.
2 Koch, S. (2001), a.a.O., S. 37.
Inhaltsverzeichnis
- VORWORT
- EINLEITUNG
- TEIL 1: STIGMATISIERUNG VON MENSCHEN MIT PSYCHISCHEN ERKRANKUNGEN
- 1. BEGRIFFSERKLÄRUNG
- 1. 1 Stigmatisierung
- 1. 2 Psychische Erkrankungen
- 2. ENTSTEHUNG VON STIGMATISIERUNG
- 2. 1 Einstellungen
- 2. 1. 1 Erwerb von Einstellungen
- 2. 1. 2 Vorurteile
- 2. 1. 2. 1 Entstehung von Vorurteilen
- 2. 1. 3 Stigmatisierung
- 2. 2 Schizophrenie – eine unverstandene und unakzeptierte Krankheit
- 2. 2. 1 Assoziationen zum Begriff Schizophrenie
- 2. 3 Der Einfluss der Medien
- 2. 3. 1 Schizophrenie in den Printmedien
- 2. 3. 2 Psychisch Kranke in Fernsehfilmen
- 3. AUSWIRKUNGEN DER STIGMATISIERUNG
- 3. 1 Auf die Betroffenen
- 3. 2 Auf die Angehörigen
- 4. ENTSTIGMATISIERUNG
- 4. 1 Veränderung von Einstellungen und Vorurteilen
- 4. 2 Einstellung der Bevölkerung gegenüber psychisch erkrankten Menschen
- 4. 2. 1 Auswirkungen der Attentate auf Lafontaine und Schäuble
- 4. 3 Gemeindepsychiatrische Versorgung als Brücke gegen Stigma und Isolation
- 4. 3. 1 Geschichtlicher Abriss
- 4. 3. 2 Gemeindepsychiatrie heute
- 2. TEIL: FRAGEBOGENUNTERSUCHUNG BEI SCHÜLERN
- 1. BEFRAGUNG VON GYMNASIASTEN
- 1. 1 Methodik der schriftlichen Befragung
- 1. 2 Vorgehen der Befragung
- 2. VORSTELLUNG DES FRAGEBOGENS
- 3. VERGLEICH DER EINSTELLUNGEN ZWISCHEN DEN VERSCHIEDENEN KLASSENSTUFEN
- 3. 1 Ergebnisse
- 3. 1. 1 Eigenschaften
- 3. 1. 2 Emotionale Reaktion
- 3. 1. 3 Soziale Distanz
- 3. 1. 4 Stigmatisierung
- 3. 1. 5 Professionelle Hilfe
- 3. 1. 6 Erster Gedanke zu „psychischen Erkrankungen“
- 4. EINSTELLUNGEN DER SCHÜLER IM VERGLEICH ZU SOZIALPÄDAGOGIKSTUDENTEN UND DER BEVÖLKERUNG MANNHEIMS
- 4. 1 Einstellungen der Sozialpädagogikstudenten
- 4. 2 Einstellungen der Bevölkerung Mannheims
- 4. 3 Ergebnisse
- 4. 3. 1 Eigenschaften
- 4. 3. 2 Emotionale Reaktion
- 4. 3. 3 Soziale Distanz
- 4. 4. 4 Stigmatisierung
- 5. AUSWIRKUNG PRIVATER KONTAKTE AUF DIE EINSTELLUNG GEGENÜBER MENSCHEN MIT PSYCHISCHEN ERKRANKUNGEN
- 5. 1 Ergebnisse
- 5. 1. 1 Eigenschaften
- 5. 1. 2 Emotionale Reaktionen
- 5. 1. 3 Soziale Distanz
- 5. 1. 4 Stigmatisierung
- 6. ZUSAMMENFASSUNG UND INTERPRETATION
- 7. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT BEI SCHÜLERN
- 7. 1 Projekte an Schulen
- ABSCHLIEBENDE STELLUNGNAHME
- Begriffsdefinition und Entstehung von Stigmatisierung
- Einfluss von Vorurteilen und Medien auf die Wahrnehmung psychisch erkrankter Menschen
- Auswirkungen von Stigmatisierung auf Betroffene und ihre Angehörigen
- Möglichkeiten zur Entstigmatisierung durch Aufklärung und Veränderung von Einstellungen
- Empirische Untersuchung von Einstellungen gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen bei Schülern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen und untersucht Einstellungen gegenüber dieser Personengruppe, insbesondere bei Schülern. Die Arbeit untersucht die Entstehung von Stigmatisierung, die Auswirkungen auf Betroffene und Angehörige sowie die Möglichkeiten zur Entstigmatisierung.
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit widmet sich der Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Es werden die Begriffe Stigmatisierung und psychische Erkrankung definiert und die Entstehung von Stigmatisierung anhand von Einstellungen, Vorurteilen und Medien dargestellt. Die Auswirkungen von Stigmatisierung auf Betroffene und Angehörige werden beleuchtet. Zudem werden Möglichkeiten zur Entstigmatisierung durch Aufklärung und Veränderung von Einstellungen diskutiert.
Der zweite Teil der Arbeit stellt eine empirische Studie vor, die Einstellungen von Schülern gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen untersucht. Die Methodik der Befragung wird erläutert und die Ergebnisse werden anhand verschiedener Klassenstufen sowie im Vergleich zu Sozialpädagogikstudenten und der Bevölkerung Mannheims analysiert. Der Einfluss von persönlichen Kontakten auf die Einstellung gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen wird untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Stigmatisierung, psychische Erkrankungen, Einstellungen, Vorurteile, Medien, Entstigmatisierung, Aufklärung, Empirie, Schüler, Sozialpädagogik, Gemeindepsychiatrie.
- Citation du texte
- Nadine Kraus (Auteur), 2003, Einstellungen gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19819