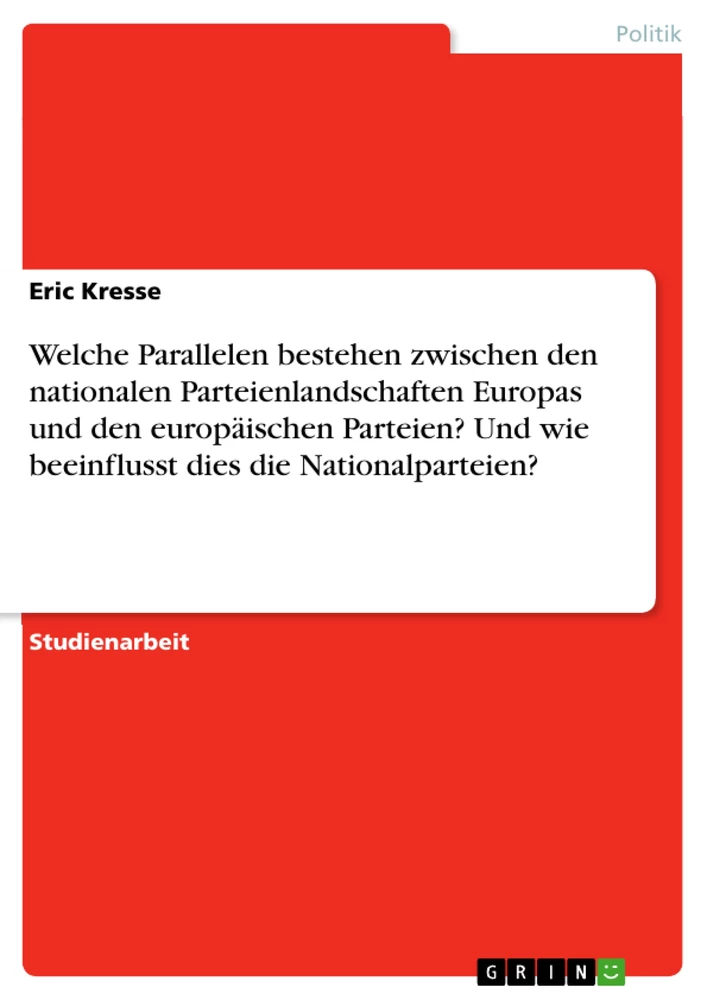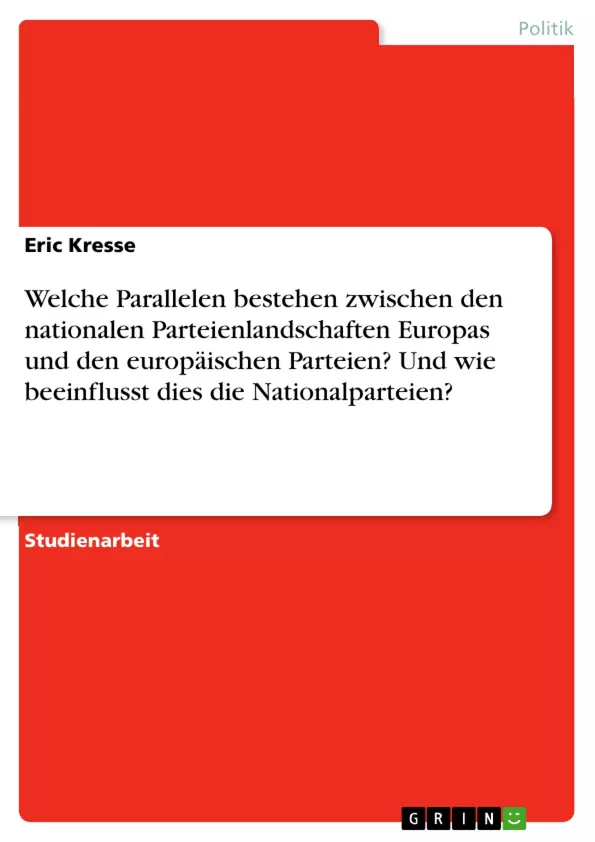Der Einfluss der auf europäischer Ebene erlassenen Gesetze nimmt auch für den einzelnen Bürger mehr und mehr zu. Ein Zeichen der fortschreitenden europäischen Integration. In diesem Zusammenhang geben die nationalen Mitgliedstaaten zunehmend Kompetenzen an die supranationale Instanz ab. Eine Kontrolle und Beschränkung dieser ist daher im Sinne der Machtregulierung und zum Schutz der Bürger unerlässlich. Die bestehenden nationalen Verhältnisse zwischen Staat und Volk müssen auch in der EU gewahrt bleiben, weshalb Parteien ebenso angehalten sind, im Europäischen Parlament zu partizipieren und somit das Gebot der Demokratie zu wahren.
Dies bedingt die Forderung nach einer verstärkten transnationalen Kooperation der nationalen Parteien. Die so gebildeten europäischen Parteien als Zusammenschluss Gleichgesinnter verfolgen einheitliche politische Ziele und bilden ebenso gemeinsame Fraktionen im Europäischen Parlament.
Die aktuelle Fachliteratur der Politikwissenschaft zeichnet sich vor allem durch die Betrachtung der älteren und gleichsam größeren europäischen Parteien aus, während die neuen und kleineren Parteien stark vernachlässigt werden. Hierbei sind Parallelen zur nationalen Parteienforschung zu bemerken, weshalb sich die Frage nach ähnlichen Entwicklungstendenzen stellt. Ebenso soll die Frage beantwortet werden, in wie weit die Nationalparteien von der Europäisierung betroffen sind. Diese Arbeit soll daher die gemeinsamen Entwicklungsstränge der Nationalstaaten sowie der Europäischen Union aufzeigen. Aufgrund des vordefinierten Umfangs dieser Arbeit wird sich die Darlegung der europäischen Parteien auf die Groß- und etablierten Kleinparteien sowie die Betrachtung der Entwicklung nationaler Parteienlandschaften auf die Bundesrepublik Deutschland begrenzen.
In der vorliegenden Arbeit sollen zunächst die fundamentalen rechtlichen Grundlagen der europäischen Parteien eine wesentliche Erwähnung finden, bevor die Parteien vorgestellt und Gründe dargelegt werden, die zur Partizipation im Europäischen Parlament Veranlassung geben. Anschließend werden Parallelen der europäischen Parteienlandschaft und den nationalen politischen Systemen aufgezeigt, wobei die Wechselseitigkeit besondere Berücksichtigung erfährt.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitende Betrachtungen
2. Rechtliche Grundlagen
3. Europäische Parteien
3.1 Zur historischen Entwicklung europäischer Parteien
3.2 Gründe der politischen Partizipation auf europäischer Ebene
3.3 Europäische Parteienlandschaft
4. Nationale und supranationale Entwicklung im Vergleich
4.1 Signifikante Veränderungen nationaler Parteienlandschaft am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland
4.2 Das politische System der EU als Gegenstand der Betrachtung
4.3 Vom nationalen Einfluss auf das europäische Parteiensystem
4.2.1 Konfliktlinien und Etablierungsphase
4.3.2 Zunehmende Fragmentierung und Professionalisierungsphase
4.4 Europäisierung nationaler Parteien
5. Abschließende Gedanken: Reaktion statt Aktion
Verzeichnis verwendeter Literatur
Häufig gestellte Fragen
Welche Parallelen gibt es zwischen nationalen und europäischen Parteien?
Die europäische Parteienlandschaft spiegelt oft nationale Entwicklungstendenzen wider, wie z.B. die Fragmentierung des Parteiensystems und die Professionalisierung der politischen Arbeit.
Was ist die rechtliche Grundlage für europäische Parteien?
Europäische Parteien basieren auf supranationalen Regelungen, die ihre Anerkennung und Finanzierung regeln, um die demokratische Partizipation im Europäischen Parlament zu sichern.
Wie beeinflusst die Europäisierung die nationalen Parteien?
Nationalparteien müssen zunehmend Kompetenzen an die EU abgeben und sich transnational koordinieren, was ihre Programmatik und Organisationsstruktur verändert.
Warum ist transnationale Kooperation für Parteien wichtig?
Sie ermöglicht es gleichgesinnten Parteien, gemeinsame Fraktionen im EU-Parlament zu bilden, politische Ziele einheitlich zu verfolgen und die Macht auf supranationaler Ebene zu regulieren.
Wie hat sich die Parteienlandschaft in Deutschland verändert?
Die Arbeit zeigt am Beispiel Deutschlands eine zunehmende Fragmentierung, bei der neben den Volksparteien auch kleinere, spezialisierte Parteien an Bedeutung gewinnen, was sich auch auf EU-Ebene zeigt.
- Quote paper
- Eric Kresse (Author), 2010, Welche Parallelen bestehen zwischen den nationalen Parteienlandschaften Europas und den europäischen Parteien? Und wie beeinflusst dies die Nationalparteien?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198230