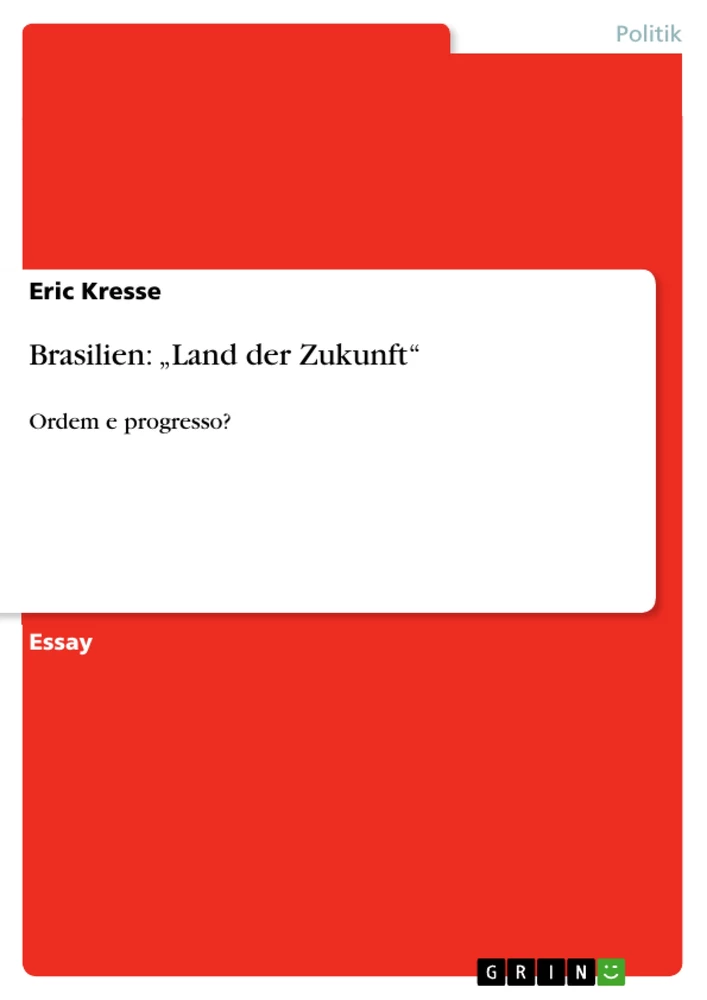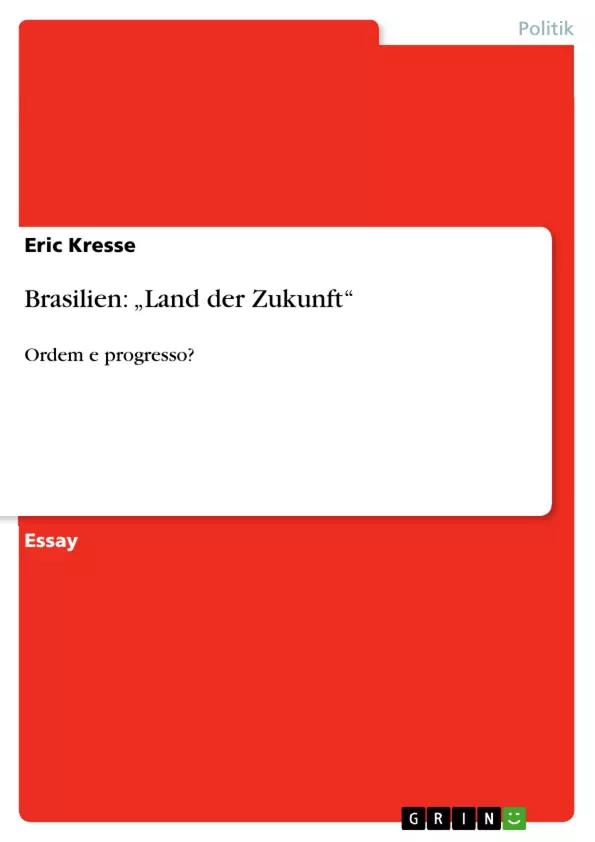Stefan Zweig bezeichnete Brasilien bereits 1941 als „Land der Zukunft“. Konnte man diesen politischen und wirtschaftlichen Zustand für diese Zeit noch nicht bestätigen, so lässt sich doch vielmehr ein sich in den letzten Jahren vollzogener wirtschaftlicher Aufschwung, einhergehend mit einer weltpolitischen Einflusssteigerung, beobachten, welche den Staat zur Führungsmacht Südamerikas gemacht hat. Während im 19.Jahrhundert eine Europaausrichtung und gleichsam kaum diplomatische Beziehungen zu anderen südamerikanischen Staaten bestanden, ist Brasilien heute ein wichtiges Mitglied der BRIC-Staaten und des Mercosur. Der wirtschaftliche Aufstieg begann in den 1970er Jahren, welcher jedoch auch ein gesteigertes Nationalbewusstsein nach sich zog, wodurch sich ebenso das Ziel der südamerikanischen Führungsmacht formulierte. Ordnung und Fortschritt sollten hierbei Leitmotive des innenpolitischen, aber auch außenpolitischen Handelns darstellen.
189 UN-Mitgliedsstaaten sehen in den „Millenniumserklärungen“ vom September 2000 acht Strukturpunkte, die eine globale Entwicklungspolitik vorantreiben sollen. So ist neben der (1) Beseitigung extremer Armut, der (2) Verwirklichung einer allgemeinen Grundschulbildung, der (3) Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung von Macht und Einfluss der Frauen, eine (4) Senkung der Kindersterblichkeit als Ziel formuliert. Weiterhin soll die (5) gesundheitliche Verbesserung von Müttern, die (6) Bekämpfung von HIV und anderen Krankheiten, die (7) Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit und der (8) Aufbau einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft angestrebt werden.
Stefan Zweig bezeichnete Brasilien bereits 1941 als „Land der Zukunft“.[1] Konnte man diesen politischen und wirtschaftlichen Zustand für diese Zeit noch nicht bestätigen, so lässt sich doch vielmehr ein sich in den letzten Jahren vollzogener wirtschaftlicher Aufschwung, einhergehend mit einer weltpolitischen Einflusssteigerung, beobachten, welche den Staat zur Führungsmacht Südamerikas gemacht hat. Während im 19.Jahrhundert eine Europaausrichtung und gleichsam kaum diplomatische Beziehungen zu anderen südamerikanischen Staaten bestanden, ist Brasilien heute ein wichtiges Mitglied der BRIC-Staaten und des Mercosur.[2] Der wirtschaftliche Aufstieg begann in den 1970er Jahren, welcher jedoch auch ein gesteigertes Nationalbewusstsein nach sich zog, wodurch sich ebenso das Ziel der südamerikanischen Führungsmacht formulierte.[3] Ordnung und Fortschritt sollten hierbei Leitmotive des innenpolitischen, aber auch außenpolitischen Handelns darstellen.
189 UN-Mitgliedsstaaten sehen in den „Millenniumserklärungen“ vom September 2000 acht Strukturpunkte, die eine globale Entwicklungspolitik vorantreiben sollen. So ist neben der (1) Beseitigung extremer Armut, der (2) Verwirklichung einer allgemeinen Grundschulbildung, der (3) Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung von Macht und Einfluss der Frauen, eine (4) Senkung der Kindersterblichkeit als Ziel formuliert. Weiterhin soll die (5) gesundheitliche Verbesserung von Müttern, die (6) Bekämpfung von HIV und anderen Krankheiten, die (7) Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit und der (8) Aufbau einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft angestrebt werden.[4]
Der Anteil der in extremer Armut Lebenden hat sich laut UN-Fortschrittsbericht 2009 von 40% (1990) auf 25% (2009) reduziert.[5] Brasilien konnte die Armutsquote laut Latinobarómetro 2009 zwischen den Jahren 2001 und 2008 von 37,5% auf 25,8% verringern, ferner den Anteil extremer Armut von 13,3% auf 7,3% fast halbieren.[6] Weitere Sozialindikatoren wie Kindersterblichkeit, ärztliche Versorgung und Analphabetismus wurden gleichsam erfolgreich bekämpft.[7] Aufgrund der benannten Daten – sowie nicht letztliche der bemerkbare Erfolg im Kampf gegen den Hunger[8] – lässt sich ein innenpolitischer Fortschritt auf sozialer Ebene nicht von der Hand weisen.
Der Übergang von der Diktatur zur Demokratie im Jahre 1985 brachte neue Politiker an die Spitze Brasiliens, welche sich auf eine außenpolitische Kooperation verständigten.[9] Ein bilaterales Abkommen zur gegenseitigen Inspektion der Nuklearanlagen stellte 1991 die Basis zur Gründung des Mercosur dar, der Gemeinsame Markt des Südens. Aufgrund einer sich nicht als komplementär darstellenden wirtschaftlichen Entwicklung der Mitgliederstaaten – auch durch sich später ergebende Kooperationen, auf die es noch einzugehen gilt – blieb ein sich aus dem Abkommen ergebender Erfolg aus, allerdings stellt Mercosur ein Instrument zur politischen Stabilität der Region dar, welches seine Wichtigkeit für Lateinamerika unterstreicht.[10]
Die Errungenschaft Demokratie hat für die 196 Mio. Einwohner[11] Brasiliens einen hohen Stellenwert und wird demnach grundlegend positiv bewertet. Allerdings geht dies mit dem Bewusstsein um einen bisher geringen Fortschritt einher, wobei die Bevölkerung die Demokratie als Basis für eine optimistische Zukunft sieht. Zu betonen bleibt jedoch auch, wohl durch die eigene Geschichte geprägt, dass, laut Latinobarómetro 2009, 61% der Bürger einen Sturz des Präsidenten als gerechtfertigt betrachten, begeht dieser eine Verfassungsverletzung. Ferner sprechen sich 44% der Brasilianer für eine Legitimation einer Gesetzesmissachtung durch die Regierung aus, trägt dies zur politischen Problemlösung bei.[12] Insofern scheint die Verfassung auf politischem und sozialem Fundament etabliert zu sein, wenngleich der wichtige Begriff der Ordnung durch unterschiedliche kulturelle Auffassungen geprägt ist.
Der Internationale Währungsfond bestätigt Brasilien eine sinkende Ungleichheit, betrachtet man doch das Nord-Süd-Gefälle und bezieht hierbei den Kontext des weltweiten Anstiegs der Ungleichheit ein.[13] Gleichwohl verdeckt dies nicht den Aspekt korrupter Eliten.[14] Nach dem Umfrageergebnissen des Latinobarómetros 2008 geben zwar 43% der Brasilianer an, einen Fortschritt gegen die Korruptionsbekämpfung zu bemerken, jedoch wird die politische Elite gleichbleibend am stärksten der Korruption verdächtigt. So vertreten 61,2% der Brasilianer die Auffassung, dass mehr als die Hälfte der Politiker korrupt ist. Ebenso treffen die Verhältnisse von Armut und Reichtum auf enorme Kritik. So bezeichnen nur 16% der Brasilianer die Einkommensverteilung als gerecht, während die breite Schicht der Demokratie die Fähigkeit einer gerechten Umverteilung abspricht – was vor allem der fehlenden Gemeinwohlorientierung der Regierung zugeschrieben wird. Gleichsam sehen 42% die politischen und wirtschaftlichen Interessen des ganzen Volkes vertreten, 66% bezeichnen die Politik hingegen als Meinungsvertretung mächtiger Interessengruppen. Somit lässt sich feststellen, dass dies mit einer Politikverdrossenheit und skeptischen Ernüchterung einhergeht, welche den Glauben an die demokratische Ordnung wanken lässt.[15]
[...]
[1] Vgl. Birle, Peter: Argentinien und Brasilien zwischen Rivalität und Partnerschaft, In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament“ vom 22.März 2010 (12/2010), S. 8.
[2] Vgl. Ebd.: S. 3.
[3] Vgl. Ebd.: S. 5.
[4] Vgl. Holtz, Uwe: Die Millenniumsentwicklungsziele – eine gemischte Bilanz, In: Aus Politik und Geschichte, Beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament“ vom 08.März 2010 (10/2010), S. 3.
[5] Vgl. Ebd.: S. 4.
[6] Vgl. Zilla, Claudia: Erfahrung der Zeit – politische Kultur in Argentinien und Brasilien, In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament“ vom 22.März 2010 (12/2010), S. 13.
[7] Vgl. Birle: [FN1], S. 7.
[8] Vgl. Holtz: [FN4], S. 4.
[9] Vgl. Birle: [FN1], S. 6.
[10] Vgl. Grabendorf:, Wolf: Brasiliens Aufstieg: Möglichkeiten und Grenzen regionaler und globaler Politik In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament“ vom 22.März 2010 (12/2010), S. 18.
[11] Vgl. Birle: [FN1], S. 7.
[12] Vgl. Zilla: [FN6], S. 14-15.
[13] Vgl. Isidoro Losada, Ana María/Ernst, Tanja: Nord-Süd-Beziehungen: Globale Ungleichheit im Wandel?, In: Aus Politik und Geschichte, Beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament“ vom 08.März 2010 (10/2010), S. 13.
[14] Vgl. Holtz: [FN4], S. 7.
[15] Vgl. Zilla: [FN6], S. 13-14.
Häufig gestellte Fragen
Warum bezeichnete Stefan Zweig Brasilien als „Land der Zukunft“?
Zweig sah bereits 1941 das enorme Potenzial des Landes, auch wenn sich der wirtschaftliche Aufstieg erst Jahrzehnte später massiv vollzog.
Wie hat sich die Armut in Brasilien entwickelt?
Zwischen 2001 und 2008 sank die Armutsquote deutlich von 37,5% auf 25,8%, und die extreme Armut wurde fast halbiert.
Was ist der Mercosur und welche Rolle spielt Brasilien darin?
Der Mercosur ist ein gemeinsamer Markt südamerikanischer Staaten. Brasilien fungiert darin als wirtschaftliche und politische Führungsmacht der Region.
Wie steht die brasilianische Bevölkerung zur Demokratie?
Die Demokratie wird grundsätzlich positiv bewertet, jedoch gibt es eine hohe Skepsis gegenüber der politischen Elite und eine ausgeprägte Wahrnehmung von Korruption.
Was sind die größten sozialen Herausforderungen in Brasilien?
Trotz Fortschritten bleiben die ungleiche Einkommensverteilung, Korruption in der Elite und regionale Disparitäten (Nord-Süd-Gefälle) zentrale Probleme.
- Citar trabajo
- Eric Kresse (Autor), 2010, Brasilien: „Land der Zukunft“, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198234