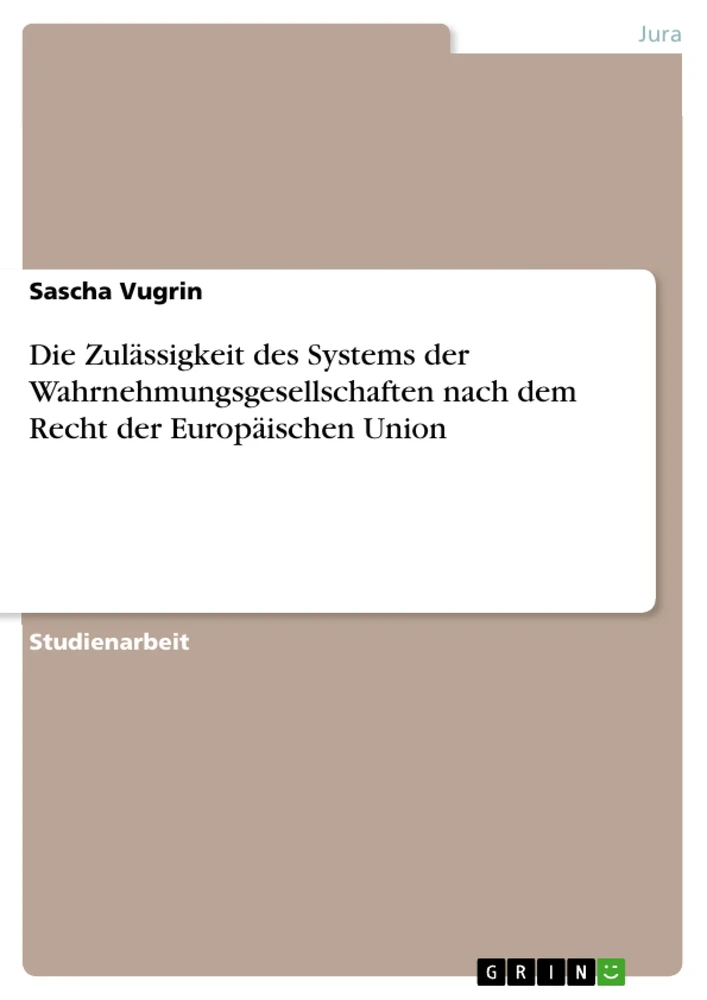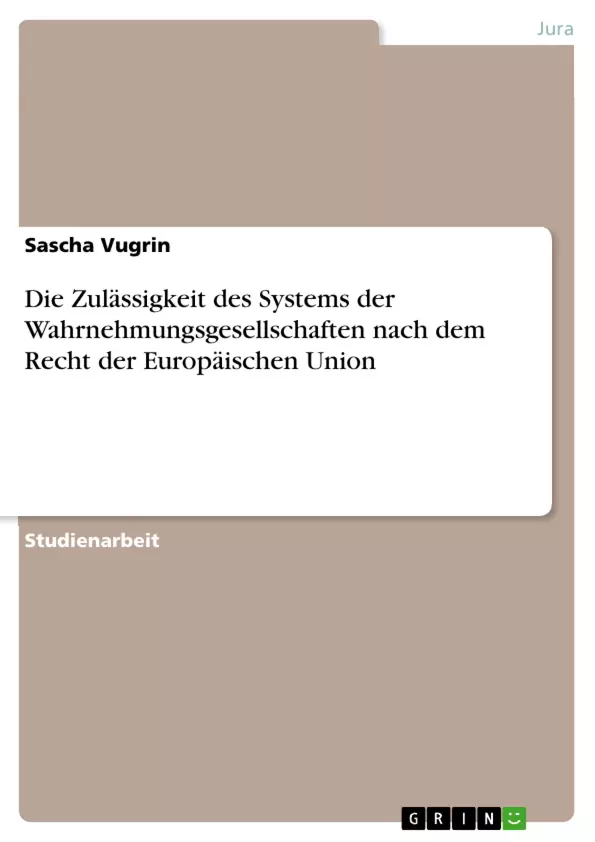Mit der durch die EG-Verordnung 1/2003 angestoßenen Novellierung des GWB wurde im Jahr 2005 die Privilegierung der Wahrnehmungsgesellschaften im deutschen Kartellrecht gestrichen. Ungelöst blieb im Anschluss die dadurch aufgeworfene Frage bezüglich der Zulässigkeit der Verwertungsgesellschaften (VGen) nach europäischem Kartellrecht. Die kollektive Verwertung von Urheberrechten durch Gesellschaften ist weltweit etabliert und ermöglicht eine solche eben erst durch ihre problematische Stellung zwischen Urheber- und Wettbewerbsrecht. Ihre Betrachtung ist Gegenstand dieser Arbeit. Zunächst wird an Hand der Schranken des Urheberrechts die Notwendigkeit der kollektiven Wahrnehmung durch VGen hergeleitet. Im Anschluss folgen eine Erläuterung zu den Normen des europä-ischen Kartellrechts, sowie die Anwendung des Selben auf die jeweiligen Verhältnisse der VGen zu anderen Rechtssubjekten.
Inhaltsverzeichnis
- Die Zulässigkeit des Systems der Wahrnehmungsgesellschaften nach dem Recht der Europäischen Union
- Einleitung
- Das Recht der Europäischen Union: Die Freistellung von Kartellverboten
- Das Verhältnis von Art. 101 AEUV und Art. 101 AEUV
- Die Freistellung von Kartellverboten nach Art. 101 Abs. 3 AEUV
- Die Beurteilung von Wahrnehmungsgesellschaften nach dem Recht der Europäischen Union
- Die Beurteilung von Wahrnehmungsgesellschaften nach Art. 101 AEUV
- Die Beurteilung von Wahrnehmungsgesellschaften nach Art. 101 Abs. 3 AEUV
- Die Rolle der Kommission der Europäischen Union im Rahmen von Wahrnehmungsgesellschaften
- Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu Wahrnehmungsgesellschaften
- Zusammenfassende Betrachtung und Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die Zulässigkeit des Systems der Wahrnehmungsgesellschaften nach dem Recht der Europäischen Union. Sie analysiert die Freistellung von Kartellverboten im europäischen Recht und beleuchtet die spezifischen Herausforderungen, die sich im Zusammenhang mit Wahrnehmungsgesellschaften ergeben. Die Arbeit befasst sich mit dem Spannungsfeld zwischen dem Schutz von Urheberrechten und dem Wettbewerb im Binnenmarkt.
- Das Recht der Europäischen Union und die Freistellung von Kartellverboten
- Die Beurteilung von Wahrnehmungsgesellschaften nach dem Recht der Europäischen Union
- Die Rolle der Kommission und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
- Die Bedeutung von Wahrnehmungsgesellschaften für den Schutz von Urheberrechten und die Förderung von Kultur
- Die Herausforderungen, die sich im Zusammenhang mit Wahrnehmungsgesellschaften im digitalen Zeitalter stellen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Seminararbeit ein, beschreibt die Relevanz der Thematik und formuliert die Forschungsfragen. Es legt die methodische Vorgehensweise und die Struktur der Arbeit dar.
- Das Recht der Europäischen Union: Die Freistellung von Kartellverboten: Dieses Kapitel analysiert die rechtlichen Grundlagen der Freistellung von Kartellverboten im europäischen Recht. Es beleuchtet das Verhältnis von Art. 101 AEUV und Art. 101 AEUV und stellt die Voraussetzungen für die Freistellung nach Art. 101 Abs. 3 AEUV dar.
- Die Beurteilung von Wahrnehmungsgesellschaften nach dem Recht der Europäischen Union: Dieses Kapitel befasst sich mit der Anwendung des europäischen Kartellrechts auf Wahrnehmungsgesellschaften. Es untersucht, ob Wahrnehmungsgesellschaften als Kartelle im Sinne von Art. 101 AEUV anzusehen sind und welche Voraussetzungen für die Freistellung nach Art. 101 Abs. 3 AEUV erfüllt sein müssen.
- Die Rolle der Kommission der Europäischen Union im Rahmen von Wahrnehmungsgesellschaften: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der Kommission der Europäischen Union bei der Überwachung und Kontrolle von Wahrnehmungsgesellschaften. Es untersucht die Kompetenzen der Kommission im Bereich des Kartellrechts und die Möglichkeiten der Intervention im Fall von Wettbewerbsverzerrungen.
- Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu Wahrnehmungsgesellschaften: Dieses Kapitel beleuchtet die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu Wahrnehmungsgesellschaften. Es untersucht die wichtigsten Entscheidungen des Gerichtshofs und deren Auswirkungen auf die Beurteilung von Wahrnehmungsgesellschaften im europäischen Recht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die zentralen Themen des europäischen Kartellrechts, der Freistellung von Kartellverboten, der Rechtsstellung von Wahrnehmungsgesellschaften und der Regulierung im Bereich des geistigen Eigentums. Weitere wichtige Begriffe sind Urheberrecht, Kollektivrechtewahrnehmung, Wettbewerb, Binnenmarkt und digitale Technologien.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Wahrnehmungsgesellschaften (Verwertungsgesellschaften)?
Organisationen wie die GEMA, die kollektiv die Urheberrechte von Künstlern verwalten und Lizenzen an Nutzer vergeben.
Sind Verwertungsgesellschaften mit dem EU-Kartellrecht vereinbar?
Die Arbeit untersucht das Spannungsfeld zwischen Art. 101 AEUV (Kartellverbot) und der Notwendigkeit kollektiver Wahrnehmung zum Schutz von Urhebern.
Was änderte sich durch die GWB-Novelle 2005?
Die Privilegierung von Wahrnehmungsgesellschaften im deutschen Kartellrecht wurde gestrichen, was die Frage nach ihrer Zulässigkeit auf EU-Ebene verschärfte.
Warum ist eine kollektive Wahrnehmung von Urheberrechten notwendig?
Einzelne Urheber könnten ihre Rechte gegenüber einer Vielzahl von Nutzern (z.B. Radiosender weltweit) kaum individuell durchsetzen und kontrollieren.
Welche Rolle spielt der Europäische Gerichtshof (EuGH)?
Der EuGH hat durch verschiedene Urteile die Grenzen und Bedingungen definiert, unter denen Verwertungsgesellschaften im Binnenmarkt agieren dürfen.
- Citation du texte
- Sascha Vugrin (Auteur), 2011, Die Zulässigkeit des Systems der Wahrnehmungsgesellschaften nach dem Recht der Europäischen Union, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198257