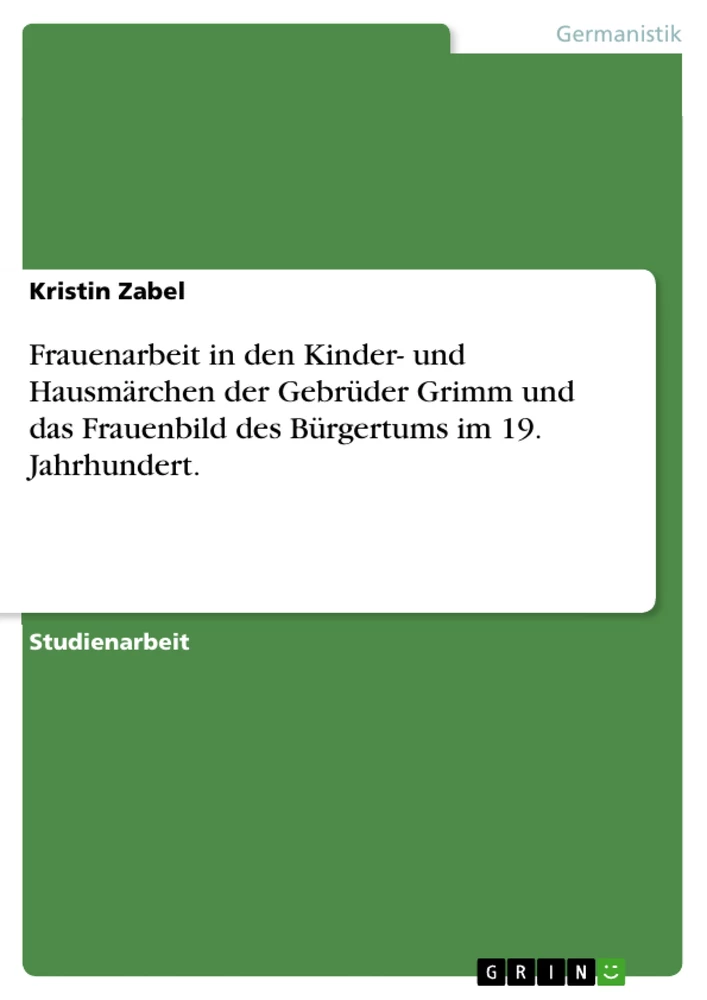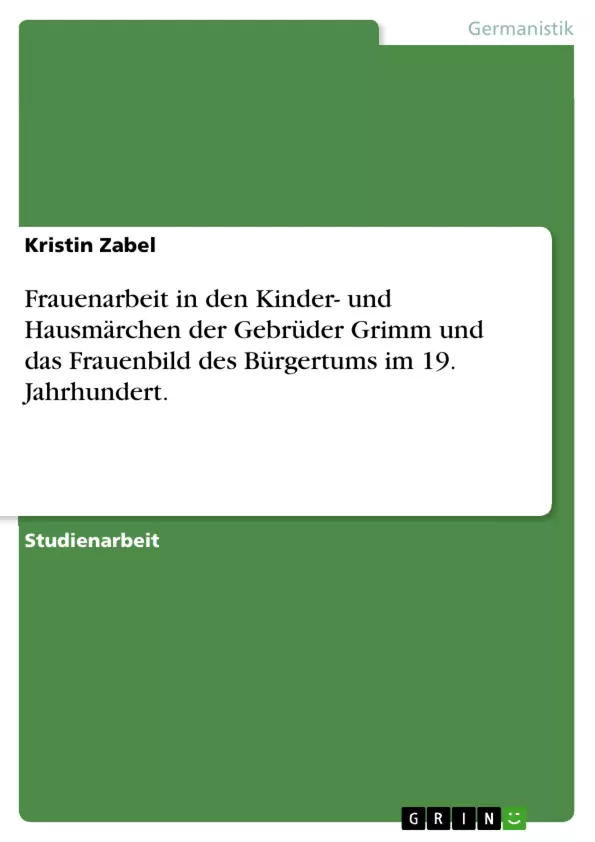Viele Menschen sind mit Märchen aufgewachsen. Besonders die im deutschsprachigen Raum bekannteste Märchensammlung der Kinder- und Hausmärchen von Jacob und Wilhelm Grimm erfreut sich seit ihrem ersten Erscheinen im Jahre 1812 äußerster Beliebtheit. Ihr Erfolg ist bis heute ungebrochen.
Die Grimmschen Märchen waren und sind für viele Menschen prägend. Der Einfluss, den so tugendhafte Märchencharaktere wie das fleißige Aschenputtel oder die tüchtige Goldmarie auf die Werte- und auch Arbeitsmoralvorstellungen ihrer Leser und Leserinnen haben dürften, sollte nicht unterschätzt werden. Und wer hat nicht manchmal in Zeiten des „Faulenzens“ ein schlechtes Gewissen, denkt er an die arbeitsscheue Pechmarie, deren Trägheit mit einem Regen aus Pech bestraft wird?
Dem aufmerksamen Leser wird es nicht entgangen sein, dass bisher nur weibliche Märchenheldinnen erwähnt wurden – denn genau diese sind es, die in der vorliegenden Arbeit die Hauptrolle spielen werden. Es sind die weiblichen Märchenfiguren, deren Arbeit und deren Müßiggang im Folgenden genauer untersucht werden sollen. Hierbei sind für mich folgende Fragestellungen relevant: Welche Arten der Frauenarbeit treten in den Grimmschen Märchen auf und welchen Zweck erfüllen sie? Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Arbeit für die Märchenmoral und das vermittelte Frauenbild? Gleichzeitig möchte ich versuchen, einen Zeitbezug herzustellen und von den Grimmschen Märchen ausgehend auch in soziologischer Hinsicht Aussagen über das Frauenbild des Bürgertums in Bezug auf Arbeit und Müßiggang im 19. Jahrhundert zu treffen. Welche Aufschlüsse geben uns die Märchen über die Wertvorstellungen ihrer Zeit?
Um diese Fragen zu klären, werde ich zunächst erläutern, inwiefern die Kinder- und Hausmärchen trotz ihrer Jahrhunderte alten Wurzeln die gesellschaftlichen Werte ihrer Zeit spiegeln. Daran anschließend werde ich im Hauptteil direkt an ausgewählten Märchen untersuchen, welche Frauenarbeiten dort auftreten, welche Rolle in diesem Zusammenhang Fleiß und Faulheit spielen und welche Funktionen die Arbeiten erfüllen. Auf diesem Wissen aufbauend sollen dann Bezüge zu dem bürgerlichen Verständnis von Frauenarbeit hergestellt werden.
Inhalt
1. Einleitung.
2. Die Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm als Spiegel des bürgerlichen Frauenbildes
3. Die Frauenarbeit in ausgewählten Kinder- und Hausmärchen
3.1. Die Arten der Frauenarbeit in den Kinder- und Hausmärchen
3.2. Das Idealbild der fleißigen (Haus-)Frau
3.3. Das abschreckende Beispiel fauler Frauen
3.4. Die Funktionen der Frauenarbeit in den Kinder- und Hausmärchen und der sozialen Wirklichkeit des 19 Jahrhunderts
4. Schluss.
5. Literaturverzeichnis.
Häufig gestellte Fragen
Inwiefern spiegeln Grimms Märchen das bürgerliche Frauenbild wider?
Die Märchen vermitteln die Werte des 19. Jahrhunderts, insbesondere das Ideal der fleißigen Hausfrau und die Ächtung von Trägheit.
Welche Rolle spielt "Fleiß" in den Märchen der Brüder Grimm?
Fleiß wird als höchste weibliche Tugend dargestellt (z. B. Goldmarie), die am Ende stets mit sozialem Aufstieg oder Reichtum belohnt wird.
Wie wird "Faulheit" in den Erzählungen bestraft?
Figuren wie die Pechmarie dienen als abschreckende Beispiele, deren Arbeitsscheu mit Pech oder sozialer Ausgrenzung sanktioniert wird.
Welche Arten von Frauenarbeit kommen in den Märchen vor?
Es dominieren häusliche Tätigkeiten wie Spinnen, Kochen, Putzen und die allgemeine Sorge um den Haushalt.
Hatten die Märchen Einfluss auf die Arbeitsmoral der Leser?
Ja, die Märchen dienten als pädagogisches Werkzeug zur Erziehung und zur Festigung der bürgerlichen Arbeitsmoral im 19. Jahrhundert.
- Quote paper
- Kristin Zabel (Author), 2012, Frauenarbeit in den Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm und das Frauenbild des Bürgertums im 19. Jahrhundert., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198276