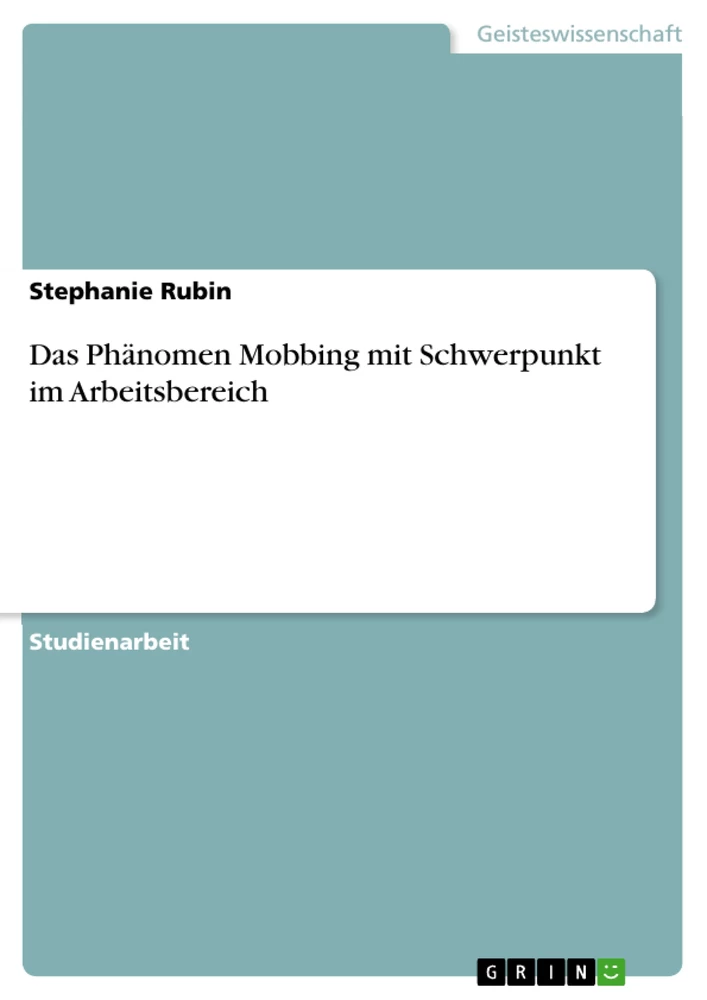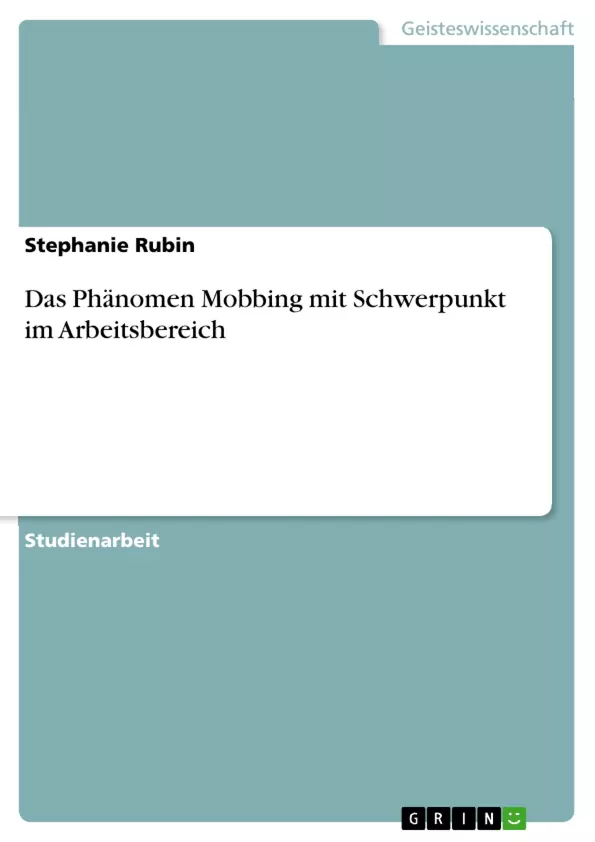Das Phänomen Mobbing wird heute fast überall angetroffen, also nicht nur im täglichen Arbeitsleben, sondern auch im privaten, sozialen und im Bildungsbereich. Wir konzentrieren uns jedoch hier überwiegend auf den Arbeitsbereich. Das Wort „Mobbing“ ist nur ein neuer Begriff, den Inhalt von Mobbing, also die zwischenmenschlichen Konflikte, gab es schon immer, früher wurde nicht so viel Aufheben davon gemacht. Man versteht Mobbing als eine Art Konfliktlösung, die jedoch meistens auf die Kosten anderer geht. Eine Form von Mobbing ist auch die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Sie stellt eine starke Einschränkung des persönlichen Wohlbefindens und der beruflichen Entwicklung der Frauen dar und wird aus diesem Grund in dieser Ausarbeitung mit beleuchtet. Die Folgen von Mobbing sind oft schwerwiegend und enden für manchen, der vielleicht zu sensibel ist, in einem Selbstmord.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Mobbing?
- Definitionen
- Erste Anzeichen
- Mobbinghandlungen
- Das Phasenmodell
- Die 45er Liste
- Der Leidensweg der Betroffenen
- Die Ursachen
- Die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz
- Das Beschäftigtenschutzgesetz
- Die Folgen von Mobbing
- Medizinische Folgen
- Soziale Folgen
- Handlungs – bzw. Lösungsmöglichkeiten
- Praktische Abwehrmaßnahmen gegen Mobber
- Quellenangaben
- Anlagen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen des Mobbings im Arbeitsleben und beleuchtet dessen Ursachen, Folgen und mögliche Lösungsansätze. Sie analysiert den Mobbingprozess anhand von Definitionen, Modellen und Beispielen, wobei der Fokus auf die Auswirkungen von Mobbing auf die Betroffenen liegt.
- Definition und Erscheinungsformen von Mobbing
- Ursachen und Faktoren, die Mobbing begünstigen
- Psychologische und soziale Folgen von Mobbing für Betroffene
- Rechtliche Rahmenbedingungen und Handlungsmöglichkeiten bei Mobbing
- Präventionsmaßnahmen und Strategien zur Bekämpfung von Mobbing
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Mobbings ein und erklärt die Relevanz des Themas im Arbeitskontext. Sie hebt die Bedeutung von Mobbing als ein ernstzunehmendes Problem hervor, das weitreichende Auswirkungen auf die Gesundheit, die berufliche Entwicklung und das Wohlbefinden der Betroffenen haben kann.
Kapitel 2 definiert Mobbing und präsentiert verschiedene Definitionen sowie typische Anzeichen, die auf Mobbing hindeuten können. Es werden verschiedene Formen von Mobbinghandlungen beschrieben und der Leidensweg der Betroffenen aufgezeigt.
Kapitel 3 analysiert die Ursachen für Mobbing und untersucht verschiedene Faktoren, die zum Mobbing beitragen können, wie beispielsweise mangelnde Kommunikation, Stress am Arbeitsplatz und Konflikte zwischen Kollegen. Es wird auch die besondere Situation der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz beleuchtet.
Kapitel 4 beleuchtet die Folgen von Mobbing, sowohl auf medizinischer als auch auf sozialer Ebene. Es werden die gesundheitlichen Folgen von Mobbing wie beispielsweise Depressionen, Angstzustände und Burnout, sowie die sozialen Folgen wie Isolation und Verlust des sozialen Netzwerks beschrieben.
Kapitel 5 beschäftigt sich mit Handlungs- und Lösungsmöglichkeiten bei Mobbing. Es werden verschiedene Ansätze zur Bekämpfung von Mobbing vorgestellt, wie beispielsweise Anti-Mobbing-Programme, Mediation und rechtliche Schritte.
Kapitel 6 präsentiert praktische Abwehrmaßnahmen, die Betroffene gegen Mobber ergreifen können. Es werden Strategien zur Selbstbehauptung, zur Kommunikation mit dem Mobber und zur Einholung von Unterstützung vorgestellt.
Schlüsselwörter
Mobbing, Psychoterror, Arbeitsleben, Konfliktlösung, sexuelle Belästigung, Beschäftigtenschutzgesetz, Folgen von Mobbing, Handlungsmöglichkeiten, Abwehrmaßnahmen, Prävention.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Phänomen Mobbing am Arbeitsplatz?
Mobbing wird als eine Art der Konfliktlösung verstanden, die meist auf Kosten anderer geht. Es handelt sich um zwischenmenschliche Konflikte im Arbeitsleben, die oft schwerwiegende psychosoziale Folgen für die Betroffenen haben.
Was sind typische erste Anzeichen für Mobbing?
Zu den ersten Anzeichen gehören gezielte Ausgrenzung, mangelnde Kommunikation, versteckte Kritik oder die systematische Abwertung der beruflichen Leistung eines Kollegen.
Welche Phasen durchläuft ein Mobbingprozess?
Der Mobbingprozess wird oft durch ein Phasenmodell beschrieben, das von anfänglichen Konflikten über die Festsetzung der Mobbinghandlungen bis hin zum Ausschluss des Betroffenen aus dem Arbeitsleben reicht.
Welche gesundheitlichen Folgen kann Mobbing haben?
Mobbing kann zu schweren medizinischen Folgen wie Depressionen, Angstzuständen, Burnout und in extremen Fällen sogar zum Selbstmord führen.
Welche Rolle spielt sexuelle Belästigung im Kontext von Mobbing?
Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz wird als eine spezifische Form von Mobbing betrachtet. Sie schränkt das persönliche Wohlbefinden und die berufliche Entwicklung massiv ein und ist gesetzlich durch das Beschäftigtenschutzgesetz geregelt.
Gibt es rechtliche Möglichkeiten gegen Mobbing vorzugehen?
Ja, es gibt verschiedene Lösungsansätze, darunter Anti-Mobbing-Programme, Mediation sowie rechtliche Schritte auf Basis des Arbeitsrechts und spezieller Schutzgesetze.
- Citation du texte
- Stephanie Rubin (Auteur), 2003, Das Phänomen Mobbing mit Schwerpunkt im Arbeitsbereich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19844