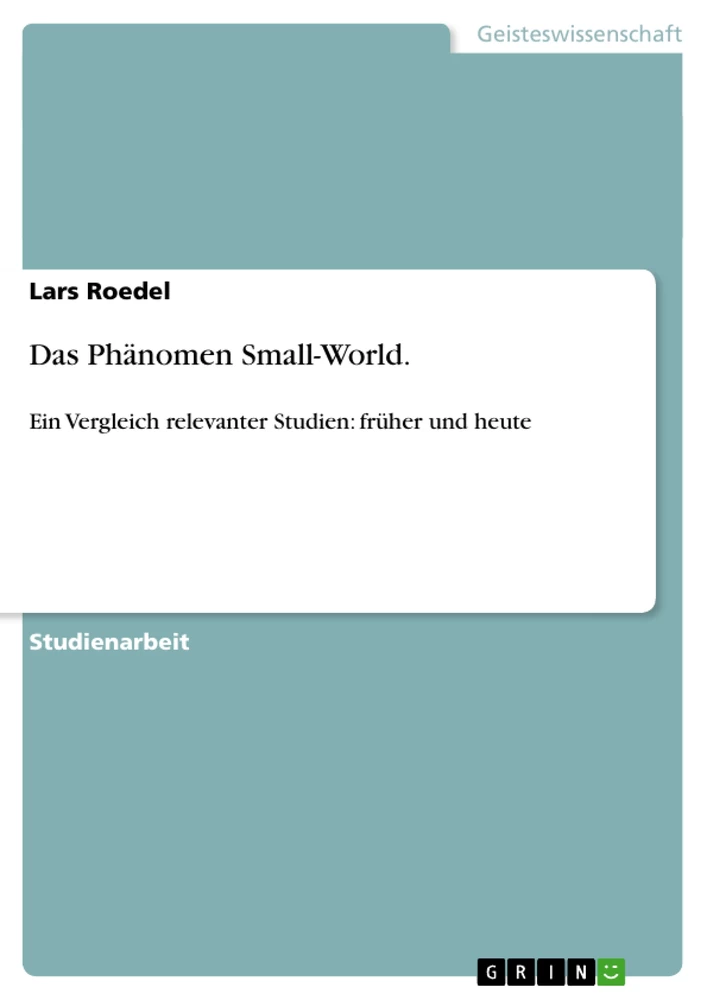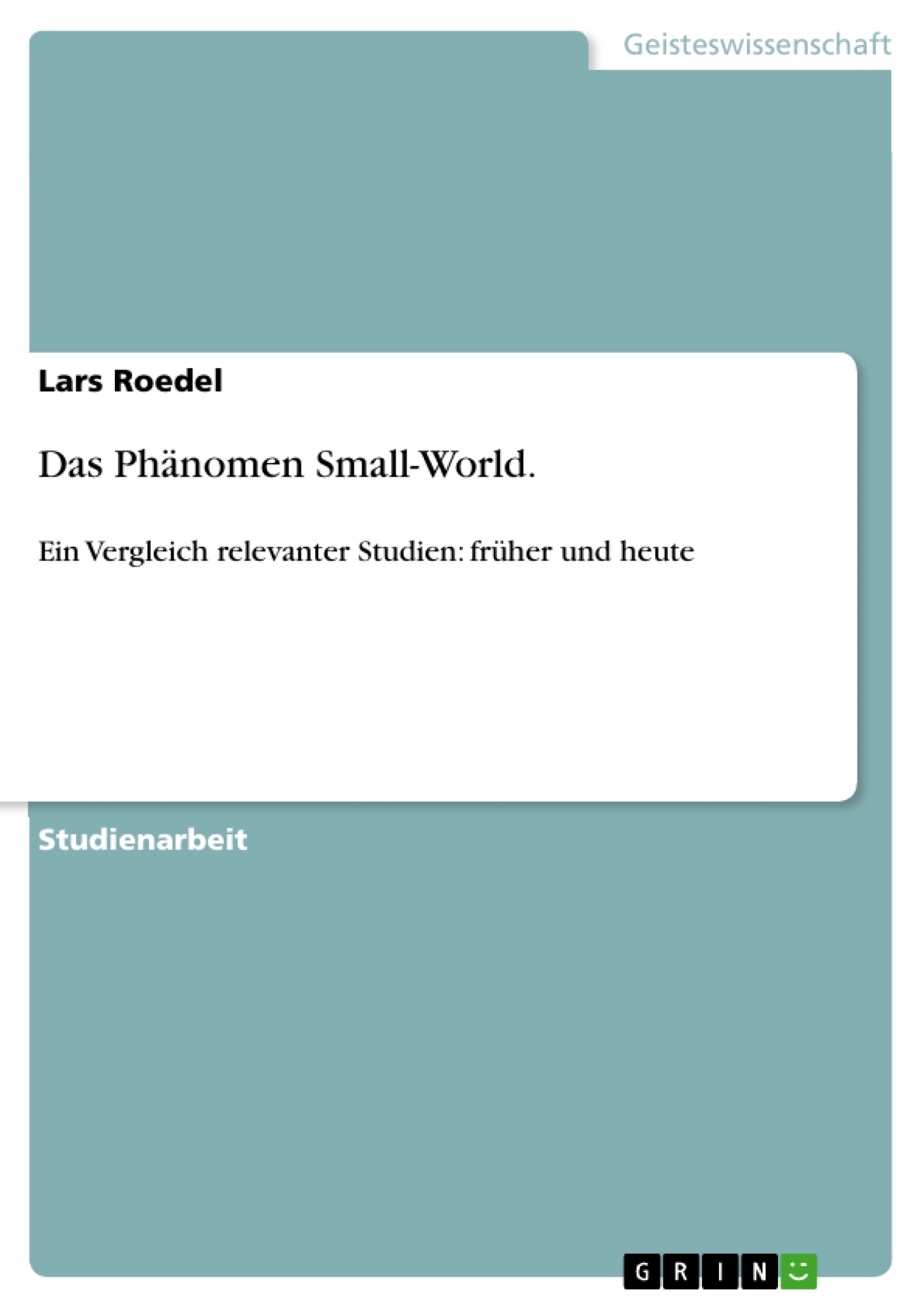„Das Jeder-kennt-jeden-Gesetz“ – Diesen Titel trug ein im August 2008 veröffentlichter Artikel bei spiegel-online und befasste sich mit dem Phänomen ‚small-world‘. Ein spannendes Thema im Zeitalter des web2.0 möchte man meinen. Geht man jedoch dem Ursprung dieses Begriffes nach so landet man in den 1960er Jahren bei dem Psychologen Stanley Milgram. Er war es, der zu dieser Zeit bereits postulierte, jeder Mensch kennt jeden anderen beliebigen Menschen durchschnittlich über sechs Ecken. Diese Arbeit soll nun, angefangen bei Milgrams Studie , diese darstellen (Kapitel I), und weiterführend über die dazugehörigen hypothetischen Berechnungen Harrison Whites, sowie den Versuch von Watts et al. (Kapitel II), diejenige Studie von Horvitz und Leskovec vorstellen (Kapitel III), auf welche sich der spiegel-online-Artikel bezieht. Danach (Kapitel IV) soll aufgezeigt werden, welche Unterschiede zu den Anfängen der small-world Forschung heute bestehen, aber auch wie ‚richtig‘ Milgram mit den Erkenntnissen seiner Untersuchung schon lag.
Bei der Bearbeitung der Studien sollen auch weitere Aspekte der sozialen Netzwerkforschung darauf angewendet werden. Diese sind die Zentralität in sozialen Netzwerken, sowie Homophilie. Abschließend soll dann ein kurzes Resümee folgen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kapitel I: Milgrams Untersuchungen
- I. 1: Vorgehensweise von Milgram
- I. 2: Milgrams Ergebnisse
- Kapitel II: Der nächste small-world-Versuch
- II. 1: Vorgehensweise von Watts et al
- II. 2: Ergebnisse der Studie
- Kapitel III: small-world-Forschung von Horvitz und Leskovec
- III. 1: Studienablauf bei Horvitz und Leskovec
- III. 2: Forschungsergebnisse
- Kapitel IV: Veränderungen in der small-world Forschung
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen "Small World", beginnend mit Milgrams Studie aus den 1960er Jahren und verfolgt dessen Entwicklung bis zu aktuellen Forschungsarbeiten. Die Arbeit analysiert die Methodik und Ergebnisse verschiedener Studien und vergleicht diese miteinander, um die Veränderungen und Kontinuitäten in der Small-World-Forschung aufzuzeigen.
- Milgrams "Small World"-Experiment und seine Methodik
- Vergleichende Analyse verschiedener "Small World"-Studien (Watts et al., Horvitz und Leskovec)
- Entwicklung und Veränderungen in der "Small World"-Forschung im Laufe der Zeit
- Rolle von Homophilie und Zentralität in sozialen Netzwerken im Kontext von "Small World"
- Bewertung der Ergebnisse und ihrer Bedeutung für die soziale Netzwerkforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema "Small World" ein, beginnt mit der Popularisierung des Begriffs im Kontext von Web 2.0 und verortet seinen Ursprung in Milgrams Arbeit aus den 1960er Jahren. Sie umreißt den Aufbau der Arbeit, die sich mit verschiedenen Studien zum "Small World"-Phänomen auseinandersetzt und Aspekte der sozialen Netzwerkforschung wie Zentralität und Homophilie berücksichtigt.
Kapitel I: Milgrams Untersuchungen: Milgrams Studie aus dem Jahr 1967 untersuchte die durchschnittliche Anzahl an Verbindungen zwischen zwei beliebigen Personen. Durch das Versenden von Paketen zwischen zufällig ausgewählten Personen in den USA versuchte Milgram zu zeigen, dass jeder jeden über eine kurze Kette von Bekanntschaften kennt. Obwohl nur ein Bruchteil der Pakete sein Ziel erreichte, zeigte die Studie einen durchschnittlichen Pfad von fünf Zwischenstationen. Die Ergebnisse belegten außerdem eine ausgeprägte Homophilie hinsichtlich des Geschlechts und der sozialen Klasse der beteiligten Personen. Milgrams Arbeit legte den Grundstein für die spätere Forschung zum "Small World"-Phänomen.
Kapitel II: Der nächste small-world-Versuch: Watts et al. führten eine ähnliche Studie durch, jedoch mit E-Mails statt Postsendungen. Sie rekrutierten über 60.000 Teilnehmer online und beauftragten sie, E-Mails an ausgewählte Zielpersonen in verschiedenen Ländern zu senden, wobei die Weiterleitung nur an gut bekannte Personen erlaubt war. Diese Studie erweiterte Milgrams Forschung, indem sie die Nutzung des Internets und globalere Netzwerke berücksichtigte, obwohl auch hier die Ergebnisse nicht vollständig repräsentativ waren.
Kapitel III: small-world-Forschung von Horvitz und Leskovec: Diese Studie analysiert ein riesiges Instant-Messaging-Netzwerk und liefert planetarische Einblicke in die Struktur und Dynamik sozialer Netzwerke. Die Ergebnisse zeigen, wie Informationen und Verbindungen in diesen riesigen Netzwerken verteilt sind und wie sich das "Small World"-Phänomen in diesen digitalen Kontexten manifestiert. Die Studie bietet neue Perspektiven auf die Skalierbarkeit des "Small World"-Phänomens.
Kapitel IV: Veränderungen in der small-world Forschung: Dieses Kapitel vergleicht die frühen "Small World"-Studien mit der modernen Forschung, hebt die Unterschiede in Methodik und Datengrundlage hervor und bewertet die Fortschritte in Bezug auf die Genauigkeit und Reichweite der Erkenntnisse. Es analysiert, inwieweit sich das Verständnis des "Small World"-Phänomens im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat und welche neuen Erkenntnisse gewonnen wurden.
Schlüsselwörter
Small World, soziale Netzwerkanalyse, Milgram, Watts, Horvitz, Leskovec, Homophilie, Zentralität, Degree-Zentralität, soziale Distanz, experimentelle Studien, soziale Netzwerkforschung, E-Mail, Instant Messaging.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument "Small World"-Forschung
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Das Dokument bietet eine umfassende Übersicht über die "Small World"-Forschung. Es beginnt mit Milgrams klassischer Studie aus den 1960er Jahren und verfolgt die Entwicklung des Forschungsfelds bis hin zu aktuellen Arbeiten, die riesige digitale Netzwerke analysieren. Der Fokus liegt auf der Methodik, den Ergebnissen und den Veränderungen im Verständnis des "Small World"-Phänomens über die Zeit.
Welche Studien werden im Detail untersucht?
Das Dokument analysiert im Detail folgende Studien: Milgrams "Small World"-Experiment mit Postsendungen, die Studie von Watts et al. mit E-Mails und die Forschung von Horvitz und Leskovec, die ein großes Instant-Messaging-Netzwerk untersuchte. Die Studien werden hinsichtlich ihrer Methodik, Ergebnisse und Bedeutung für das Gesamtverständnis des "Small World"-Phänomens verglichen.
Welche Methodik wurde in den verschiedenen Studien angewendet?
Milgram verwendete Postsendungen, um Pakete zwischen zufällig ausgewählten Personen in den USA zu senden. Watts et al. setzten E-Mails und eine größere Online-Stichprobe ein. Horvitz und Leskovec analysierten Daten aus einem riesigen Instant-Messaging-Netzwerk. Das Dokument hebt die Unterschiede in der Methodik und den Datengrundlagen der verschiedenen Studien hervor und diskutiert die Auswirkungen dieser Unterschiede auf die Ergebnisse.
Welche Schlüsselergebnisse werden präsentiert?
Milgrams Studie zeigte eine durchschnittliche Pfadlänge von fünf Zwischenstationen zwischen zwei beliebigen Personen. Watts et al. bestätigten das "Small World"-Phänomen auch in einem größeren, globalen Kontext, obwohl mit Einschränkungen hinsichtlich der Repräsentativität. Die Studie von Horvitz und Leskovec lieferte Einblicke in die Struktur und Dynamik von riesigen Online-Netzwerken und die Skalierbarkeit des "Small World"-Phänomens. Das Dokument vergleicht und kontrastiert die Ergebnisse der verschiedenen Studien.
Welche Rolle spielen Homophilie und Zentralität?
Das Dokument diskutiert die Rolle von Homophilie (die Tendenz, sich mit ähnlichen Personen zu vernetzen) und Zentralität (die Bedeutung eines Knotenpunkts im Netzwerk) in sozialen Netzwerken im Kontext des "Small World"-Phänomens. Milgrams Studie zeigte bereits eine ausgeprägte Homophilie. Die Analyse der Netzwerkstrukturen in den späteren Studien beleuchtet die Bedeutung von Zentralität für die Effizienz der Informationsverbreitung.
Wie hat sich die "Small World"-Forschung im Laufe der Zeit verändert?
Das Dokument zeigt die Entwicklung der "Small World"-Forschung von kleinen, experimentellen Studien mit begrenzter Reichweite hin zu Analysen riesiger digitaler Netzwerke. Es werden die Fortschritte in Bezug auf Methodik, Datengrundlage und die Genauigkeit der Erkenntnisse diskutiert. Die Veränderungen im Verständnis des Phänomens im Laufe der Zeit werden analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben das Thema?
Schlüsselwörter sind: Small World, soziale Netzwerkanalyse, Milgram, Watts, Horvitz, Leskovec, Homophilie, Zentralität, Degree-Zentralität, soziale Distanz, experimentelle Studien, soziale Netzwerkforschung, E-Mail, Instant Messaging.
- Quote paper
- Lars Roedel (Author), 2011, Das Phänomen Small-World., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198544