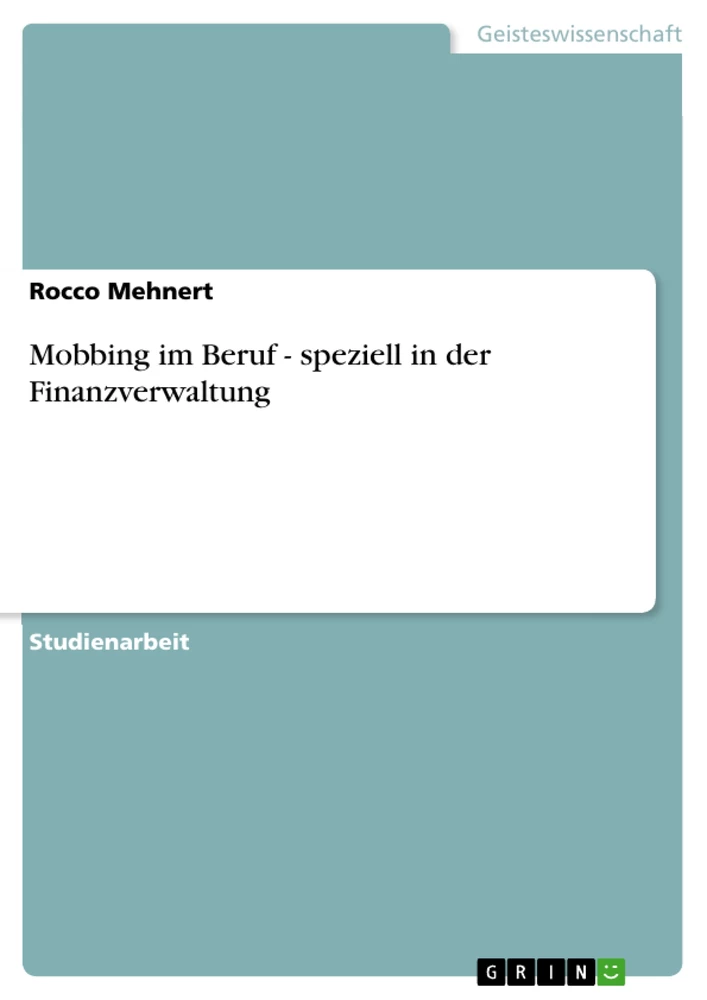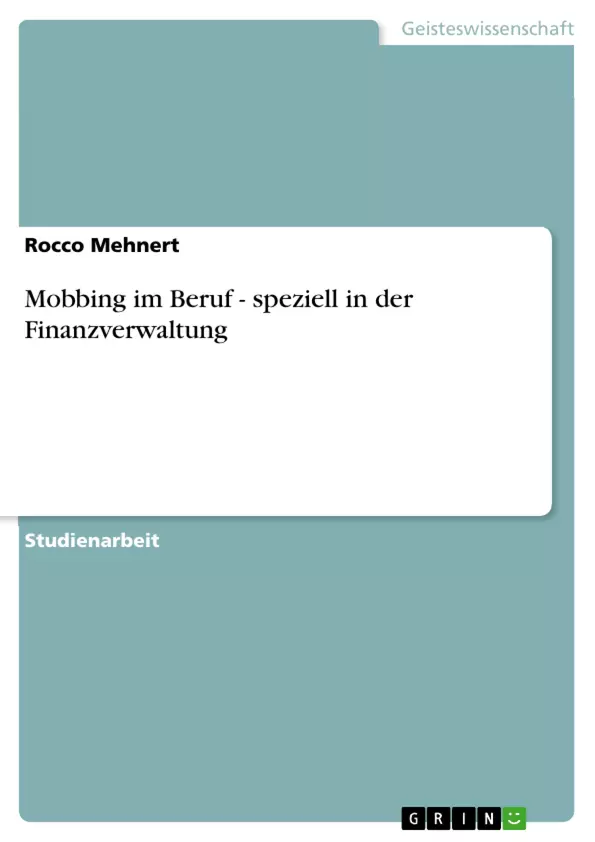„Mobbing“ als Wort ist aus dem deutschen Sprachgebrauch nicht
mehr weg zu denken. Leider wird es als Kunstwort, einer Modeerscheinung
gleich, viel zu oft und unangebracht verwendet. Dabei
beschreibt es die für Betroffene verheerendste Art einer meist einseitig
gefochtenen Konfliktkette mit wenig Chance auf Schlichtung.
Losgelöst von allen geflügelten „Pausenhof“-Verwendungen, wo
dieser Begriff als Verallgemeinerung von Schülerstreitigkeiten
steht, soll in dieser Arbeit auf die gesundheitlichen und betriebswirtschaftlichen
Folgen des Mobbing hingewiesen werden, speziell
im öffentlichen Dienst anhand des Beispiels Finanzverwaltung.
Mobbing existiert längst nicht nur in Schulklassen, sondern kann
allgegenwärtig in Erscheinung treten, wo harmonisierende
und/oder homogene Personengruppen und ein Individuum aufeinander
treffen, welches fremdes Verhalten zeigt. Somit tritt Mobbing
auch oder vor allem in der Arbeitswelt auf.
Inhaltsverzeichnis
1. Vorbemerkung
2. Definition
2.1. Unterschiede zwischen Mobbing und anderen Konflikten
2.2. Mobbing-Handlungen
2.3. Beweggründe
3. Verlauf und Inhalt des Geschehens
3.1. Altes Phasen-Modell nach Leymann
3.2. Neues Phasen-Modell nach Esser/Wolmerath
3.2.1. Vorlaufphase
3.2.2. Eigentliche Mobbingphase
3.2.3. Endzustand
3.3. Beteiligte und ihre Rolle
3.3.1. Staffing
3.3.2. Vertikales Mobbing
3.3.2.1. Bossing (Mobbing durch Vorgesetzte)
3.3.2.2. Mobbing gegen den Vorgesetzten
3.4. Cybermobbing als spezielles Phänomen
4. Folgen von Mobbing
4.1. Opfer
4.2. Mobber
4.3. Betrieb / Finanzverwaltung
4.4. Gesellschaft
5. Maßnahmen
5.1. Rechtslage
5.2. Intervention
5.2.1. Intervention seitens des Opfers
5.2.2. Intervention seitens Vorgesetzte / Kollegen
5.2.3. Intervention seitens Personal-/Betriebsrat
5.3. Prävention
5.3.1. Individuelle Prävention
5.3.2. Prävention seitens der Unternehmensführung
6. Schlussbemerkung
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Definition von Mobbing am Arbeitsplatz?
Mobbing beschreibt eine systematische, über einen längeren Zeitraum anhaltende Schikane gegen eine Person, die oft zu schweren psychischen und physischen Folgen führt.
Was ist der Unterschied zwischen "Bossing" und "Staffing"?
Bossing bezeichnet Mobbing durch Vorgesetzte gegen Untergebene, während Staffing Mobbing durch eine Gruppe von Mitarbeitern gegen einen Vorgesetzten beschreibt.
Welche Phasenmodelle des Mobbings gibt es?
Die Arbeit erläutert das klassische Modell nach Leymann sowie das neuere Phasen-Modell nach Esser/Wolmerath.
Welche Folgen hat Mobbing für die Finanzverwaltung?
Neben den gesundheitlichen Schäden für das Opfer entstehen hohe betriebswirtschaftliche Kosten durch Fehlzeiten, geringere Produktivität und Störungen im Betriebsklima.
Wie kann man Mobbing präventiv verhindern?
Durch eine offene Unternehmenskultur, klare Konfliktlösungsmechanismen, Schulungen für Vorgesetzte und eine aktive Rolle des Personalrats.
- Citar trabajo
- Rocco Mehnert (Autor), 2012, Mobbing im Beruf - speziell in der Finanzverwaltung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198670