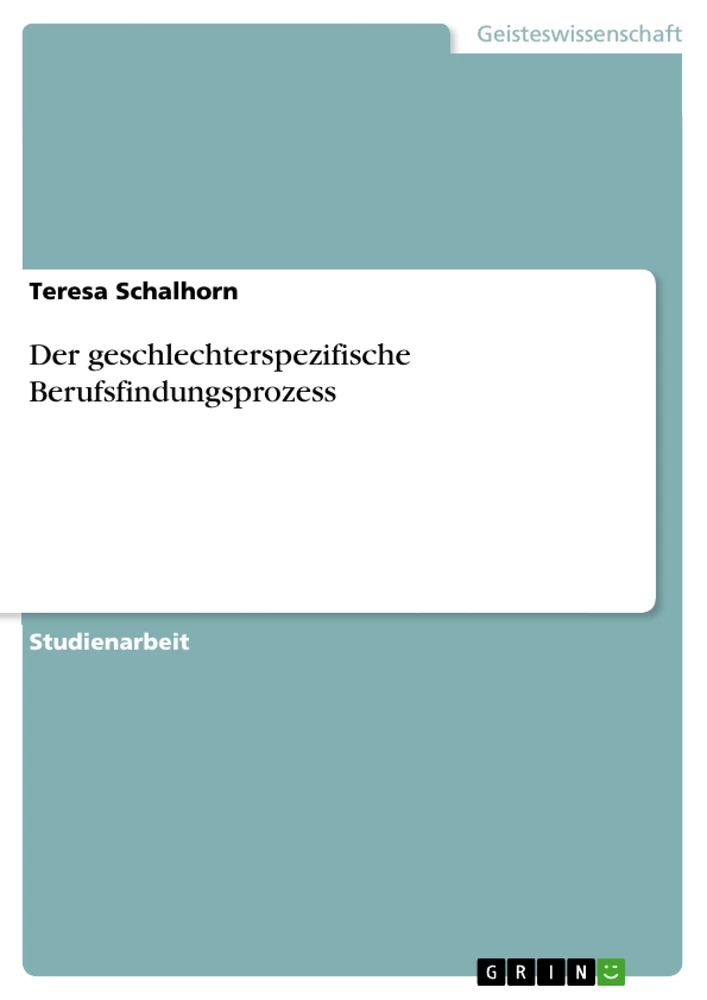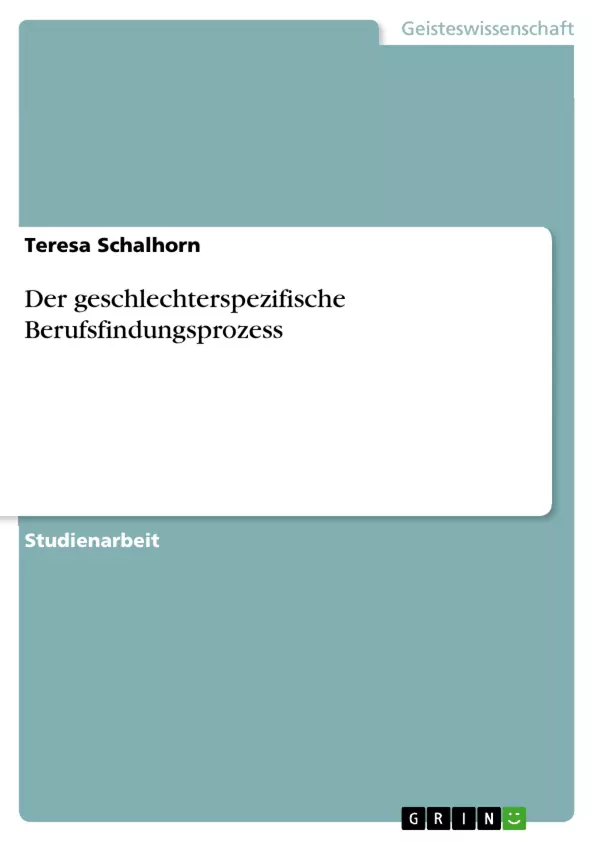"In den letzen Jahrzehnten hat sich die Lebensphase "junge Frau" verlängert, umstrukturiert und individualisiert." so Barbara Keddi in einem Aufsatz mit dem Titel Junge Frauen: Vom doppelten Lebensentwurf zum biografischen Projekt. Demnach unterlagen auch die Lebensentwürfe junger Frauen in den letzten Jahrzehnten einem stetigen Wandel. In vielerlei Hinsicht kann hier von einer Modernisierung gesprochen werden, jedoch bestehen dennoch auch trotz angestrebter Gleichberechtigung der Geschlechter tradierte Hierarchien und Disparitäten im Verhältnis der Geschlechter. Zwar entscheiden sich immer mehr Frauen für eine berufliche Selbstverwirklichung, doch nehmen sie dabei in Sachen Familie meist eine Doppelbelastung auf sich.
Vor dem gerade ausgeführten Hintergrund und der Tatsache, dass Mädchen und junge Frauen im Zuge der Bildungsexpansion im Durchschnitt besser abschneiden als altersgleiche Jungen bzw. junge Männer, scheint es unverständlich, dass Frauen weiterhin beim Übergang in die Berufswelt häufig in Berufe gelangen, welche als typische Frauenberufe bezeichnet und in Relation zu typischen Männerberufen eine schlechtere Bezahlung und nur geringen Aufstiegsmöglichkeiten aufweisen.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit versuche ich nun darzulegen, was die Berufswahl von Mädchen und jungen Frauen bedingt, indem ich den Berufsfindungsprozess und verschiedene diesen bedingende äußere Faktoren untersuche. Hierfür werde ich im Folgenden zunächst auf die veränderten Geschlechterverhältnisse eingehen und den "doppelten Lebensentwurf" junger Frauen thematisieren, bevor ich ausführlich auf den Berufsfindungsprozess junger Frauen und Mädchen, hierin besonders auf deren Stellung im Bildungs- und Ausbildungssystem, das gesellschaftliche Bild typischer Frauen- oder Männerberufe und Maßnahmen gegen diese Stereotypisierung eingehen werde. Letztlich werde ich die Auswirkungen der Sozialisationsinstanzen Schule und Eltern betrachten, um letztlich zu einem umfassenden abschließenden Fazit zur Betrachtung der Problematik zu kommen.
Gliederung
II. Hauptteil
1. Einleitung
2. Der Wegfall traditioneller Strukturen
3. Weibliche Lebensentwürfe und Berufsorientierungen
4. Mädchen und junge Frauen im Berufswahlprozess
4.1 Bildung und Ausbildung junger Frauen und Mädchen
4.2 Frauenberufe und Männerberufe?
4.3 Die Initiative "Girlsday": Maßnahmen zur Erweiterung des Berufsspektrums
5. Die Sozialisationsinstanzen Eltern und Schule
6. Fazit
III. Literaturverzeichnis
II. Hauptteil
1. Einleitung
"In den letzen Jahrzehnten hat sich die Lebensphase "junge Frau" verlängert, umstrukturiert und individualisiert."[1] so Barbara Keddi in einem Aufsatz mit dem Titel Junge Frauen: Vom doppelten Lebensentwurf zum biografischen Projekt. Demnach unterlagen auch die Lebensentwürfe junger Frauen in den letzten Jahrzehnten einem stetigen Wandel. In vielerlei Hinsicht kann hier von einer Modernisierung gesprochen werden, jedoch bestehen dennoch auch trotz angestrebter Gleichberechtigung der Geschlechter tradierte Hierarchien und Disparitäten im Verhältnis der Geschlechter.[2] Zwar entscheiden sich immer mehr Frauen für eine berufliche Selbstverwirklichung, doch nehmen sie dabei in Sachen Familie meist eine Doppelbelastung auf sich.
Vor dem gerade ausgeführten Hintergrund und der Tatsache, dass Mädchen und junge Frauen im Zuge der Bildungsexpansion im Durchschnitt besser abschneiden als altersgleiche Jungen bzw. junge Männer, scheint es unverständlich, dass Frauen weiterhin beim Übergang in die Berufswelt häufig in Berufe gelangen, welche als typische Frauenberufe bezeichnet und in Relation zu typischen Männerberufen eine schlechtere Bezahlung und nur geringen Aufstiegsmöglichkeiten aufweisen.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit versuche ich nun darzulegen, was die Berufswahl von Mädchen und jungen Frauen bedingt, indem ich den Berufsfindungsprozess und verschiedene diesen bedingende äußere Faktoren untersuche. Hierfür werde ich im Folgenden zunächst auf die veränderten Geschlechterverhältnisse eingehen und den "doppelten Lebensentwurf"[3] junger Frauen thematisieren, bevor ich ausführlich auf den Berufsfindungsprozess junger Frauen und Mädchen, hierin besonders auf deren Stellung im Bildungs- und Ausbildungssystem, das gesellschaftliche Bild typischer Frauen- oder Männerberufe und Maßnahmen gegen diese Stereotypisierung eingehen werde. Letztlich werde ich die Auswirkungen der Sozialisationsinstanzen Schule und Eltern betrachten, um letztlich zu einem umfassenden abschließenden Fazit zur Betrachtung der Problematik zu kommen.
2. Der Wegfall traditioneller Strukturen
Die demographischen, sozioökonomischen und soziokulturellen Veränderungen der letzten Jahrzehnte wirkten sich vor allem auf die Lebenszusammenhänge und Entwürfe von Frauen aus. Auf diese Weise trat zu Gunsten weiblicher Erwerbsarbeit vermehrt die Familie als Versorgungsinstanz der Frau in den Hintergrund.[4] Ebenso hat sich die Lebensphase des frühen Erwachsenenalters für Mädchen und junge Frauen grundlegend umstrukturiert, bzw. darüber hinaus verlängert und individualisiert. Sie reicht heute bis ins vierte Lebensjahrzehnt hinein, was letztlich bedeutet, dass auch das Ende des Jugendzeitalters als Start für ein planbares zukünftiges Leben nicht mehr zutrifft.
Sichtbar wird dies auch an der deutlichen zeitlichen Ausdehnung der schulischen und darüber hinaus beruflichen Ausbildung, d.h. das der beruflichen Existenz, demnach auch einem erfolgreichen Berufsstart junger Frauen eine viel größere Wichtigkeit beigemessen wird.[5]
Ebenso bedingt hierdurch wird letztlich die Phase der Familiengründung, da diese so ebenfalls eine Verschiebung auf spätere Jahre erfährt. Traditionelle Strukturen wie die lebenslange Versorgerehe befinden sich im Wegfall. Junge Frauen sehen sich Zunehmens als emanzipiert und Männern gleichgestellt, auch deshalb gilt es Karriere zu machen und selbstständig zu sein. Ebenso bestehen jedoch gleichzeitig noch Rudimente tradierter Hierarchien im Geschlechterverhältnis. So reproduziert sich die soziale Ungleichheit der Geschlechter letztlich doch immer wieder und führt so besonders auf dem Sektor der Berufsfindung und Familiengründung wiederkehrend zu Ungleichheitserfahrungen junger Frauen[6] So ist es trotz moderner Arbeitsteilung der Geschlechter in Paarbeziehung meist die Frau, welcher der Hauptteil der Hausarbeit zufällt, da diese zum Wohle der intakten Beziehung und des Familiensinnes häufiger zurücksteckt.[7] In diesem Zusammenhand kann treffend von der Illusion der Emanzipation gesprochen werden.
3. Weibliche Lebensentwürfe und Berufsorientierungen
Auf Grund der oben genannten Veränderungen sind die Optionen der Lebensgestaltung von Mädchen und jungen Frauen vielfältiger geworden, zudem scheint es jedoch ebenso notwenig geworden sich für einen bestimmten Weg zu entscheiden. Andernfalls gilt es, Familie und Beruf gleichzeitig zu leben. Diese doppelte Vergesellschaftung und der damit einhergehende doppelte Lebensentwurf stellt ein scheinbar unlösbares Dilemma dar und führt letztlich dazu, dass mit der Zuständigkeit für die Versorgung von Kindern konfrontiert, die individuelle Lebensplanung junger Frauen ihre Grenzen findet.[8] Häufig kommt es deshalb zu unterschiedlichen biographischen Schwerpunktsetzungen junger Frauen, indem diese sich temporären privaten Projekten zuschreiben. Lebensentscheidungen sind zunächst nie ad hoc getroffene Entschlüsse, sondern allenfalls Konstruktionen in noch wagen Lebensentwürfe. Hierbei steht die individuelle Entscheidung das eigene Leben eher dem Beruf oder der Familie widmen zu wollen, stets als "versteckter Sinn" im Hintergrund.[9] Konkret verfolgen demnach junge Frauen in unterschiedlichen Lebenszusammenhängen und -phasen unterschiedliche Projekte. Barbara Keddi ordnet diese in die Felder Liebe, Beruf, Kinder, Selbstentwicklung und politische Partizipation ein.[10]
Auf diese Weise wird die Zwickmühle Karriere oder Familie von den Frauen selbst kompensiert, bzw. werden Bewältigungsmöglichkeiten in den Lebenslauf eingebaut. Dennoch bedeutet diese Individualisierung keineswegs weniger Strukturzwang bzw. mehr Autonomie, sondern vielmehr ein provisorischer Rückgriff auf persönliche Sinnkonstruktionen und die individuelle Handlungsfähigkeit.
4. Mädchen und junge Frauen im Berufswahlprozess
"Generell gilt heute für alle jungen Frauen, dass der Beruf die Basis für ihr Leben darstellt"[11] Im Lebensentwurf junger Frauen spielt daher der Beruf meist eine zentrale Rolle. Die Berufswahl und der Berufseinstieg können hierbei als Bestandteil der Auseinandersetzung junger Frauen mit Strukturen, normativen Vorgaben und kollektiven Lebensentwürfen[12] gesehen werden.
4.1 Bildung und Ausbildung junger Frauen und Mädchen
Im Rahmen der Bildungsreform der 60iger Jahre des vergangenen Jahrhunderts konnte die Beteiligung der Mädchen in Bildung und Ausbildung grundlegend gesteigert werden. Mittlerweile sind an weiterführenden Schulen nicht nur ebenso viele Mädchen wie Jungen vertreten, vielmehr übertreffen die Mädchen im Durchschnitt gar die Jungen bezüglich der Höhe des Bildungsabschlusses. Jedoch scheint die Umsetzung dieser höheren Bildungsabschlüsse in berufliche Platzierungen schwer.[13]
Auffallend ist hierbei jedoch die schulische Fächerwahl bzw. Fachrichtung. So belegen Mädchen viel häufiger die Leistungskurse Deutsch, Englisch oder Biologie. Jungen hingegen setzen ihren Schwerpunkt meist jedoch auf rein naturwissenschaftlich-technische Fächer wie Mathematik oder Physik. Diese Systematik zeigt sich auch bei anderen Schultypen, da beispielsweise an technischen Fachgymnasien eine höhere Anzahl an Männern verzeichnet werden kann und auch auf dem Sektor der Fachoberschulen der Zweig des Sozialwesens stärker weiblich besetzt ist, hingegen der Zweig der technischen Fachrichtungen jedoch von Männern dominiert wird.[14] Blickt man nun auf das Ausbildungssystem so verhält es sich mit der Wahl der Ausbildungsberufe ähnlich.
Trotz besserer Schulbildung und erhöhtem Qualifikationsniveau sind die Berufsperspektiven junger Frauen und Mädchen auf dem Arbeitsmarkt letztlich weiterhin schlechter als für ihre männlichen Kollegen. So orientieren sich viele Mädchen auf ein kleines Berufsspektrum, das der "frauentypischen Berufe", welche meist auf dem Büro- und Dienstleistungssektor zu finden sind. Auch in gehobenen Berufen sind Frauen zudem unterrepräsentiert. Beispielhaft kann hier der Anteil der Professorinnen gesehen werden, welcher zwischen 1988 und 1994 bei lediglich 6% lag, obwohl der Anteil an Habilitationen im gleichen Zeitraum von 26 auf 29% stieg.[15]
Letztlich wirft diese Betrachtung auch die Frage auf, inwieweit typische Frauen- oder Männerberufe existieren und wie diese zu ihrem jeweiligen Status gekommen sind.
4.2 Frauenberufe und Männerberufe?
Stets gibt es Berufe, die scheinbar typischerweise von Frauen oder Männern ausgeübt werden. Die heutigen "Frauenberufe" im Bereich des Sozialwesens entstanden hierbei meist dadurch, dass vormals ehrenamtliche Berufe und in der Familie ausgeübte Tätigkeiten eine Professionalisierung erfuhren. Ebenso gibt es Berufe, die einen Geschlechtswechsel durchlebten.[16] Beispielhaft können hier Berufe in Büro und Handel genannt werden, welche nun zu den modernen Frauenberufen gehören.
Die Einteilung in Frauen- und Männerberufe erfolgt des weiteren meist anhand traditioneller Zuordnungen. Schon allein die Bezeichnung in der deutschen Sprache, denke man nur an die Krankenschwester, aber den Dachdecker, ist hierfür sinnbildlich. Statistisch gesehen hingegen, müsste man nach der Anzahl von Frauen und Männern in den jeweiligen Berufsgruppen gehen. Auffallend bei dieser Betrachtung ist, dass es hiernach eine geringere Vielzahl an typisch weiblichen Berufen gibt[17], was letztlich meine Ausführungen zur Ausbildungsplatzwahl junger Frauen und Mädchen ebenso wieder spiegelt, wie die Tatsache, dass sich diese Berufe auf den Sektor der personenbezogenen Dienstleistungen beschränken. Zudem bieten die meisten Frauenberufe trotz Weiterbildungsmöglichkeiten keine Aufstiegschancen, was sie zu regelrechten "Sackgassenberufen"[18] macht.
Mädchen und junge Frauen arrangieren sich mit der Realität und passen sich ihr an. Sie versuchen nicht, die Gegebenheiten passend zu machen oder darauf zu warten, bis sie die für sie passenden gefunden haben. Sie wollen die Chance zum Eintritt in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt nicht verpassen. Als Orientierung dienen Frauen, die im Berufsleben stehen. Dadurch dass der Frauenanteil in einem Beruf groß ist, wird davon ausgegangen, dass Frauen die Anforderung wie Erwerbstätigkeit und gleichzeitige Versorgung der Familie gelingt. Weiter kann davon ausgegangen werden, dass für Frauen in diesen Berufen reelle Ausbildungs- und Einstellungschancen bestehen, dass Frauen hier Ansprüche auf soziale Kontakte, Arbeitsinhalte und Kommunikation an einen Arbeitsplatz erfüllt finden und dass sie ihre Fähigkeiten einbringen können.
Dagegen gibt es bei Mädchen und jungen Frauen durchaus realistische Vorstellungen von Diskriminierungen und Benachteiligungen, denen Frauen in Männerberufen ausgesetzt sind.
Vor diesem Hintergrund wirkt eine Rolle als Einzelkämpferin in einer Männerdomäne alles andere als einladend.[19]
4.3 Die Initiative "Girlsday": Maßnahmen zur Erweiterung des Berufsspektrums
Doch gibt es auch immer wieder Frauen, welche sich für "frauenuntypische" Berufe beispielsweise in der Metall- oder Elektrobranche interessieren, welche sich jedoch besonders anstrengen und mancherlei Hürden überwinden müssen, um eine anerkannte Position ausüben zu können.[20]
[...]
[1] Vgl. Keddi, Barbara, Junge Frauen, Vom doppelten Lebensentwurf zum biografischen Projekt, in: Becker, Ruth/ Kortendiek, Beate (Hrsg.): Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung. Theorie, Methoden, Empirie, Wiesbaden 2004, S. 378-383, hier S. 378
[2] Vgl ebd.
[3] Vgl. Keddi, Barbara, S. 379.
[4] Vgl Nissen, Ursula, Keddi, Barbara, Pfeil, Patricia, Berufsfindungsprozesse von jungen Mädchen und Frauen, Wiesbaden 2003, S. 13.
[5] Vgl. ebd.
[6] Vgl. Keddi, Barbara, S. 378.
[7] Vgl. ebd., S. 379.
[8] Vgl. ebd.
[9] Vgl.ebd., S. 380.
[10] Vgl. ebd.
[11] Nissen, Ursula, Keddi, Barbara, Pfeil, Patricia, S. 20.
[12] Vgl. ebd., S. 22.
[13] Vgl. ebd., S. 25f.
[14] Vgl. ebd., S. 27.
[15] Vgl. Bolz, Pia, Mädchen und junge Frauen im Berufsfindungsprozess, Frankfurt am Main 2004, S. 9.
[16] Vgl. Nissen, Ursula, Keddi, Barbara, Pfeil, Patricia, S. 45.
[17] Vgl. ebd., S. 46.
[18] Vgl. ebd., S. 51.
[19] Vgl. Lemmermöhle, Doris, Wir werden was wir wollen. Schulische Berufsorientierung (nicht nur) für Mädchen. Traumberufe, Berufswünsche, Berufe, Hrsg. Ministerium für die Gleichstellung von Frau und Mann des Landes NRW, Düsseldorf 1991, S. 32f.
[20] Morschhäuser, Martina, Integration und Ausgrenzung von Frauen in Männerberufen, Aachen 1997, S. 2.
Häufig gestellte Fragen
Warum wählen junge Frauen oft „typische Frauenberufe“?
Dies liegt häufig an gesellschaftlichen Stereotypen, Einflüssen durch das Elternhaus und einer geschlechtsspezifischen Fächerwahl in der Schule, die soziale Berufe gegenüber technischen bevorzugt.
Was versteht man unter dem „doppelten Lebensentwurf“?
Er beschreibt das Bestreben junger Frauen, sowohl eine erfolgreiche berufliche Karriere als auch eine erfüllte Familienarbeit (Kindererziehung, Haushalt) gleichzeitig zu realisieren.
Haben Mädchen heute bessere Schulabschlüsse als Jungen?
Statistiken zeigen, dass Mädchen im Durchschnitt höhere Bildungsabschlüsse erreichen, diese jedoch seltener in entsprechend hochbezahlte oder technische Berufspositionen ummünzen.
Was ist das Ziel des „Girls' Day“?
Der Girls' Day soll das Berufswahlspektrum erweitern und Mädchen für Berufe in den Bereichen Technik, IT und Naturwissenschaften (MINT) begeistern.
Welche Rolle spielen Eltern im Berufsfindungsprozess?
Eltern fungieren als zentrale Sozialisationsinstanz; ihre eigenen Rollenbilder und Erwartungen prägen oft unbewusst die Berufsentscheidungen ihrer Kinder.
- Citation du texte
- Teresa Schalhorn (Auteur), 2007, Der geschlechterspezifische Berufsfindungsprozess, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198760