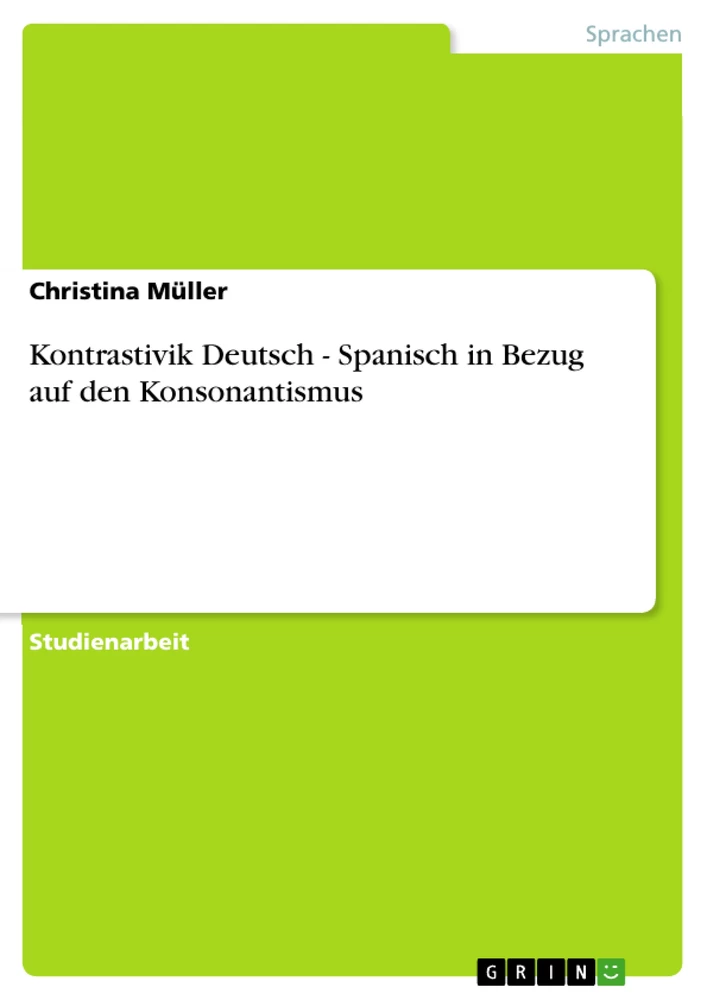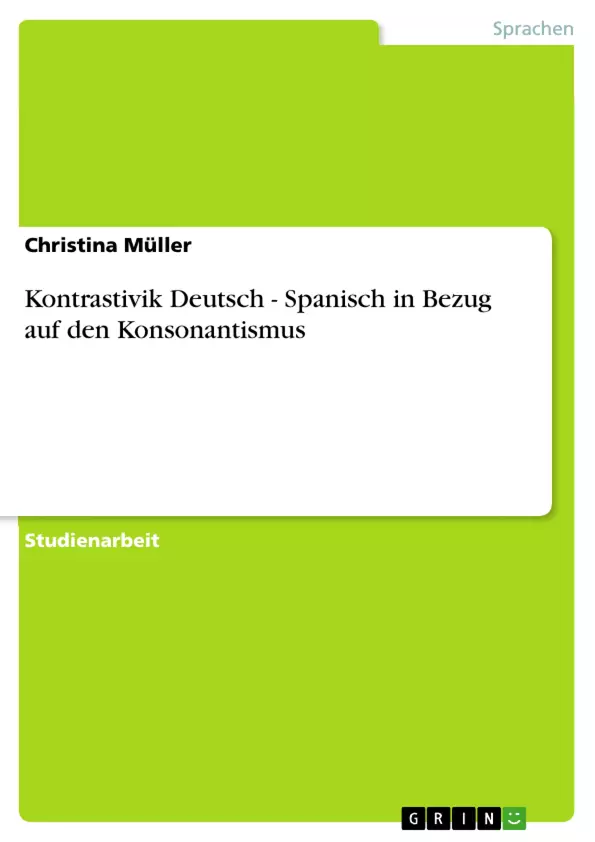In meiner Hausarbeit werde ich vergleichend den Konsonantismus des Spanischen und des Deutschen präsentieren und dabei besonders auf die phonologischen und phonetischen Unterschiede eingehen sowie am Ende eine didaktische Analyse anbringen. Durch Beispiele aus beiden Sprachen sollen diese Unterschiede nicht nur klar werden, sondern ich möchte auch sich daraus ergebende Kommunikationsschwierigkeiten verdeutlichen.
Kontrastivik Deutsch- Spanisch in Bezug auf den Konsonantismus
In meiner Hausarbeit werde ich vergleichend den Konsonantismus des Spanischen und des Deutschen präsentieren und dabei besonders auf die phonologischen und phonetischen Unterschiede eingehen sowie am Ende eine didaktische Analyse anbringen. Durch Beispiele aus beiden Sprachen sollen diese Unterschiede nicht nur klar werden, sondern ich möchte auch sich daraus ergebende Kommunikationsschwierigkeiten verdeutlichen.
1.) Der spanische Konsonantismus
Der spanische Konsonantismus ist gekennzeichnet durch 20 (im lateinamerikanischen Spanisch 18) konsonantische Phoneme, die gewisse Besonderheiten aufweisen. So treten manche Oppositionen vereinzelt auf, andere dagegen korrelieren. Zu den vereinzelt auftretenden Oppositionen gehört die Quantitätsopposition, die nur bei dem Vibranten vorhanden ist. Diese Quantitätsopposition gibt es nur intervokalisch, initial und final gibt es nur [rr] und präkonsonantisch kommt nur [r] vor. Wie die Vibranten stehen auch die Afrikata und die Lateralen allein. Präkonsonantisch und final existiert die Opposition der Lateralen l/ l nicht, nur initial und intervokalisch kommt diese vor. Nur durch eine Opposition (q/s) ist die Opposition dental vs. alveolar gekennzeichnet. Oppositionen, die vernetzt sind, sind die Nasale, Frikative und Okklusive, die im ganzen Mundraum vertreten sind, wodurch die Korrelationen /p/ zu /f/ zu /m/ und /t/ zu /q, s/ zu /n/ existieren. Des Weiteren korrelieren alle Okklusive durch die Sonoritätsopposition p: b wie t: d wie k: g, die es vor Konsonanten allerdings nicht gibt, denn dort sind diese nicht austauschbar.
2.) Der deutsche Konsonantismus
Das System des deutschen Konsonantismus umfasst die folgenden 24 Phoneme: /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /m/, /n/, /n/, /r/, /f/, /v/, /s/, /z/, / /, / /, /ç/, /j/, /x/, /h/, /pf/, /ts/,
/t / und /d /. Die Okklusive, Nasale und Frikative sind fast im gesamten Mundraum vertreten, wobei es die Korrelation /b/: /m/ und /d/: /n/: /l/: /r/: /z/ gibt. Die Laterale und Vibranten stehen vereinzelt.
Die Konsonanten [p, t, k] werden aspiriert. Nach stimmlosen Konsonanten, also
[p, t, k, f, s, ,ç , x, pf, ts, t ] sind [b, d, g, v, z, , j, d ] stimmlos.
Nach langem Vokal kann [r] nur als Zäpfchen- R ([ R ]) oder als schwaches geriebenes R ([ ]) gesprochen werden, denn gerolltes Zungenspitzen- R ([r]) kommt in dieser Stellung nicht vor, z.B.: er [e:r] und Tiere [ti:re].
Nach langem Vokal kann [r] am Wortende oder vor Konsonant durch [ ] ersetzt werden, wie bei er [e:r] > [e: ].
3.) Phonologische Unterschiede
( Unterschiede in Bezug auf Phonembestand, Allophonie, Neutralisation, Distribution)
In Bezug auf den Phonembestand unterscheiden sich die Konsonantensyteme des Deutschen und des Spanischen mengenmäßig betrachtet kaum: zum spanischen System gehören 20 (Lateinamerika 18) und zum deutschen 21 Konsonanten. Beide Sprachen besitzen sechs Okklusivphoneme, von denen jeweils drei stimmhaft und drei stimmlos sind. Gemeinsam haben sie auch das bilabiale /m/ und das alveolar artikulierte /n/, jedoch unterscheiden sie sich in einem Nasal, dem im Spanischen palatalem /ñ / und im Deutschen velar gebildeten / /.
Im frikativen Bereich zeigen sich allerdings größere Unterschiede, da diese Kategorie im Spanischen weniger Phoneme hat als das Deutsche: Frikative im Spanischen sind /f/, /q/, /s/, /j/ und /x/, wohingegen beim Deutschen /f/, /v/, /s/, /z/, / /, / /, /ç/, /j/, /x/ und /h/ Frikative sind. Die Längenopposition bei der Aussprache, die im Deutschen bedeutungsunterscheidend ist, spielt in der spanischen Sprache keine Rolle. Ein Beispiel hierzu ist: lassen und lasen (also unterschiedlich lang artikuliertes /a/ führt zu verschiedenen Bedeutungen in Verbindung mit dem Konsonant s/ss) oder bei rate und Ratte. Das deutsche glottale /h/ ist im Spanischen nur als regionale Variante von /c/ zu finden. Charakteristisch für das deutsche /r/ ist die uvulare Aussprache und die starke Neigung zur Vokalisierung am Silbenende, wohingegen das Spanische für das /r/ zwei Aussprachevarianten kennt [r] und [rr]. Das deutsche Phonem /v/ fehlt im Spanischen, da es als [b] realisiert wird. Die im Deutschen existente Distinktion zwischen den Phonemen /s/ und /z/ ist dem Spanischen unbekannt. Allerdings gibt es im Spanischen zwei Laterale (l, l), im Gegensatz zum Deutschen, wo nur das /l/ zu finden ist.
Die stimmlosen Okklusive (p/t/k) im Spanischen werden nicht wie im Deutschen aspiriert: [thath] (deutsch) und [tinto] (spanisch).
Unterschiedlich ist auch die Lautgruppierung zu Silben, da im Spanischen die Kombination [st] bzw. [sp] im Silbenanglitt unüblich ist, im Deutschen jedoch praktiziert wird: [kons/ti/tu/'qjon] ist die Trennung im Spanischen, im Vergleich dazu ist dies die des Deutschen: [kon/sti/tu/'tsjo:n]. Die Realisierung der Phoneme variiert ebenso, denn z.B. das [s] wird im Deutschen prädorsal- alveolar und im Spanischen apiko- alveolar realisiert.
Im Spanischen gibt es mehr Allophone als im Deutschen, da im Deutschen z.B. die Längenquantität redundant ist im Gegensatz zum Spanischen. So stellen im Spanischen [b] und [ß] lediglich Aussprachevarianten dar, sind somit nicht distinktiv, was man z.B. an [bino] und [ßino] merkt, jedoch ist die Distribution dieser geregelt (s. unten). Ebenso sind [s] und [z] Allophone des Spanischen : es macht keinen Unterschied, ob [dos] oder [doz] realisiert wird, wohingegen die Substitutionsprobe im Deutschen zeigt, dass [sehen] eine andere Bedeutung hat als [Zehen], /s/ und /z/ also Phoneme des Deutschen sind, keine Allophone.
Ebenfalls als Allophon kann man [s] und [q] werten, da die Verwendung einer Möglichkeit nur noch eine regionale Variante darstellt, die nicht distinktiv ist, was man an der folgenden Kommutationsprobe sehen kann: [qaragoqa] ist, von der Bedeutung her, nichts anderes als [saragosa].
Im Deutschen gibt es dieses Phänomen der unterschiedlichen "s"- Varianten nicht.
Bei den Oppositionen wie /r/, /rr/ und /l/, /l/ oder /m/, /n/,/n/ handelt es sich zwar um einzelne Phoneme, jedoch findet in bestimmten Kontexten eine Neutralisation statt.
Solch ein Archiphonem ist z.B. /T/, das für /t,d/ steht, da es die gemeinsamen Merkmale der beiden enthält und durch [ð] vertreten wird: [aðlas], das /aTlas/ oder /aDlas/ entspricht. Die Abschwächung durch Assimilation an den folgenden Konsonanten führt ebenso bei /p:b/ und /k:g/ zur Neutralisierung wie im oben genannten Beispiel bei /t:d/, denn die Okklusive werden zu Frikativen.
Ein anderes Beispiel hierzu ist, da das Zusammentreffen von n und b im Spanischen unüblich sind und die Nasale /n/ und /m/ an den folgenden Konsonanten assimiliert werden, dass dann [um' poko] transkribiert und realisiert wird, durch das Archiphonem ausgedrückt wäre dies dann /uN' poko/.
Gut zu sehen ist die Neutralisierung auch bei "en" in Verbindung zu anderen Wörtern, wobei es sich an den Artikulationsort des nachfolgenden Konsonanten angleicht: z.B. [embilßao] oder [enqewta].
Im Deutschen ist die Entsonorisierung ein gutes Beispiel für Neutralisation, denn hierbei wird im Wortauslaut die im Inlaut existierende Opposition zwischen stimmhaften und stimmlosen Konsonanten ( [mie:dn-mie:tn] )aufgehoben, da final nur stimmlose Konsonanten realisiert werden ( [ba:t] für Bad und bat).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptunterschiede im Konsonantensystem von Deutsch und Spanisch?
Deutsch besitzt 24 Konsonantenphoneme, Spanisch etwa 20. Ein großer Unterschied liegt in der Aspiration (Hauchlaut) der Laute p, t, k, die im Spanischen fehlt.
Gibt es das deutsche "v" im Spanischen?
Nein, das Phonem /v/ fehlt im Spanischen und wird meist als [b] oder [ß] realisiert, was oft zu Schwierigkeiten beim Erlernen des Deutschen führt.
Was ist der Unterschied bei der Aussprache des "r"?
Im Deutschen wird das "r" oft uvular (im Rachen) gesprochen oder vokalisiert. Im Spanischen gibt es zwei Varianten: das einfache [r] und das stark gerollte [rr].
Was bedeutet "Auslautverhärtung" im Deutschen?
Im Deutschen werden stimmhafte Konsonanten am Wortende stimmlos gesprochen (z. B. wird "Bad" wie "Bat" ausgesprochen). Dieses Phänomen ist dem Spanischen fremd.
Warum haben Spanier oft Probleme mit Wörtern wie "Schule" oder "Stadt"?
Im Spanischen sind Konsonantenverbindungen wie [st] oder [sp] am Wortanfang unüblich; Spanier setzen oft instinktiv ein "e" davor (z. B. "E-Stufe").
- Citar trabajo
- Christina Müller (Autor), 2006, Kontrastivik Deutsch - Spanisch in Bezug auf den Konsonantismus, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199065