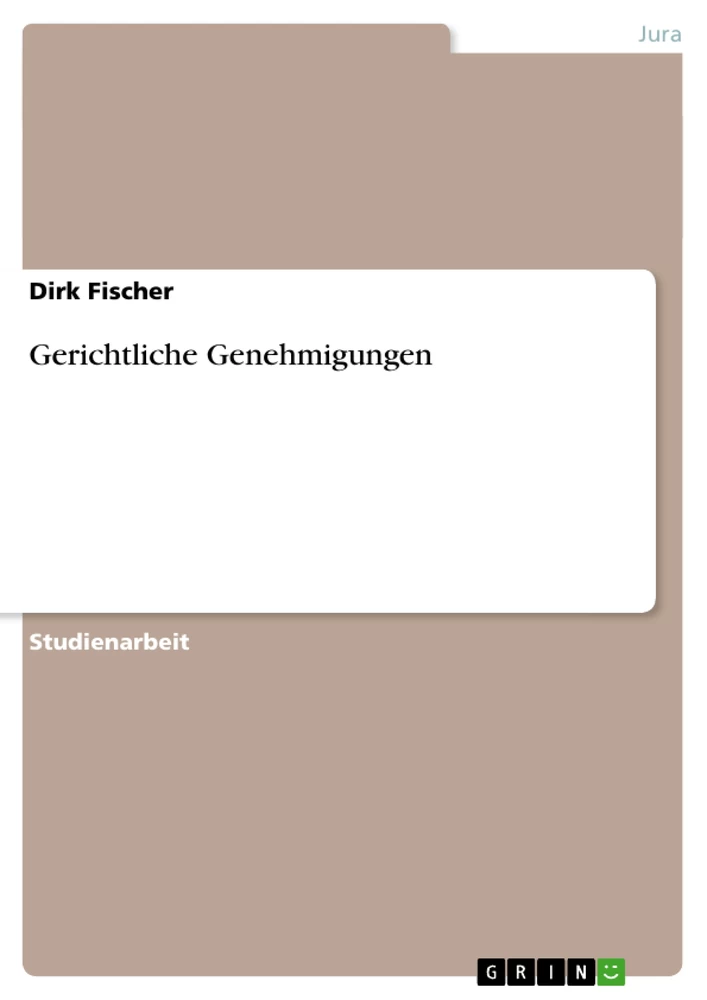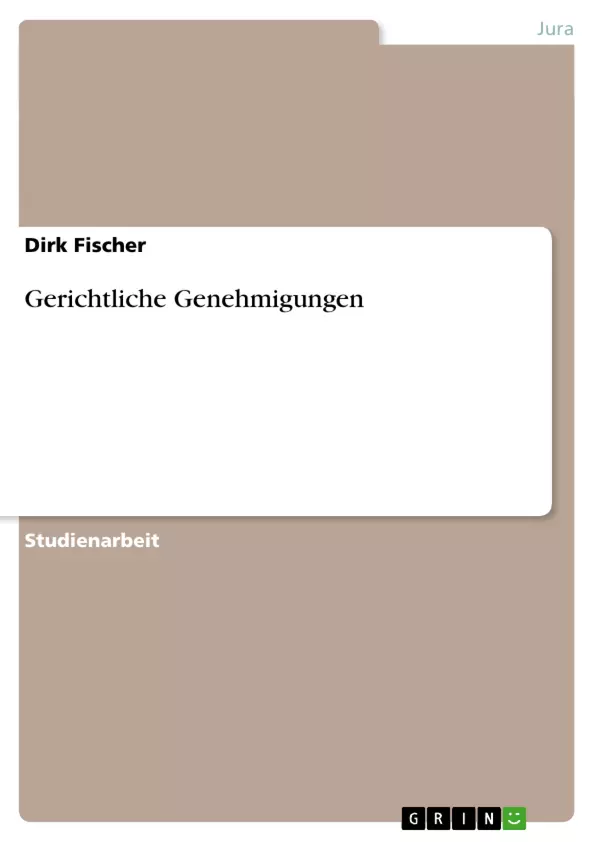1. Elterliche Sorge
Der Minderjährige ist nach §§ 1, 104 Nr.1 BGB nicht geschäftsfähig oder nach
§§ 1, 106 BGB nur beschränkt geschäftsfähig und bedarf darum zum rechtswirksamen
Handeln in seinem Namen eines gesetzlichen Vertreters, der den
Minderjährigen gerichtlich und außergerichtlich vertritt. Steht der Minderjährige
unter elterlicher Sorge, so sind beide Elternteile gemäß § 1629 I S.2, 1.HS
BGB kraft Gesetz grundsätzlich gesamtvertretungsberechtigt oder ein Elternteil
ist allein vertretungsberechtigt (§ 1629 S.3 BGB), wenn er die elterliche
Sorge allein ausübt oder ihm im Einzelfall die Entscheidung gemäß § 1628
BGB bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den Eltern allein übertragen
worden ist.
2. Vormundschaft
Steht der Minderjährige nicht unter elterlicher Sorge oder sind die Eltern weder
in den die Person noch in den das Vermögen betreffenden Angelegenheiten
zur Vertretung berechtigt (§ 1773 I BGB) oder ist der Familienstand des Minderjährigen
nicht ermittelbar (§ 1773 II BGB), so hat das Vormundschaftsgericht
von Amts wegen gemäß § 1774 S.1 BGB die Vormundschaft anzuordnen.
Damit steht die Vormundschaft in einem totalen Ergänzungsverhältnis zur
elterlichen Sorge.1 So erklärt sich auch eine weitgehend gleiche Regelung der
Rechte und Pflichten des Vormunds bzw. der Eltern. Nach § 1793 I S.1 BGB
vertritt der Vormund als gesetzlicher Vertreter den Minderjährigen grundsätzlich
unbeschränkt, also gerichtlich und außergerichtlich. 3. Rechtliche Betreuung
Kann eine natürliche Person2 (§ 1 BGB) aufgrund einer psychischen Krankheit
oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten
teilweise oder ganz nicht besorgen, so bestellt das Vormundschaftsgericht
zu ihrem Schutz auf ihren Antrag oder von Amts wegen gemäß
§ 1896 BGB einen Betreuer. Grundsätzlich können nur Volljährige (§ 2 BGB)
unter rechtliche Betreuung nach § 1896 I S.1 BGB gestellt werden.3
[...]
1 Vgl. Gernhuber/ Coester-Waltjen, Lehrbuch des Familienrechts, 4. Aufl., § 70 I 1.
2 Vor der Geburt werden die Rechte aufgrund elterlicher Sorge wahrgenommen, oder aber bei nicht
durch elterliche Sorge erfassten Rechte durch einen Pfleger für die Leibesfrucht nach § 1912 BGB.
3 Nach § 1908 a BGB kann die rechtliche Betreuung auch für Siebzehnjährige angeordnet werden,
wenn davon auszugehen ist, dass sie bei Eintritt der Volljährigkeit erforderlich ist. Die rechtliche
Betreuung wird dann automatisch mit Eintritt der Volljährigkeit wirksam.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Vormundschafts- und familiengerichtliche Genehmigungen
- I. Gerichtliche Zuständigkeit der Genehmigungsverfahren
- II. Rechtsnatur der vormundschafts-/ familiengerichtlichen Genehmigungen
- III. Erklärung der Genehmigung
- IV. Voraussetzungen für die Erteilung der Genehmigung
- V. Genehmigungsverfahren
- VI. Zeitpunkt der Genehmigung
- VII. Gegenstand und Umfang der Genehmigung
- VIII. Bedingte Genehmigung
- IX. Form der Genehmigung und Negativattest
- X. Doppelbevollmächtigung
- XI. Befreiungen von der Genehmigungspflicht
- C. Einzelne Genehmigungstatbestände im Grundstücksverkehr
- I. Eigentum und eigentumsgleiche Rechte mit Kind/ Mündel/ Betreuten als Eigentümer bzw. Veräußerer
- II. Eigentum und eigentumsgleiche Rechte mit Kind/ Mündel/ Betreuten als Erwerber
- III. Lasten, Belastungen und Beschränkungen mit Kind/ Mündel/ Betreuten als Eigentümer
- IV. Kind/ Mündel/ Betreute als Berechtigte von Lasten und Belastungen
- V. Vollmacht für Dritte
- VI. Prüfung durch das Grundbuchamt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Beschränkung der Vertretungsmacht durch gerichtliche Genehmigungsverfahren im Familienrecht. Sie beleuchtet die Unterschiede zwischen gesetzlichen Vertretern wie Eltern, Vormündern und Betreuern. Der Fokus liegt auf den rechtlichen Aspekten der Genehmigungsprozesse und ihrer Anwendung im Grundstücksverkehr.
- Unterschiede in der Vertretungsmacht zwischen Eltern, Vormündern und Betreuern
- Rechtliche Voraussetzungen und Verfahren für gerichtliche Genehmigungen
- Anwendungsfälle im Grundstücksverkehr (Erwerb, Veräußerung, Belastung von Grundstücken)
- Relevanz der gerichtlichen Kontrolle zum Schutz des Minderjährigen/Betreuten
- Die Rolle des Grundbuchamtes bei der Prüfung von Genehmigungen
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Beschränkung der Vertretungsmacht durch gerichtliche Genehmigungsverfahren ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie benennt die verschiedenen Arten der gesetzlichen Vertretung und kündigt die detaillierte Untersuchung der Unterschiede und Besonderheiten an, die im weiteren Verlauf der Arbeit behandelt werden. Der Fokus auf den Grundstücksverkehr wird bereits hier als zentraler Aspekt der Arbeit hervorgehoben.
B. Vormundschafts- und familiengerichtliche Genehmigungen: Dieses Kapitel analysiert umfassend die rechtlichen Grundlagen und Verfahren der gerichtlichen Genehmigungen. Es erörtert die Zuständigkeiten der Gerichte, die Rechtsnatur der Genehmigungen, die notwendigen Voraussetzungen für deren Erteilung, und das detaillierte Genehmigungsverfahren selbst, inklusive der Anhörung und des Rechtsmittels. Die verschiedenen Zeitpunkte der Genehmigung (Vor-, Nachgenehmigung), deren Gegenstand und Umfang, sowie die Form der Genehmigung (inkl. Negativattest) werden eingehend untersucht. Besonderheiten wie die bedingte Genehmigung und die Doppelbevollmächtigung, sowie Ausnahmen von der Genehmigungspflicht werden ebenfalls behandelt. Dieses Kapitel stellt somit den rechtlichen Rahmen für die nachfolgende Betrachtung einzelner Genehmigungstatbestände dar.
C. Einzelne Genehmigungstatbestände im Grundstücksverkehr: Dieses Kapitel befasst sich mit der konkreten Anwendung der gerichtlichen Genehmigungen im Grundstücksverkehr. Es wird zwischen den Fällen unterschieden, in denen das Kind/Mündel/Betreute als Eigentümer bzw. Veräußerer, als Erwerber und als Berechtigter von Lasten und Belastungen auftritt. Für jeden Fall werden zahlreiche Einzelheiten und Besonderheiten des Genehmigungsbedarfs erläutert, beispielsweise bei Grundstücksvereinigung, -teilung, Veräußerung an Dritte, Erwerb im Wege der Erbfolge, Belastung mit dinglichen Rechten oder der Zustimmung zu Rangrücktritten. Die Rolle des Grundbuchamtes bei der Prüfung der eingereichten Genehmigungen wird ebenso ausführlich dargestellt, wobei die Prüfung bei bewilligter Eintragung nach §19 GBO und die Prüfung der Einigung nach §20 GBO besonders hervorgehoben werden. Der Umfang dieses Kapitels zeigt die Komplexität des Themas im Kontext des Grundstücksrechts.
Schlüsselwörter
Beschränkung der Vertretungsmacht, gerichtliche Genehmigung, Familienrecht, elterliche Sorge, Vormundschaft, rechtliche Betreuung, Grundstücksverkehr, Grundbuchamt, Genehmigungspflicht, Minderjährigenschutz, Rechtsfähigkeit.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Beschränkung der Vertretungsmacht durch gerichtliche Genehmigungsverfahren im Familienrecht
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Beschränkung der Vertretungsmacht von gesetzlichen Vertretern (Eltern, Vormündern, Betreuern) durch gerichtliche Genehmigungsverfahren, insbesondere im Kontext des Grundstücksverkehrs. Sie beleuchtet die Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten der gesetzlichen Vertretung und analysiert die rechtlichen Aspekte der Genehmigungsprozesse.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Unterschiede in der Vertretungsmacht zwischen Eltern, Vormündern und Betreuern, die rechtlichen Voraussetzungen und Verfahren für gerichtliche Genehmigungen, Anwendungsfälle im Grundstücksverkehr (Erwerb, Veräußerung, Belastung von Grundstücken), die Relevanz der gerichtlichen Kontrolle zum Schutz des Minderjährigen/Betreuten und die Rolle des Grundbuchamtes bei der Prüfung von Genehmigungen.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in drei Kapitel: Einleitung, Vormundschafts- und familiengerichtliche Genehmigungen und Einzelne Genehmigungstatbestände im Grundstücksverkehr. Die Einleitung führt in das Thema ein. Kapitel B analysiert die rechtlichen Grundlagen und Verfahren der gerichtlichen Genehmigungen. Kapitel C befasst sich mit der konkreten Anwendung im Grundstücksverkehr.
Was wird im Kapitel "Vormundschafts- und familiengerichtliche Genehmigungen" behandelt?
Dieses Kapitel untersucht die gerichtliche Zuständigkeit, die Rechtsnatur der Genehmigungen, die Voraussetzungen für deren Erteilung, das Genehmigungsverfahren, den Zeitpunkt der Genehmigung, Gegenstand und Umfang, bedingte Genehmigungen, die Form der Genehmigung (inkl. Negativattest), Doppelbevollmächtigungen und Befreiungen von der Genehmigungspflicht.
Was wird im Kapitel "Einzelne Genehmigungstatbestände im Grundstücksverkehr" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die Anwendung der Genehmigungen im Grundstücksverkehr, wenn das Kind/Mündel/Betreute als Eigentümer/Veräußerer, Erwerber oder Berechtigter von Lasten und Belastungen auftritt. Es betrachtet Grundstücksvereinigung, -teilung, Veräußerung an Dritte, Erwerb im Wege der Erbfolge, Belastung mit dinglichen Rechten oder die Zustimmung zu Rangrücktritten und die Rolle des Grundbuchamtes bei der Prüfung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Hausarbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Beschränkung der Vertretungsmacht, gerichtliche Genehmigung, Familienrecht, elterliche Sorge, Vormundschaft, rechtliche Betreuung, Grundstücksverkehr, Grundbuchamt, Genehmigungspflicht, Minderjährigenschutz und Rechtsfähigkeit.
Für wen ist diese Hausarbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Juristen, Studierende des Rechts, Mitarbeiter von Vormundschaftsgerichten und Notaren sowie alle, die sich mit den rechtlichen Aspekten der Vertretung Minderjähriger und Betreuter im Grundstücksverkehr befassen.
Wo finde ich weitere Informationen zu diesem Thema?
Weitere Informationen können in der einschlägigen Rechtsliteratur zum Familienrecht und Grundstücksrecht gefunden werden. Es wird empfohlen, die aktuelle Rechtsprechung zu konsultieren.
- Quote paper
- Dirk Fischer (Author), 2003, Gerichtliche Genehmigungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19912