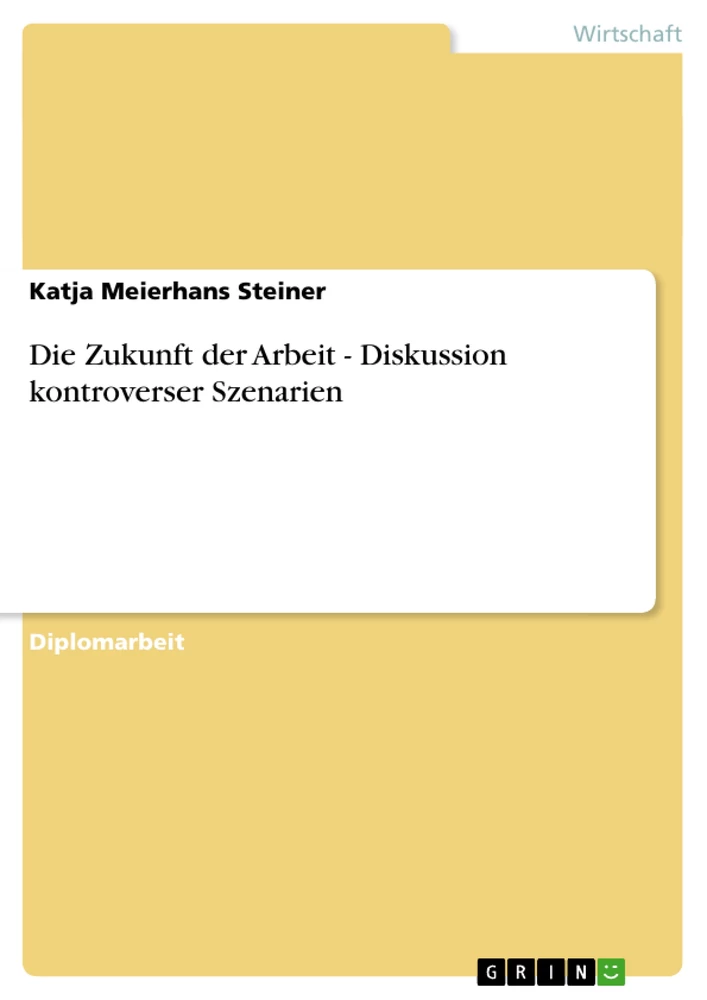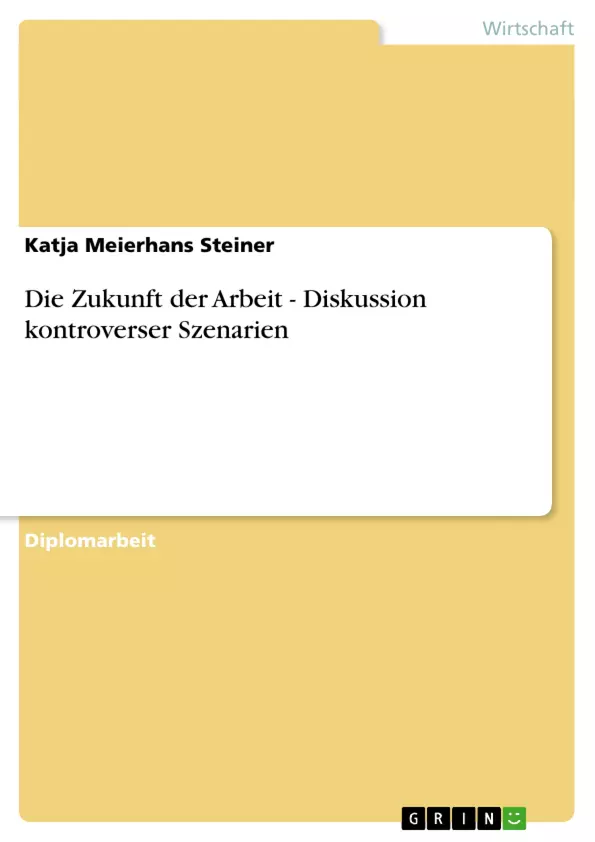«Die einzig verbliebene Gottheit?» – so ist ein Artikel zum Tag der Arbeit
2003 übertitelt (Geisel 2003). Die Religion ist in der säkularen Moderne
zunehmend aus dem öffentlichen Leben verschwunden, geblieben ist jedoch
die protestantische Arbeitsethik, die den Fleissigen in den Gnadenstand
erhebt und dem Faulen den göttlichen Wohlgefallen verweigert.
Die Moralisierung der Arbeit hat eine Eigendynamik entwickelt und sich
verselbständigt: Die Arbeit hat sich von dem höheren Sinn, dem Dienst zu
Ehren und im Auftrag Gottes, gelöst und ist selbst zum Sinn geworden.
Gorz (2000, S. 82) diagnostiziert einen gar Arbeitsfetischismus, an dem
unsere Gesellschaft obsessiv festhält, obwohl bereits heute und noch weniger
in Zukunft allen eine entlohnte Arbeit an einem festen Arbeitsplatz
zugänglich sein wird. Die Erwerbsarbeit als Quelle persönlicher Identität,
sozialer Integration und Anerkennung, gesellschaftlichen Zusammenhalts
und als strukturierendes Element des Zeitablaufs erscheint unter dieser
Voraussetzung akut gefährdet.
Welche Bedeutung hat die
Arbeit für unsere Gesellschaft?
Was sind nun die Folgen der Heiligsprechung der Arbeit, in einer Zeit, in
der 4,3 Millionen Deutsche von Arbeitslosigkeit betroffen sind und die Zukunftsprognosen
keine Besserung verheissen, ausser vielleicht einer gewissen
Linderung durch die demografische Alterung in den nächsten zwanzig
Jahren? Wie sieht die Zukunft der Arbeit aus, wenn der technologische
Fortschritt nur noch jobless growth verheisst und die Vollbeschäftigung
nicht wiederkehrt? Wie kann der soziale Zusammenhalt gesichert werden,
wenn eine sinkende Zahl Erwerbstätiger das Auskommen aller anderen
durch private und staatlich vorgegebene Transferleistungen bestreiten
muss?
Was, wenn die
Vollbeschäftigung nicht
zurückkehrt?
Die gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Aspekte sind das eine,
doch wie werden die organisationalen und individuellen Arbeitsbedingungen
der zukünftigen «Jobholders» aussehen? Welche Qualifikationen werden
benötigt? Wie wirkt sich die Flexibilisierung von Arbeitsverhältnissen
und die verstärkte Zurechnung von Unternehmensergebnissen auf kleinere
Einheiten bis hinunter zum einzelnen Mitarbeiter aus? Wie sieht es mit der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus? Werden diejenigen, die eine Stelle
haben, tendenziell überfordert und überarbeitet sein, während die Stellenlosen
mit den psychischen und sozialen Folgen des Ausschlusses aus der
Arbeitswelt kämpfen? [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zukunft der Arbeit - Übergang oder Untergang?
- Vorgehen und Gliederung
- Rund um den Arbeitsbegriff
- Etymologie und Semantik
- Historische Entwicklung des Arbeitsbegriffs
- Vorbemerkung
- Antikes Griechenland
- Jüdisch-christliche Tradition: Altes Testament
- Christliches Mittelalter
- Neues Testament und frühes Christentum
- Reformation: Protestantisches Arbeits- und Berufsethos
- Industrialisierung: Smith, Hegel und Marx
- Erkenntnisse und Folgerungen: Der Stellenwert der Arbeit heute
- Arbeit heute: Diagnosen und Trends
- Vorbemerkung
- Ökonomischer Bereich
- Neue Welthandelsordnung
- Neue internationale Finanzordnung
- Unternehmensphilosophie: zunehmende Orientierung am Shareholder Value
- Veränderungen im Verhältnis zwischen den Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit
- Veränderungen in den Wirtschaftssektoren: Tertiarisierung
- Rolle der Gewerkschaften
- Technologischer Bereich
- Gesellschaftlicher Bereich
- Individualisierung
- Erwerbsbeteiligung
- Freiwilligenarbeit
- Demografie
- Organisation und Individuum
- Flexible Organisations- und Arbeitsformen
- Arbeitstypen der Zukunft
- Erosion der Normalarbeit
- Kritik
- Natürliche Ressourcen und Nachhaltigkeit
- Kontroverse Szenarien zur Zukunft der Arbeit
- Szenarien als Instrument zur Modellierung von Entwicklungspfaden und Zukunftsbildern
- Strukturierung
- Neoliberales Referenzszenario: Globalisierung als Chance
- Beschreibung
- Alternativszenario: Vergesellschaftung jenseits der Erwerbsarbeit
- Voraussetzung
- Beschreibung
- Kritik
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Zukunft der Arbeit in Deutschland und analysiert verschiedene Szenarien, die die Arbeitswelt in den kommenden Jahren prägen könnten. Das Ziel ist es, einen kritischen Blick auf die Herausforderungen und Chancen der zukünftigen Arbeitswelt zu werfen und die Auswirkungen auf verschiedene gesellschaftliche Ebenen zu beleuchten.
- Entwicklung des Arbeitsbegriffs und dessen Bedeutung für die Gesellschaft
- Analyse der aktuellen Situation der Arbeit in Deutschland vor dem Hintergrund ökonomischer, technologischer und gesellschaftlicher Veränderungen
- Kontroverse Szenarien zur Zukunft der Arbeit, insbesondere die Auswirkungen von Globalisierung und technologischem Fortschritt
- Bewertung der Folgen für Unternehmen, Beschäftigte und die Gesellschaft
- Diskussion möglicher Lösungsansätze für die Herausforderungen der zukünftigen Arbeitswelt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Zukunft der Arbeit ein und beleuchtet die Bedeutung des Arbeitsbegriffs in der heutigen Gesellschaft. Sie stellt die These auf, dass die Erwerbsarbeit zunehmend an Bedeutung verliert und neue Herausforderungen für Unternehmen, Beschäftigte und die Gesellschaft entstehen.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der historischen Entwicklung des Arbeitsbegriffs. Es werden verschiedene Epochen und deren Einfluss auf die Arbeit beleuchtet, von der Antike über das Mittelalter bis hin zur Industrialisierung. Dabei werden auch wichtige Denker wie Adam Smith, Georg Wilhelm Friedrich Hegel und Karl Marx in den Fokus gerückt.
Kapitel 3 untersucht die aktuelle Situation der Arbeit in Deutschland. Es werden verschiedene Bereiche beleuchtet, darunter die ökonomischen, technologischen und gesellschaftlichen Veränderungen, die die Arbeitswelt prägen. Hierbei wird beispielsweise die Globalisierung, die zunehmende Digitalisierung und der demografische Wandel thematisiert.
In Kapitel 4 werden verschiedene Szenarien zur Zukunft der Arbeit vorgestellt und analysiert. Es wird das neoliberale Referenzszenario der Globalisierung als Chance und ein Alternativszenario der Vergesellschaftung jenseits der Erwerbsarbeit diskutiert.
Schlüsselwörter
Zukunft der Arbeit, Arbeitsbegriff, Arbeitsethik, Globalisierung, Digitalisierung, Technologie, Demografie, Flexibilisierung, Jobless Growth, Erwerbsarbeit, Szenarien, Neoliberalismus, Vergesellschaftung, Nachhaltigkeit, Unternehmen, Beschäftigte, Gesellschaft
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Begriff "Arbeitsfetischismus"?
Nach Andre Gorz bezeichnet dies das obsessive Festhalten der Gesellschaft an Erwerbsarbeit als Hauptquelle für Identität und Integration, obwohl diese für viele nicht mehr zugänglich ist.
Was ist "jobless growth"?
Es beschreibt ein Wirtschaftswachstum, das durch technologischen Fortschritt erzielt wird, ohne dass dabei neue Arbeitsplätze entstehen oder die Vollbeschäftigung zurückkehrt.
Welchen Einfluss hatte die Reformation auf unser heutiges Arbeitsverständnis?
Die protestantische Arbeitsethik erhob Fleiß in den Gnadenstand und prägte das Ethos, Arbeit als innerweltliche Berufung und moralische Pflicht zu sehen.
Was ist das neoliberale Referenzszenario der Globalisierung?
Dieses Szenario sieht die Globalisierung als Chance, bei der durch Marktöffnung und Wettbewerb neue Qualifikationen und flexible Arbeitsformen zu Wohlstand führen.
Welche Alternativen zur reinen Erwerbsarbeit werden diskutiert?
Diskutiert wird die "Vergesellschaftung jenseits der Erwerbsarbeit", die Tätigkeiten wie Freiwilligenarbeit, familiäre Sorgearbeit und lebenslanges Lernen stärker aufwertet.
- Citation du texte
- Katja Meierhans Steiner (Auteur), 2003, Die Zukunft der Arbeit - Diskussion kontroverser Szenarien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19918