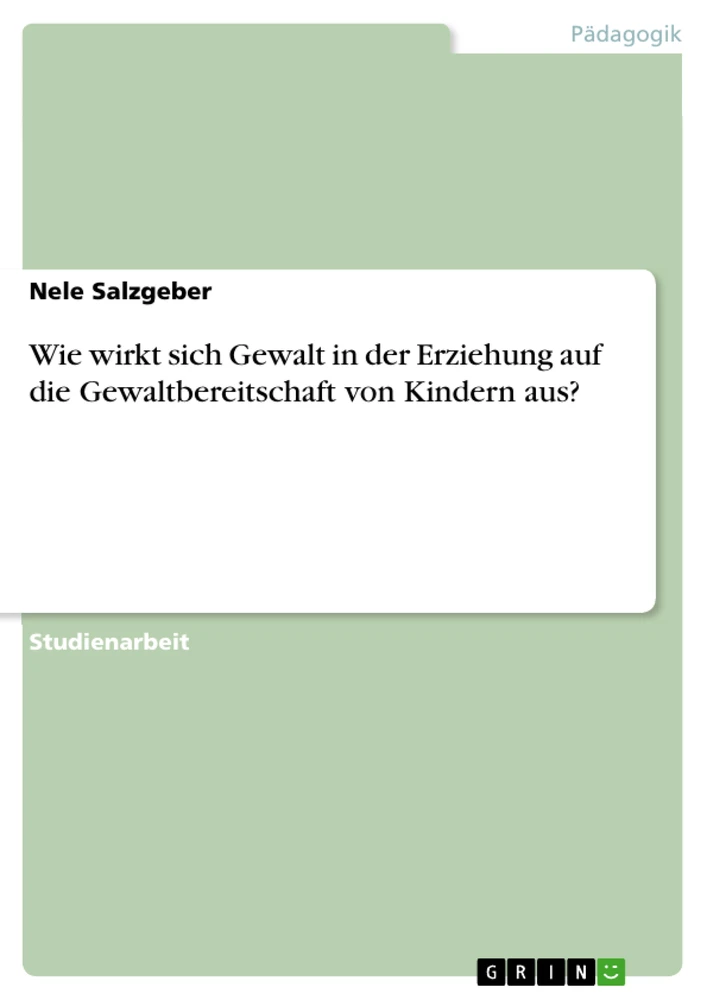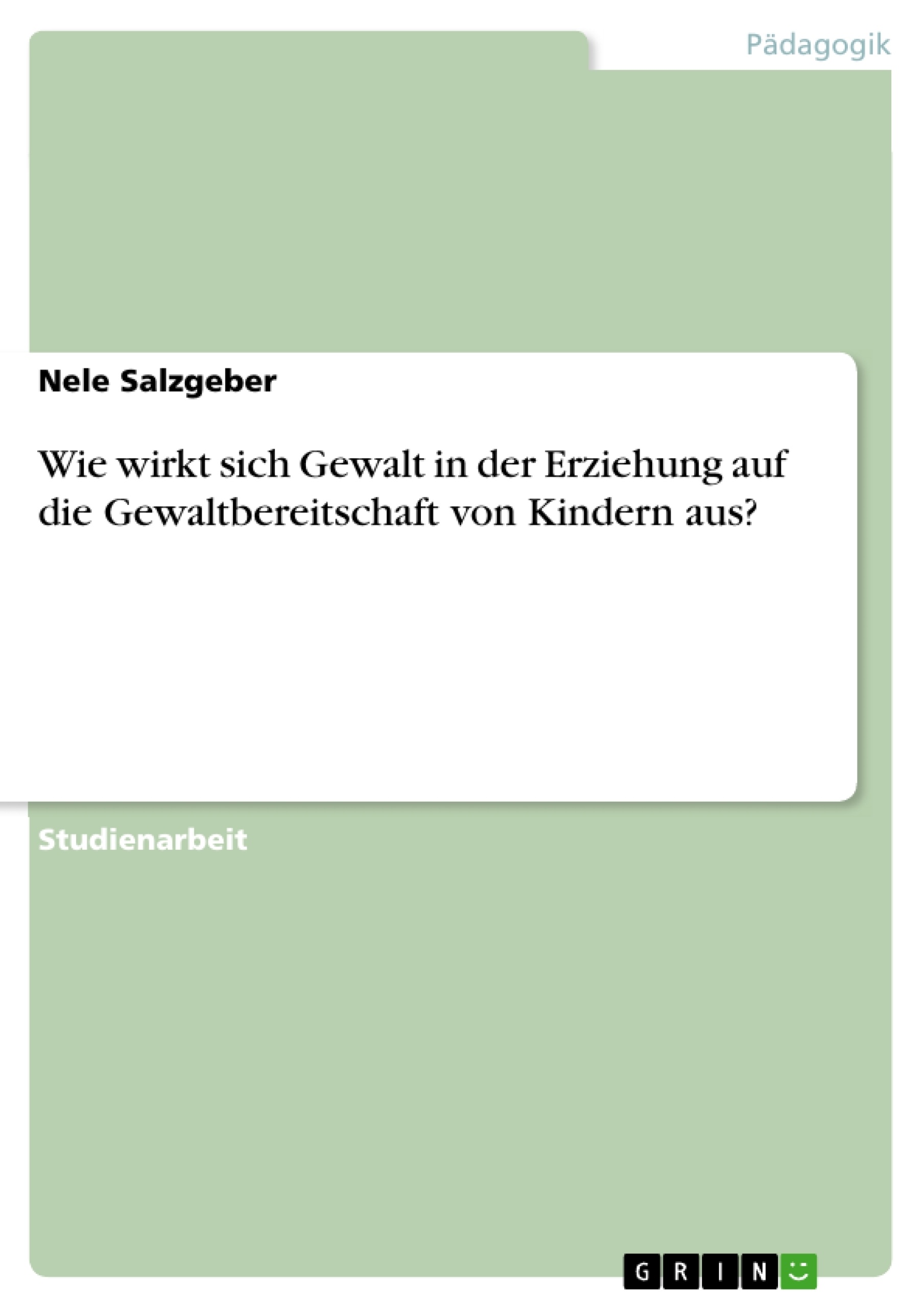„Kinder schlagen Kinder“, „Die Kriminalität unter Kindern nimmt immer mehr zu“, wenn man Zeitungen und Internet durchforstet stößt man immer häufiger auf solche oder ähnliche Nachrichten. Dass Kinder nicht mal vor dem Töten der eigenen Mutter zurückschrecken, zeigt der jüngste Fall in Amerika, wobei da die Umstände noch nicht geklärt sind.
Und wir alle erinnern uns sicher noch an den Amoklauf in Winnenden.
Seit diesen Nachrichten stellen sich Politiker, aber auch viele andere Leute die Frage, woran es liegt, dass Kinder zu Täter werden...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Soziale Entwicklung von Kindern
- Überblick: Gewalt in der Erziehung
- Wo kommt Gewalt unter Kindern vor?
- Welche Art von Gewalt kommt unter Kindern vor?
- Ursachen der Gewaltbereitschaft
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert den Einfluss von Gewalt in der Erziehung auf die Gewaltbereitschaft von Kindern. Sie zielt darauf ab, das komplexe Zusammenspiel zwischen sozialer Entwicklung, Gewaltformen und Ursachen für aggressive Verhaltensweisen bei Kindern aufzuzeigen.
- Soziale Entwicklung und Beziehungen zwischen Kind und Pflegeperson
- Verschiedene Formen von Gewalt in der Erziehung
- Häufigkeit und Erscheinungsformen von Gewalt unter Kindern
- Faktoren, die die Gewaltbereitschaft von Kindern beeinflussen
- Die rechtliche Situation und das Recht des Kindes auf gewaltfreie Erziehung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas dar und verweist auf aktuelle Beispiele, die die Problematik von Gewalt in der Erziehung und deren Auswirkungen auf die Gewaltbereitschaft von Kindern verdeutlichen. Sie führt den Leser in das Thema ein und skizziert den Aufbau der Hausarbeit.
Soziale Entwicklung
Dieses Kapitel beleuchtet die soziale Entwicklung von Kindern, insbesondere die Bedeutung von Beziehungen zu Pflegepersonen, dem Einfluss des familiären Umfelds und der Interaktion mit Gleichaltrigen. Es beschreibt die Entstehung von Bindungen und die Entwicklung von sozialen Kompetenzen.
Überblick: Gewalt in der Erziehung
Das Kapitel gibt einen Überblick über verschiedene Formen von Gewalt in der Erziehung, wie körperliche Bestrafung, seelische Misshandlung und Vernachlässigung. Es wird die rechtliche Situation beleuchtet und das Recht des Kindes auf eine gewaltfreie Erziehung erläutert.
Wo kommt Gewalt unter Kindern vor?
Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Situationen, in denen Gewalt zwischen Kindern vorkommt, und beleuchtet die Ursachen und die Folgen. Es geht auf unterschiedliche soziale Kontexte und Einflussfaktoren ein.
Welche Art von Gewalt kommt unter Kindern vor?
Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf der Analyse verschiedener Arten von Gewalt, die Kinder untereinander anwenden, wie körperliche Gewalt, verbale Beleidigung und Mobbing. Die Folgen dieser Verhaltensweisen für die beteiligten Kinder werden erläutert.
Ursachen der Gewaltbereitschaft
Das Kapitel beleuchtet die Ursachen für die Gewaltbereitschaft von Kindern, indem es auf verschiedene Faktoren wie familiäre und soziale Einflüsse, mediale Einflüsse, psychische Belastungen und Lerntheorien eingeht.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit dem komplexen Thema der Gewalt in der Erziehung und ihrer Auswirkungen auf die Gewaltbereitschaft von Kindern. Schwerpunkte bilden die soziale Entwicklung, verschiedene Formen von Gewalt, die Ursachen und Folgen von Gewalt in der Erziehung sowie die rechtliche Situation. Weitere zentrale Begriffe sind kindliche Entwicklung, soziale Interaktionen, Bindung, Familienstrukturen, Aggressionsverhalten und die Bedeutung einer gewaltfreien Erziehung.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst Gewalt in der Erziehung die Kinder?
Erlebte Gewalt in der Familie erhöht das Risiko, dass Kinder selbst aggressives Verhalten entwickeln, da sie Gewalt als legitimes Mittel zur Konfliktlösung erlernen.
Welche Formen von Gewalt in der Erziehung gibt es?
Man unterscheidet zwischen körperlicher Bestrafung, seelischer Misshandlung (z.B. Demütigung) und Vernachlässigung der grundlegenden Bedürfnisse des Kindes.
Gibt es ein Recht auf gewaltfreie Erziehung?
Ja, in Deutschland ist das Recht des Kindes auf eine gewaltfreie Erziehung gesetzlich verankert. Körperliche Bestrafungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.
Welche Rolle spielen Medien bei der Gewaltbereitschaft?
Mediale Einflüsse können bestehende Aggressionstendenzen verstärken, sind aber meist nur einer von vielen Faktoren neben dem familiären und sozialen Umfeld.
Warum werden Kinder zu Tätern?
Häufige Ursachen sind instabile Bindungen zu Bezugspersonen, psychische Belastungen, soziale Ausgrenzung und das Vorbildverhalten im direkten Umfeld.
Was ist Mobbing unter Kindern?
Mobbing ist eine Form psychischer Gewalt, bei der ein Kind über einen längeren Zeitraum systematisch von Gleichaltrigen schikaniert, ausgegrenzt oder beleidigt wird.
- Quote paper
- Nele Salzgeber (Author), 2011, Wie wirkt sich Gewalt in der Erziehung auf die Gewaltbereitschaft von Kindern aus?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199233