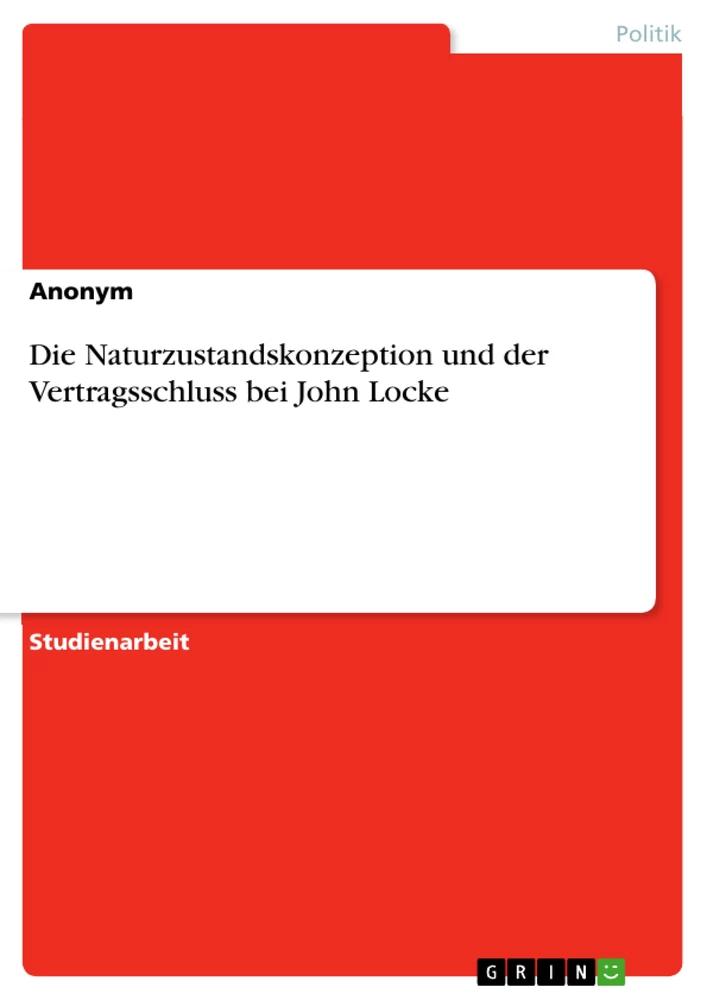Im Jahre 1689 veröffentlichte John Locke anonym sein politisches Hauptwerk „Zwei Abhandlungen über die Regierung“. Im zweiten Teil dieses für die politische Ideengeschichte bedeutsamen Werkes skizziert John Locke den „wahren Ursprung, die Reichweite und den Zweck der staatlichen Regierung“. Seine Ausführungen geben folglich nicht nur über die Legitimation einer politischen Ordnung Auskunft, vielmehr beschreibt Locke feststehende Grenzen und Aufgaben eines politischen Gemeinwesens und kann dadurch als erster Begründer einer konstitutionellen Ordnung angesehen werden. Dabei bemüht er den für Kontraktualisten typischen Dreischritt: Beschreibung des alsbald mühsamen oder gar gefährlichen Naturzustandes, Überwindung des Naturzustandes durch den Vertragsschluss und schließlich die Darstellung des Gesellschaftszustandes. Gegenstand dieser Seminararbeit sollen die ersten beiden Schritte sein, also die Naturzustandskonzeption und das Zustandekommen des Vertragsabschlusses. Die Charakteristika des Naturzustandes eines Vertragstheoretikers sind für die Ideengeschichte von großer Bedeutung. Denn aus der Gestalt des Naturzustandes lässt sich bereits eine bestimmte Argumentationskette herleiten, aus der sich gewissermaßen Voraussagungen über die Gestalt des Gesellschaftsvertrages treffen lassen. Vereinfacht ausgedrückt: Unterschiedliche Probleme – das Problem ist der Naturzustand – erfordern jeweils problemspezifische Lösungsansätze – die Lösung ist der Gesellschaftsvertrag. Oder, um es mit den Worten des Philosophen Wolfgang Kersting auszudrücken, enthält das „Portrait des Naturzustandes schon das Negativ des Staates“. Der Vertragsschluss ist das Bindeglied in diesem Abhängigkeitsverhältnis.
Die dieser Seminararbeit zugrunde liegende Fragestellung ist also folgende: Wie ist der Lockesche Naturzustand konzipiert und wie kommt der Vertragschluss zustande? Zur Beantwortung der Fragestellung wird in einem ersten Hauptteil eine grundlegende Analyse des Naturzustandes und des Vertragsschlusses in John Lockes „Zwei Abhandlungen“ vorgenommen werden. Bezüglich der Erörterung muss vorweg genommen werden, dass Lockes politische Theorie zuweilen Widersprüchlichkeiten oder sehr abstrakte Darstellungen beinhaltet, die dazu geführt haben, dass auch die Befunde der modernen Forschung zu John Locke zum Teil höchst kontrovers sind. Einige diesbezügliche Forschungsfragen werden daher Gegenstand eines zweiten Hauptteils sein.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung: Die Vertragstheorie von John Locke
2. Die Gestalt des Naturzustandes und der Vertragsschluss bei John Lo>Analyse
2.1. Das Naturgesetz und die natürlichen Rechte
2.2. Die Lockesche Eigentumstheorie
2.3. Das wachsende Misstrauen und der Kriegszustand
2.4. Der Vertragsschluss
3. Eine detaillierte Erörterung des Naturzustandes und des Vertragsschlusses bei John Locke
3.1. Der Lockesche Naturzustand: Ein Denkmodell ohne zeitlichen Rahmen oder historisch-empirischer Zustand?
3.2. Wann befindet sich ein Mensch im Naturzustand?
3.3. Der Grund für Normativität im Naturzustand: Gott oder abstrakte Vernunft?
4. Schlussbetrachtung: Die Bedeutung der Naturzustandskonstruktion von John Locke
Quellen- und Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert John Locke den Naturzustand?
Locke beschreibt den Naturzustand als einen Zustand vollkommener Freiheit und Gleichheit, in dem die Menschen nach dem Naturgesetz der Vernunft leben.
Warum verlassen Menschen bei Locke den Naturzustand?
Wegen des Fehlens eines unparteiischen Richters und der Unsicherheit des Eigentums droht der Naturzustand in einen Kriegszustand überzugehen, was den Vertragsschluss nötig macht.
Was ist der Kern von Lockes Eigentumstheorie?
Eigentum entsteht durch die Vermischung von Arbeit mit den Gaben der Natur; jeder Mensch hat ein natürliches Recht auf das Produkt seiner Arbeit.
Wie kommt der Gesellschaftsvertrag zustande?
Durch die freiwillige und einstimmige Übereinkunft der Individuen, ihre natürliche Gewalt zur Durchsetzung des Rechts an eine Gemeinschaft zu übertragen.
Was ist das Ziel einer staatlichen Regierung nach Locke?
Der Hauptzweck der Vereinigung von Menschen zu einem Staat ist der Schutz ihres Eigentums (Leben, Freiheit und Besitz).
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2010, Die Naturzustandskonzeption und der Vertragsschluss bei John Locke, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199340