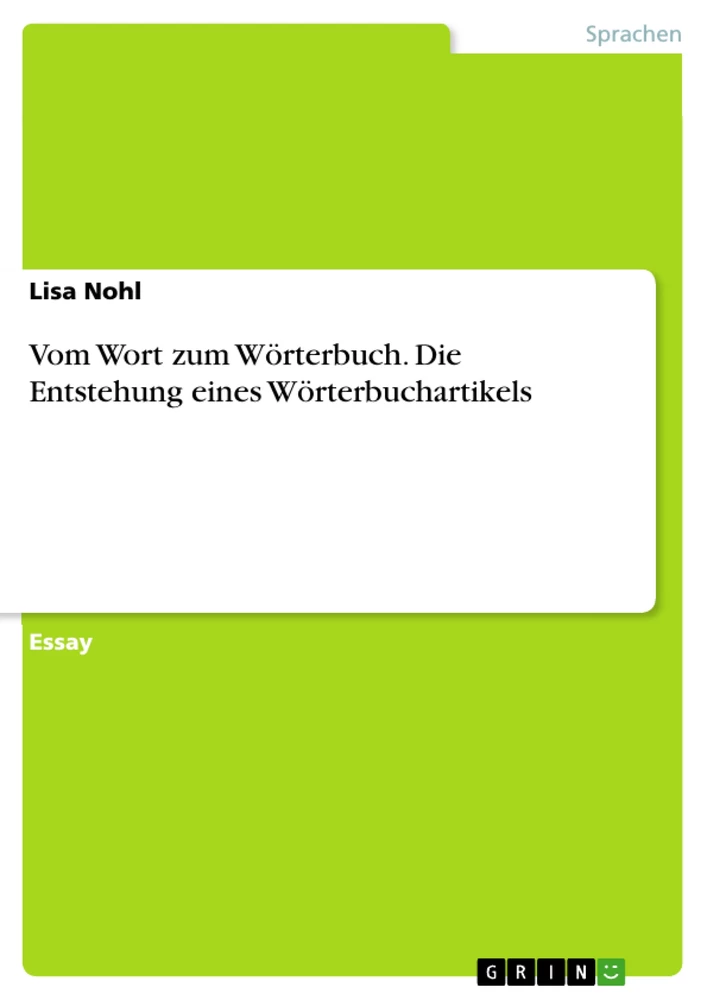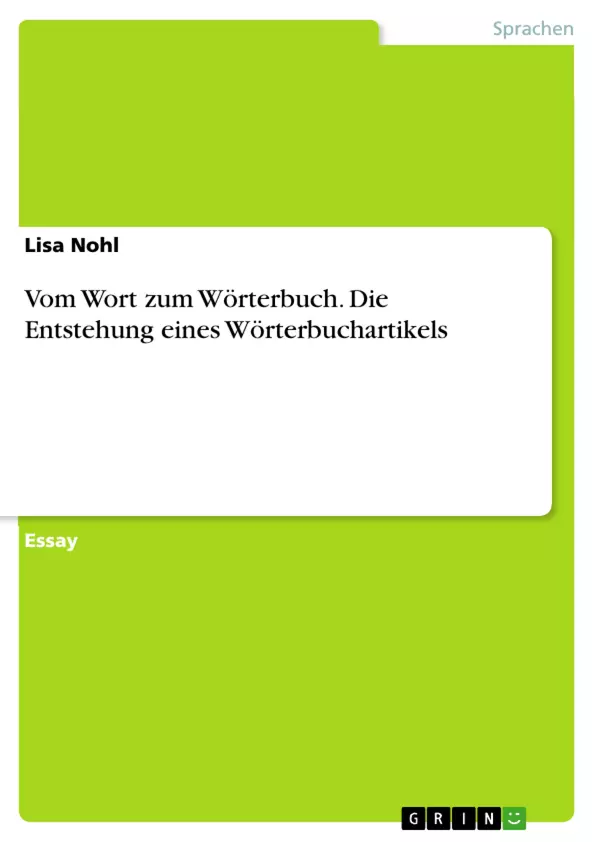Wörterbücher gehören für viele zum Alltag. Sie werden sowohl im Job, als auch an Schulen und Universitäten gebraucht und gehören zu einer gut ausgestatteten Heim-Bibliothek. Jeder kennt Wörterbücher und der Umgang mit dieser Art von Nachschlagewerken wird sogar an Schulen gelehrt. Und so haben die meisten eines im eigenen Bücherregal. Wie selbstverständlich ziehen wir unser Wörterbuch zu Rate, wenn wir nicht wissen, wie ein Wort geschrieben wird oder was es bedeutet.
Der Umgang mit einem solchen Nachschlagewerk ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Weniger selbstverständlich ist allerdings die Frage danach, wie ein Wörterbuch überhaupt entsteht, wie viel Arbeit wirklich darin steckt und wie ein entsprechender Artikel im Wörterbuch generell aufgebaut ist. Auch die Struktur ist den meisten unbekannt. Das alles zählt zu den Aufgaben der Lexikographie und die vorliegende Arbeit soll genau das thematisieren, nämlich den Weg vom Wort ins Wörterbuch.
Inhaltsverzeichnis
- Vom Wort zum Wörterbuch - Entstehung eines Wörterbuchartikels
- Die Lexikographie und ihre Zielsetzungen
- Die Vielfalt der Wörterbücher
- Der Aufbau eines Wörterbuchartikels: Makro- und Mikrostruktur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Entstehungsprozess eines Wörterbuchartikels und beleuchtet die Aufgaben der Lexikographie. Sie erörtert die verschiedenen Arten von Wörterbüchern und deren Aufbau, wobei die Makro- und Mikrostruktur im Fokus stehen.
- Die Rolle der Lexikographie in der Sprachförderung und -entwicklung
- Die Vielfalt der Wörterbuchtypen und ihre jeweiligen Zielgruppen
- Die Bedeutung von Belegen für die Erstellung von Wörterbüchern
- Die Makrostruktur von Wörterbüchern (alphabetische Ordnung)
- Die Mikrostruktur von Wörterbüchern (Gliederung der Artikel)
Zusammenfassung der Kapitel
Vom Wort zum Wörterbuch - Entstehung eines Wörterbuchartikels: Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die scheinbar selbstverständliche Nutzung von Wörterbüchern thematisiert und die Frage nach ihrer Entstehung und Struktur aufwirft. Sie führt in die Thematik der Lexikographie ein und hebt die Bedeutung von Metawissen über Sprache für die lexikographische Arbeit hervor. Die verschiedenen Zielsetzungen der Lexikographie, von der Sprachentwicklung bis zur Sprachkulturförderung, werden beleuchtet, ebenso der Unterschied zwischen präskriptiver und deskriptiver Lexikographie.
Die Lexikographie und ihre Zielsetzungen: Dieses Kapitel beschreibt die Aufgaben der Lexikographie, die über das bloße Erstellen von Wörterbüchern hinausgehen. Es betont die Förderung der individuellen Sprachentwicklung, des exakten Sprachgebrauchs und der Verständigung zwischen Experten und Laien. Die historischen Zielsetzungen wie Sprachreinheit und Nationalbewusstsein werden ebenfalls erwähnt, im Kontext der unterschiedlichen Zielsetzungen (präskriptiv vs. deskriptiv). Der Abschnitt veranschaulicht die Komplexität lexikographischen Arbeitens und die Notwendigkeit von fundiertem sprachwissenschaftlichen Wissen.
Die Vielfalt der Wörterbücher: Der Abschnitt betont die große Bandbreite an Wörterbuchtypen, die weit über das gängige Verständnis eines "Universalwörterbuchs" hinausgeht. Er nennt verschiedene Duden-Varianten als Beispiele und erwähnt weitere Verlage wie Wahrig und Langenscheidt, um die Vielfalt zu illustrieren. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Bedürfnissen, die verschiedene Wörterbucharten erfüllen, z.B. Umgang mit plurizentrischen Sprachen (Deutsch in Österreich und der Schweiz), die Suche nach Synonymen oder fachspezifischen Begriffen. Die Ausführungen betonen die Notwendigkeit, sich der Vielfalt der Wörterbücher bewusst zu sein, um diese gezielt einsetzen zu können.
Der Aufbau eines Wörterbuchartikels: Makro- und Mikrostruktur: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Aufbau von Wörterbuchartikeln, indem es die Makro- und Mikrostruktur unterscheidet. Die Makrostruktur beschreibt die Anordnung der Lemmata (z.B. alphabetisch, nischenalphabetisch, nestalphabetisch), wobei die alphabetische Anordnung als die gebräuchlichste hervorgehoben wird. Die Mikrostruktur hingegen befasst sich mit der systematischen Gliederung der Informationen innerhalb eines einzelnen Artikels. Der Text verweist auf die Definitionen von Michael Schlaefer, der die Mikrostruktur von der Textebene (typografische Merkmale) und der Wissenstruktur (organisierte Abfolge von Informationselementen) aus beschreibt und die Lemmakonstituente (z.B. Silbenstruktur, Intonation, orthografische Normalform) von der Beschreibungskonstituente unterscheidet.
Schlüsselwörter
Lexikographie, Wörterbuch, Wörterbuchartikel, Makrostruktur, Mikrostruktur, Lemma, Beleg, Sprachentwicklung, Sprachkultur, Wörterbuchtypen, präskriptiv, deskriptiv, plurizentrische Sprache.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Vom Wort zum Wörterbuch
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über die Lexikographie, insbesondere über die Entstehung und den Aufbau von Wörterbüchern. Er behandelt Themen wie die Zielsetzungen der Lexikographie, die Vielfalt der Wörterbuchtypen und die Makro- und Mikrostruktur von Wörterbuchartikeln.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in vier Hauptkapitel: "Vom Wort zum Wörterbuch - Entstehung eines Wörterbuchartikels", "Die Lexikographie und ihre Zielsetzungen", "Die Vielfalt der Wörterbücher" und "Der Aufbau eines Wörterbuchartikels: Makro- und Mikrostruktur". Jedes Kapitel wird im Text zusammengefasst.
Was sind die zentralen Themen des Textes?
Die zentralen Themen sind die Entstehung eines Wörterbuchartikels, die verschiedenen Aufgaben und Zielsetzungen der Lexikographie (inklusive präskriptiver und deskriptiver Ansätze), die Vielfalt der existierenden Wörterbuchtypen und deren jeweilige Zielgruppen sowie die Beschreibung der Makro- und Mikrostruktur von Wörterbuchartikeln, einschließlich der Anordnung der Lemmata und der Organisation der Informationen innerhalb eines einzelnen Artikels.
Was versteht man unter Makro- und Mikrostruktur eines Wörterbuchartikels?
Die Makrostruktur bezieht sich auf die Gesamtstruktur des Wörterbuchs, beispielsweise die alphabetische Anordnung der Lemmata. Die Mikrostruktur beschreibt hingegen die interne Struktur eines einzelnen Wörterbuchartikels, also die systematische Anordnung der Informationen innerhalb des Artikels (z.B. Definition, Beispiele, Etymologie).
Welche Arten von Wörterbüchern werden im Text erwähnt?
Der Text erwähnt verschiedene Wörterbuchtypen, ohne sie explizit aufzulisten. Es wird jedoch die große Bandbreite an Wörterbüchern betont, von Universalwörterbüchern über fachspezifische Wörterbücher bis hin zu Wörterbüchern, die sich mit plurizentrischen Sprachen auseinandersetzen. Duden, Wahrig und Langenscheidt werden als Beispiele für verschiedene Verlage genannt.
Welche Rolle spielt die Lexikographie in der Sprachförderung und -entwicklung?
Der Text hebt die Bedeutung der Lexikographie für die Sprachförderung und -entwicklung hervor. Lexikographische Arbeit trägt zur Klärung des Sprachgebrauchs bei, fördert die Verständigung und unterstützt die individuelle Sprachentwicklung. Die historischen Zielsetzungen wie Sprachreinheit und Nationalbewusstsein werden ebenfalls im Kontext der unterschiedlichen Zielsetzungen (präskriptiv vs. deskriptiv) erwähnt.
Welche Schlüsselwörter sind mit dem Text verbunden?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Lexikographie, Wörterbuch, Wörterbuchartikel, Makrostruktur, Mikrostruktur, Lemma, Beleg, Sprachentwicklung, Sprachkultur, Wörterbuchtypen, präskriptiv, deskriptiv, plurizentrische Sprache.
Für wen ist dieser Text relevant?
Dieser Text ist relevant für Studierende der Linguistik, Lexikographie und Sprachwissenschaft, aber auch für alle, die sich für die Entstehung und den Aufbau von Wörterbüchern interessieren.
Wo finde ich weitere Informationen zum Thema?
Weitere Informationen können Sie in einschlägiger Fachliteratur zur Lexikographie und Sprachwissenschaft finden. Die im Text erwähnten Autoren und Verlage können als Ausgangspunkt für weitere Recherchen dienen.
- Citar trabajo
- Bachelor of Arts Lisa Nohl (Autor), 2010, Vom Wort zum Wörterbuch. Die Entstehung eines Wörterbuchartikels, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199537