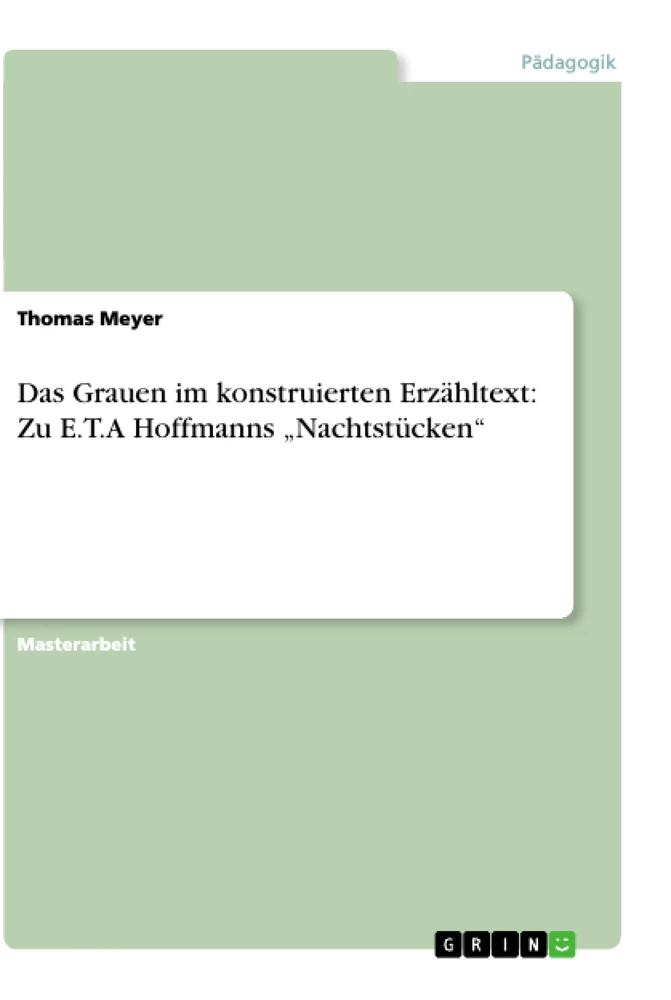Das Unheimliche wird in dieser Arbeit für einmal als eines verstanden, das nicht nur in den Motiven und Themen, sondern vorwiegend in der hoffmannschen Poetik verankert ist. Von der Analyse soll keines der „Nachtstücke“ ausgeschlossen werden, die konsequente Einheit des Zyklus lässt sich an einer Untersuchung des Unheimlichen gleichsam en passant aufzeigen. Der Autor Hoffmann liefert selbst bezüglich des Fantastischen und Unheimlichen in seinen Erzählungen reiche poetologische Hinweise, welche sich weit aufschlussreicher als die Theorien über das literarische Fantastische anderer Autoren auf seine Erzähltexte anwenden lassen. Ausgehend von der Annahme, dass alleinig der Text einer Erzählung die schauerliche Wirkung übertragen und beim Leser entstehen lassen kann, soll darauf eine detaillierte textuelle Analyse, die jeweils bei den beiden von der Forschung am eklatantesten gemiedenen Novellen „Ignaz Denner“ und „Das Gelübde“ ansetzt, der Frage nachgehen, wo das Unheimliche im Erzähltext manifest wird, was genau uns denn in diesen Geschichten erschauern macht und welche sprachlichen Mittel der Zeit-, Figuren- und Raumgestaltung entscheidend dazu beitragen. Sicherlich trifft man dabei in allen „Nachtstücken“ auf grelle Schauerelemente. Sie drehen sich beständig um Wahnsinn, Selbstmord, Totschlag, Satanismus, Revenants, dunkle Schlösser, Automate und Trugbilder. Ihre wahrlich beängstigende Wirkung jedoch, das zeigt der dritte Teil der Arbeit, entsteht im Wesentlichen durch die genannten Erzähltechniken - die perspektivische, den Leser in extremer Nähe zu den Figuren haltende Erzählweise, ein stetes, über Beglaubigungsstrategien bewirktes In-die-Irre-Führen desselben, durch Brüche, die bei gleichzeitiger Verrätselung und Illusionsaufrechterhaltung, die Ironie, die Gemachtheit und die Inszenierung der Erzählung offen legen sowie durch stets vieldeutige Enden, wo Fragen ungeklärt bleiben und die über Staunen und Schrecken auch nach dem Schliessen des Buchdeckels verunsichern, jegliche Vereindeutigung verweigern und den Leser somit im Unheimlichen zurücklassen.
Die Erzähltexte der „Nachtstücke“ sind ein bewusst und berechnend inszeniertes Verwirrspiel, das über die Themen der Erzählungen, und, stärker noch, über die Sprache, in der es verfasst ist, laut wird und über das das Unheimliche, gleich einem Automat, eine Art Eigenleben erlangt, das gerade nur im Rahmen von Literatur und über besagte Erzähltechniken funktionieren kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die unheimliche Erzähltechnik E. T. A. Hoffmanns
- 3. Die textuelle Manifestation des Unheimlichen in den ,,Nachtstücken“
- Das gestaltlose Auftauchen des Unheimlichen im Heimischen
- Unheimliches Spiel mit Zahlen, Zeiten und Zeitpunkten
- Zweifelhafte Identitäten
- Schaurige Gesichtszüge, Anatomien, Sprachen und Stimmen
- Die abenteuerliche Aufmachung des Bösen
- Verwunschene Topographien, verzerrte Räume und ihre Ausleuchtung
- 4. Der automathafte Erzähltext
- Dunkle Schicksalsahnungen
- Zauberische Artefakte
- Wiederholung - Eine Struktur des Unheimlichen
- Der Text im Text des Textes - Das Spiegelkabinett der „Nachtstücke“
- Am Ende der „Nachtstücke“ - Am Ende der Nacht?
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Erzähltechnik E. T. A. Hoffmanns in seinen „Nachtstücken“ und analysiert, wie das Unheimliche darin literarisch konstruiert wird. Sie beleuchtet die Rezeptionsgeschichte der „Nachtstücke“ und setzt sie in den Kontext der Forschung zum Unheimlichen in der Literatur.
- Analyse der unheimlichen Erzähltechnik in den „Nachtstücken“
- Textuelle Manifestationen des Unheimlichen (Gestaltlosigkeit, Zeit, Identität, Raum)
- Der automathafte Erzähltext und seine Strukturen
- Rezeption und Forschungsgeschichte der „Nachtstücke“
- Vergleich mit modernen Beispielen unheimlicher Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik unheimlicher Literatur ein und veranschaulicht die anhaltende Faszination für dieses Genre anhand von Beispielen aus der modernen Literatur, wie Stephen Kings „Crouch End“. Sie stellt die „Nachtstücke“ von E.T.A. Hoffmann als zentralen Untersuchungsgegenstand vor und verweist auf deren paradoxe Rezeptionsgeschichte – von anfänglicher Wertschätzung bis hin zu einer Phase der Missachtung in der deutschen Literaturwissenschaft.
2. Die unheimliche Erzähltechnik E. T. A. Hoffmanns: Dieses Kapitel analysiert die spezifischen Erzähltechniken Hoffmanns, die zur Konstruktion des Unheimlichen beitragen. Es wird wahrscheinlich auf stilistische Mittel, narrative Strategien und die Gestaltung von Atmosphäre eingegangen. Der Fokus liegt vermutlich auf der Analyse der Elemente, die den Leser in eine Atmosphäre des Unbehagens versetzen und die Grenzen zwischen Realität und Phantasie verschwimmen lassen.
3. Die textuelle Manifestation des Unheimlichen in den ,,Nachtstücken“: Diese Kapitelsektion befasst sich mit der konkreten Ausgestaltung des Unheimlichen in den einzelnen „Nachtstücken“. Es werden wahrscheinlich verschiedene Aspekte des Unheimlichen behandelt, wie z.B. das Auftauchen des Unheimlichen im scheinbar Vertrauten, das Spiel mit Zeit und Identität, sowie die Gestaltung von Raum und Atmosphäre. Die Analyse wird sich wahrscheinlich auf konkrete Beispiele aus den einzelnen Erzählungen stützen, um die jeweiligen Techniken zu belegen.
4. Der automathafte Erzähltext: Dieser Abschnitt dürfte sich mit den strukturellen Aspekten der Erzählungen befassen, die zum Eindruck eines „automatischen“ Erzählprozesses beitragen. Es werden wahrscheinlich wiederkehrende Motive, strukturelle Elemente und die Art und Weise, wie der Text sich selbst referenziert und spiegelt, analysiert. Die Wiederholung als Stilmittel zur Steigerung des Unheimlichen wird wahrscheinlich eine wichtige Rolle spielen.
Schlüsselwörter
E. T. A. Hoffmann, Nachtstücke, Unheimliches, Erzähltechnik, Romantik, Fantastik, Psychoanalyse, Literaturwissenschaft, Rezeption, Motiv, Struktur, Spiegelung, Wiederholung.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu: Analyse der unheimlichen Erzähltechnik in E.T.A. Hoffmanns „Nachtstücken“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Erzähltechnik E.T.A. Hoffmanns in seinen „Nachtstücken“ und untersucht, wie das Unheimliche darin literarisch konstruiert wird. Sie beleuchtet die Rezeptionsgeschichte der „Nachtstücke“ und setzt sie in den Kontext der Forschung zum Unheimlichen in der Literatur.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Analyse der unheimlichen Erzähltechnik in den „Nachtstücken“, die textuelle Manifestationen des Unheimlichen (Gestaltlosigkeit, Zeit, Identität, Raum), den automathaften Erzähltext und seine Strukturen, die Rezeption und Forschungsgeschichte der „Nachtstücke“ sowie einen Vergleich mit modernen Beispielen unheimlicher Literatur.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Analyse der unheimlichen Erzähltechnik E.T.A. Hoffmanns, textuelle Manifestation des Unheimlichen in den „Nachtstücken“, der automathafte Erzähltext und ein Fazit. Jedes Kapitel wird durch eine Zusammenfassung erläutert.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in die Thematik unheimlicher Literatur ein und veranschaulicht die anhaltende Faszination für dieses Genre anhand von Beispielen aus der modernen Literatur. Sie stellt die „Nachtstücke“ von E.T.A. Hoffmann als zentralen Untersuchungsgegenstand vor und verweist auf deren paradoxe Rezeptionsgeschichte.
Wie wird die unheimliche Erzähltechnik Hoffmanns analysiert?
Kapitel 2 analysiert die spezifischen Erzähltechniken Hoffmanns, die zur Konstruktion des Unheimlichen beitragen. Es wird auf stilistische Mittel, narrative Strategien und die Gestaltung von Atmosphäre eingegangen, die den Leser in eine Atmosphäre des Unbehagens versetzen und die Grenzen zwischen Realität und Phantasie verschwimmen lassen.
Wie wird das Unheimliche in den „Nachtstücken“ textuell manifestiert?
Kapitel 3 befasst sich mit der konkreten Ausgestaltung des Unheimlichen in den einzelnen „Nachtstücken“. Es werden Aspekte wie das Auftauchen des Unheimlichen im Vertrauten, das Spiel mit Zeit und Identität, sowie die Gestaltung von Raum und Atmosphäre behandelt. Die Analyse stützt sich auf konkrete Beispiele aus den Erzählungen.
Was versteht man unter dem „automathaften Erzähltext“?
Kapitel 4 analysiert die strukturellen Aspekte der Erzählungen, die zum Eindruck eines „automatischen“ Erzählprozesses beitragen. Es werden wiederkehrende Motive, strukturelle Elemente und die Selbstreferenzialität des Textes analysiert. Die Wiederholung als Stilmittel zur Steigerung des Unheimlichen spielt eine wichtige Rolle.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: E. T. A. Hoffmann, Nachtstücke, Unheimliches, Erzähltechnik, Romantik, Fantastik, Psychoanalyse, Literaturwissenschaft, Rezeption, Motiv, Struktur, Spiegelung, Wiederholung.
- Citar trabajo
- Master of Arts UZH Thomas Meyer (Autor), 2006, Das Grauen im konstruierten Erzähltext: Zu E.T.A Hoffmanns „Nachtstücken“, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199578