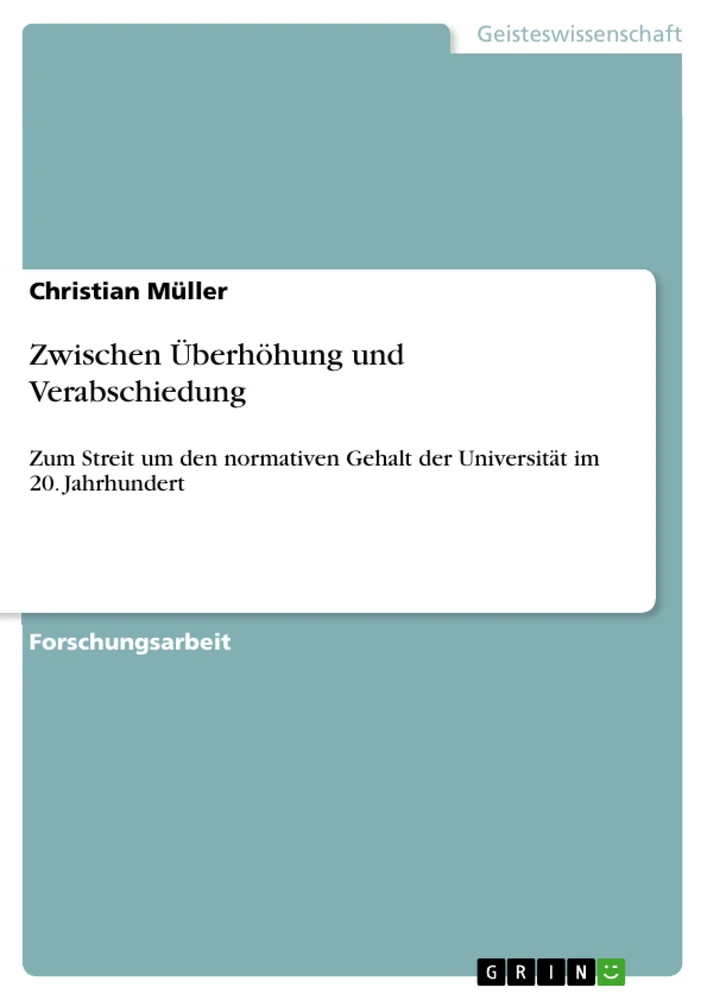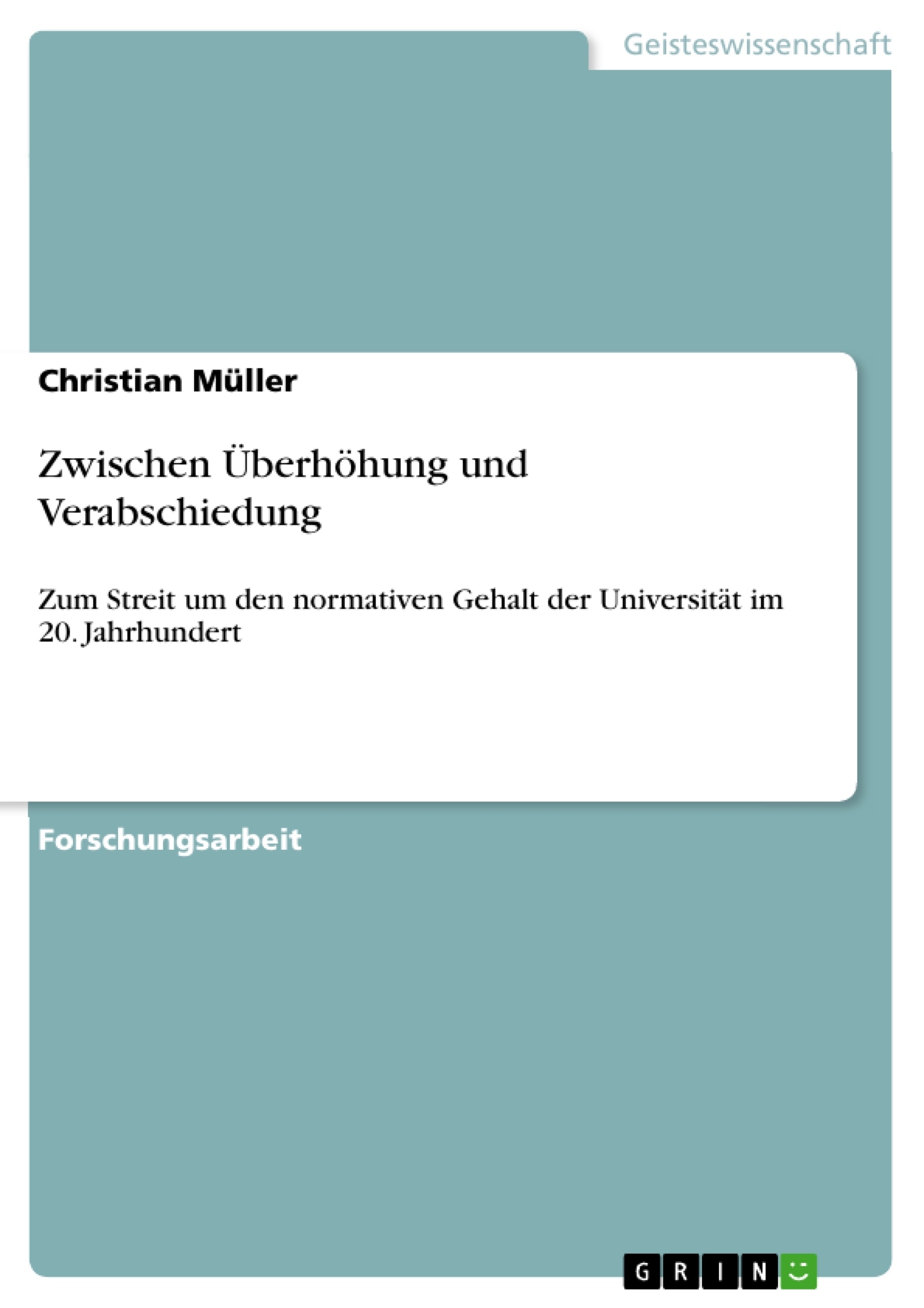Die Kontroverse um den normativen Gehalt der humanistischen Universitätsidee wird im 20. Jahrhundert an einer entscheidenden Konfliktlinie ausgetragen: Es geht dabei um die entscheidende Streitfrage, ob normative Prämissen der institutionellen Selbstbeschreibung sich als für Bildungsprozesse integrierende, bewahrenswerte (Ideen-)Ressource oder als hinderliche Blockade der Effizienz von Bildungsprozessen erweisen. Jene Bildungsprozesse sind in modernen Gesellschaften nicht mehr ohne Weiteres unabhängig von gesellschaftlich-technischem Wandel und Prozessen wie einer massiven Bildungsexpansion zu denken. Sowohl die bedingungslosen Fürsprecher, reformistischen Erneuerer als auch die Kritiker der neuhumanistischen Idee haben sich dabei im gesamten 20. Jahrhundert am „Mythos Humboldt“ abgearbeitet. Zwischen C. H. Beckers entschiedener Bejahung des neuhumanistischen Erbes, Max Schelers soziologisch informierter Ernüchterung und schließlich der systemtheoretischen Verabschiedung einer über normative Semantiken integrierten akademischen Vergemeinschaftung bleibt Humboldt der zentrale diskursive Bezugspunkt, zu dem sich jeder Neuansatz implizit oder explizit positioniert. Die Untersuchung zeigt, dass es offenbar falsch ist, dass Humboldt für die moderne Universität nur noch im Rahmen akademischer Sonntagsreden bedeutsam ist, vielmehr kommt kein bedeutender bildungspolitischer Entwurf und keine ernsthafte Theorie der Institution Universität an ihm vorbei.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Glanz und Elend der Universitätsidee
- Der Mythos Humboldt als Erfindung des 20. Jahrhunderts
- Universität und Krise der Geistesaristokratie
- Versuch einer Rehabilitierung der „Gralsburg“
- Max Scheler und das Ernüchterungspotential des soziologischen Realismus
- Der Streit um die Universität in der „verwissenschaftlichten Zivilisation“
- Das kommunikative Potential der Universität und seine systemtheoretische Hinterfragung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Kontroverse um den normativen Gehalt der humanistischen Universitätsidee im 20. Jahrhundert. Dabei steht die Frage im Vordergrund, ob normative Prämissen der institutionellen Selbstbeschreibung als integrierende, bewahrenswerte (Ideen-)Ressource oder als hinderliche Blockade der Effizienz von Bildungsprozessen anzusehen sind. Die Arbeit beleuchtet die Auseinandersetzung mit dem „Mythos Humboldt“ im 20. Jahrhundert und zeigt, wie verschiedene Positionen – von entschiedenen Befürwortern über reformistische Erneuerer bis hin zu Kritikern – die neuhumanistische Idee der Universität interpretierten.
- Die Bedeutung der Humboldt-Universitätsidee im 20. Jahrhundert
- Die Krise der Geistesaristokratie und die Herausforderungen der modernen Universität
- Die Auseinandersetzung mit dem "Mythos Humboldt" und seine Relevanz für die aktuelle Universitätsdebatte
- Der Einfluss soziologischer Perspektiven auf die Diskussion um die Universität
- Die Suche nach einer zeitgemäßen Universitätsvision angesichts gesellschaftlicher Veränderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beginnt mit einem aktuellen Beispiel: Derridas Vortrag über die „unbedingte Universität“ und die Resonanz, die dieser in der deutschsprachigen Debatte findet. Derrida beschwört ein überzeitliches Ideal der Universität als gelehrte Gemeinschaft und ruft damit Sehnsüchte nach einer idealistischen Verteidigung der Universität hervor. Diese Sehnsucht steht im Kontext des „Mythos Humboldt“, der im 20. Jahrhundert als Referenzpunkt für die Universitätsdebatte diente.
Kapitel 2 behandelt die Entstehung des „Mythos Humboldt“ im 20. Jahrhundert. Die Humboldt-Universitätsidee wird als Erfindung des 20. Jahrhunderts beschrieben und die Wiederentdeckung der Schriften Wilhelm von Humboldts um die Jahrhundertwende wird beleuchtet. Die Rezeption der Humboldtschen Denkschrift zeigt, wie sie zur Legitimation der zweckfreien Grundlagenforschung eingesetzt wurde.
Schlüsselwörter
Humboldt-Universitätsidee, neuhumanistische Universität, Geistesaristokratie, wissenschaftliche Weltgeltung, Massenuniversität, Bildungsexpansion, soziologischer Realismus, systemtheoretische Analyse, Universitätsreform, Bologna-Reform, Jacques Derrida, Jürgen Habermas, Max Scheler, Jürgen Mittelstrass
Häufig gestellte Fragen
Was wird unter dem „Mythos Humboldt“ verstanden?
Der Mythos Humboldt bezeichnet die neuhumanistische Idee der Universität als Ort zweckfreier Grundlagenforschung und Bildung, die im 20. Jahrhundert als zentraler Bezugspunkt für Universitätsdebatten neu erfunden wurde.
Welche Rolle spielt Wilhelm von Humboldt für die moderne Universität?
Obwohl oft kritisiert, kommt kein bedeutender bildungspolitischer Entwurf an Humboldt vorbei; er bleibt der zentrale diskursive Bezugspunkt für die institutionelle Selbstbeschreibung der Universität.
Was war der Kern der Kontroverse im 20. Jahrhundert?
Es ging um die Frage, ob normative Bildungsideale eine wertvolle Ressource oder eine Blockade für die Effizienz in Zeiten der Bildungsexpansion und des technischen Wandels darstellen.
Wie positionierte sich Max Scheler zur Universitätsidee?
Max Scheler vertrat eine Position des soziologisch informierten Realismus und blickte eher ernüchtert auf die idealistischen Ansprüche der neuhumanistischen Universität.
Welchen Einfluss hat die Systemtheorie auf die Debatte?
Die systemtheoretische Perspektive hinterfragt die über normative Semantiken integrierte akademische Gemeinschaft und neigt eher zu einer Verabschiedung dieser klassischen Ideale.
- Arbeit zitieren
- Christian Müller (Autor:in), 2010, Zwischen Überhöhung und Verabschiedung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199859