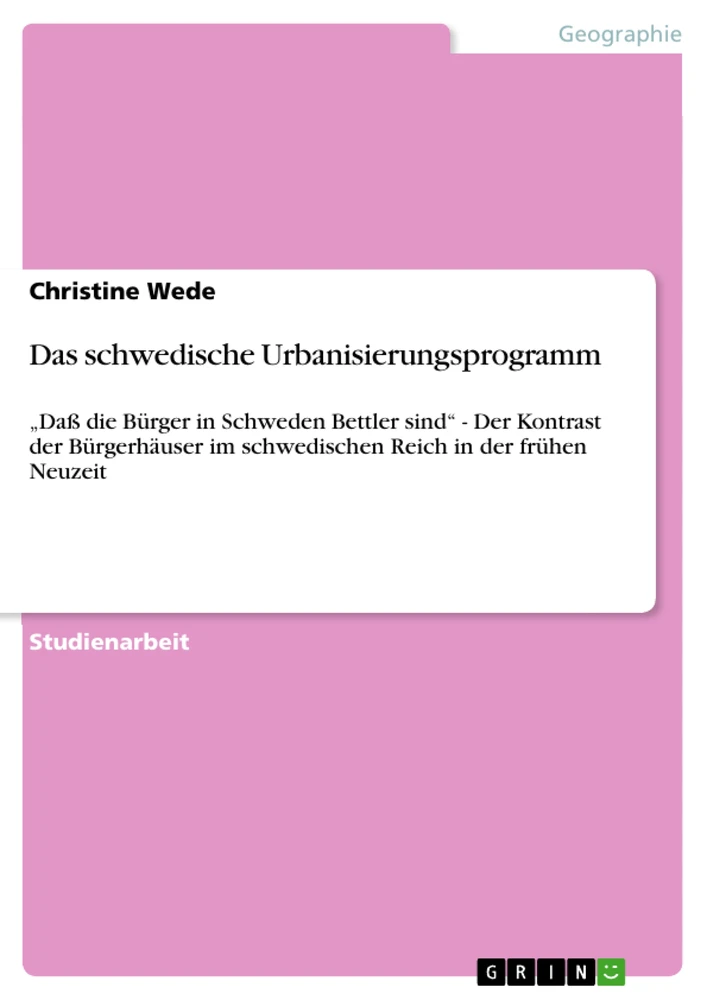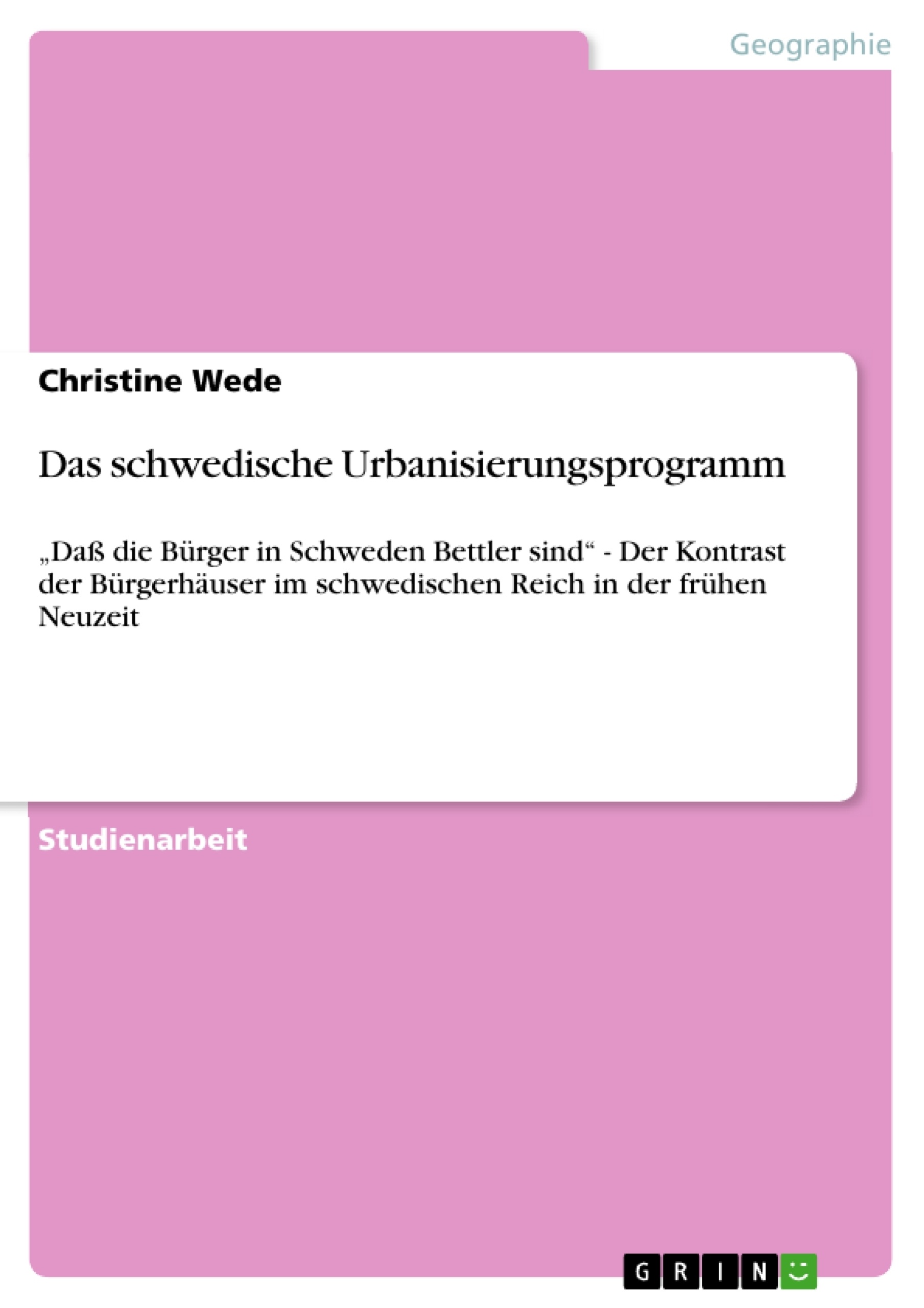Europa war im 17. Jahrhundert von zahlreichen kriegerischen Auseinandersetzungen am Ende. Der verheerendste: der „30 jährige Krieg“, Höhepunkt religiöser und dynastischer Spannungen in Europa, verwüstete und entvölkerte Landstriche. 1648 brachte der Westfälische Friede Ruhe und Schweden, das unter Gustav II. Adolf aktiv an der Seite protestantischer Truppen gekämpft hatte, die großen Küstengebiete auf dem Boden des Kaiserreiches. In dieser Zeit begann Schweden, an der Peripherie des Kontinentes gelegen, eine zu dieser Zeit in Europa untypische expansive Phase des Städtebaus.
Nur fünf Prozent der Bevölkerung lebte in Städten und zu dieser Zeit gab es nur wenige stadtähnliche Strukturen für den Austausch mit dem Fernhandel wie Göteborg. Die älteren Siedlungen aus dem Mittelalter entwickelten sich an Orten an denen lokaler Handel, mit einer eingeschränkten Reichweite, geführt wurde. Eine Änderung dieses Zustandes verfolgte schon Gustav Wasa. Obwohl erst 1580 Maßnahmen zur Zusammenlegung mehrerer kleiner Orte getroffen wurden, um den Landhandel zu stärken, hatte er schon vor dieser Zeit erkannt, dass der Handel einen entscheidenden Faktor für die Stadtbildung darstellt. 1523 tritt Schweden aus der Kalmarer Union aus und kann sich gegen die Vormundschaft der Hanse durchsetzen.
Jedoch waren die Städte Schwedens mit dem zeitgenössischen kontinentalen Verständnis von Stadt nicht zu vergleichen und konnten immer noch, bis auf einige Ausnahmen, als ländlich betrachtet werden.
Mitte des 17. Jahrhunderts wurden zahlreiche neue Städte gegründet, einige von Ihnen wurden, wie Karlskrona und Göteborg, durch die Kenntnisse holländischer Ingenieure zu Festungsstädten ausgebaut. Es herrschten rege stadtplanerische Aktivitäten - bewusst angeordnet von König Gustav II Adolf und unterstützt durch eine großen Anzahl politischer und administrativer Reformen, die es möglich machten, den Städtebau in einer solch rasanten Weise voranzubringen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- „Daß die Bürger in Schweden Bettler sind“
- Die Bürgerhäuser in Schweden
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Bürgerhäuser im schwedischen Reich in der frühen Neuzeit. Im Mittelpunkt steht die Frage, inwiefern die Gesellschaftsordnung des 17. und 18. Jahrhunderts die Architektur der Bürgerhäuser prägte. Dabei wird die Stadt Stockholm als ein besonderer Fall hervorgehoben, da sie sich als Ausnahme von der allgemeinen Tendenz der Stadtentwicklung in Schweden entwickelte.
- Die Bedeutung des Städtebaus für die Entwicklung Schwedens im 17. Jahrhundert
- Der Einfluss der Gesellschaftsordnung auf die Architektur der Bürgerhäuser
- Die Rolle des Barockstils in der schwedischen Architektur
- Die Stadt Stockholm als Sonderfall in der schwedischen Stadtentwicklung
- Die Herausforderungen der Entwicklung einer selbstbewussten Bürgerschicht in Schweden
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel liefert eine Einführung in die politische und wirtschaftliche Situation Schwedens im 17. Jahrhundert und beleuchtet die Bedeutung des Städtebaus in diesem Kontext. Das zweite Kapitel analysiert die Entwicklung der schwedischen Städte und deren Sozialstruktur. Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die Architektur der Bürgerhäuser in Stockholm und Schweden im 18. Jahrhundert.
Schlüsselwörter
Schwedischer Städtebau, Bürgerhausarchitektur, Gesellschaftsordnung, Barock, Stockholm, Stadtentwicklung, Wirtschaft, Handel, Bürgertum, Adel, Großmacht.
Häufig gestellte Fragen
Warum erlebte Schweden im 17. Jahrhundert eine expansive Phase des Städtebaus?
Nach dem Westfälischen Frieden 1648 wollte Schweden seine neuen Küstengebiete sichern und den Fernhandel durch gezielte Stadtgründungen stärken.
Welche Rolle spielten holländische Ingenieure in Schweden?
Holländische Ingenieure brachten das Wissen für den Ausbau moderner Festungsstädte wie Karlskrona und Göteborg nach Schweden.
Warum gilt Stockholm als Sonderfall in der schwedischen Stadtentwicklung?
Stockholm entwickelte sich als einzige Stadt zu einer echten Metropole mit einer Architektur, die sich deutlich von der eher ländlich geprägten Struktur anderer schwedischer Städte abhob.
Wie beeinflusste die Gesellschaftsordnung die Architektur der Bürgerhäuser?
Die Arbeit untersucht, wie die soziale Struktur des 17. und 18. Jahrhunderts und der Einfluss des Adels den Barockstil der bürgerlichen Bauten prägten.
Was war das Urbanisierungsprogramm von König Gustav II. Adolf?
Es war eine Reihe bewusster stadtplanerischer Aktivitäten und administrativer Reformen, um Schweden von einem Agrarstaat zu einer Handelsmacht zu transformieren.
- Quote paper
- Dipl.-Ing. Christine Wede (Author), 2012, Das schwedische Urbanisierungsprogramm, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199889