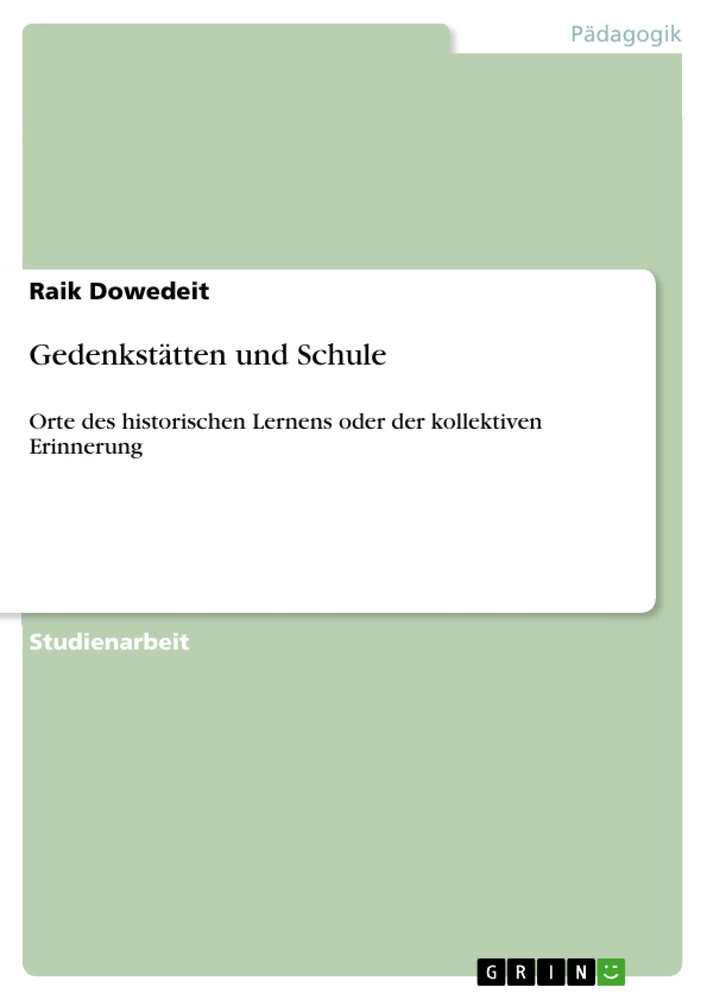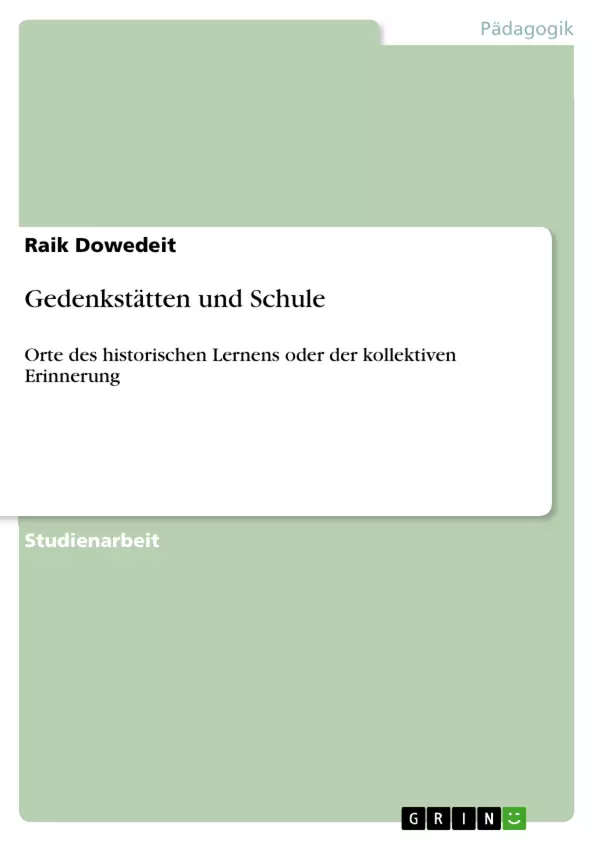In den letzten 22 Jahren hat sich die Gedenkstättenlandschaft in der wiedervereinigten Bundesrepublik erheblich geändert. Heute stehen Gedenkstätten vor der wichtigen Aufgabe, die Menschen, besonders die jungen Menschen, in Deutschland für ihr Leben in der Demokratie zu erziehen und sie auch für die Gefährdungen der Demokratie zu sensibilisieren. Angesichts der historischen Erfahrung mit Diktaturen im 20. Jahrhundert muss der nachwachsenden Generation nachdrücklich vermittelt werden, dass die demokratische Gesellschaftsform nichts Selbstverständliches ist und das sie wichtig ist, um die Grundrechte des Einzelnen zu schützen und staatliches Unrecht zu verhindern. Dies versucht im schulischen Bereich vor allem der Unterricht zur politischen Bildung, aber auch in vielen anderen Fächern mit politischen Aspekten zu erreichen. Das vorliegende Portfolio ist eine Sammlung von Essays zum geschichtsdidaktischen Hauptseminar „Gedenkstätten und Schule – Orte des historischen Lernens oder der kollektiven Erinnerung“ dar und besteht aus sechs Essays sowie einer Bibliografie mit themenrelevanter Literatur.
Inhaltsverzeichnis
1. Vorwort
2. Geschichtsdidaktik als Wissenschaft
3. Geschichtsbewusstsein vs. Geschichtskultur?
4. Memoria - Gedächtnis und Erinnerung
5. Gedenkstätten heute
6. Gedenkstätten als außerschulische Lernorte im Geschichtsunterricht
7. Entwicklungstendenzen und Möglichkeiten von Gedenkstätten
8. Bibliografie zum Seminarthema
- Quote paper
- Raik Dowedeit (Author), 2012, Gedenkstätten und Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199898