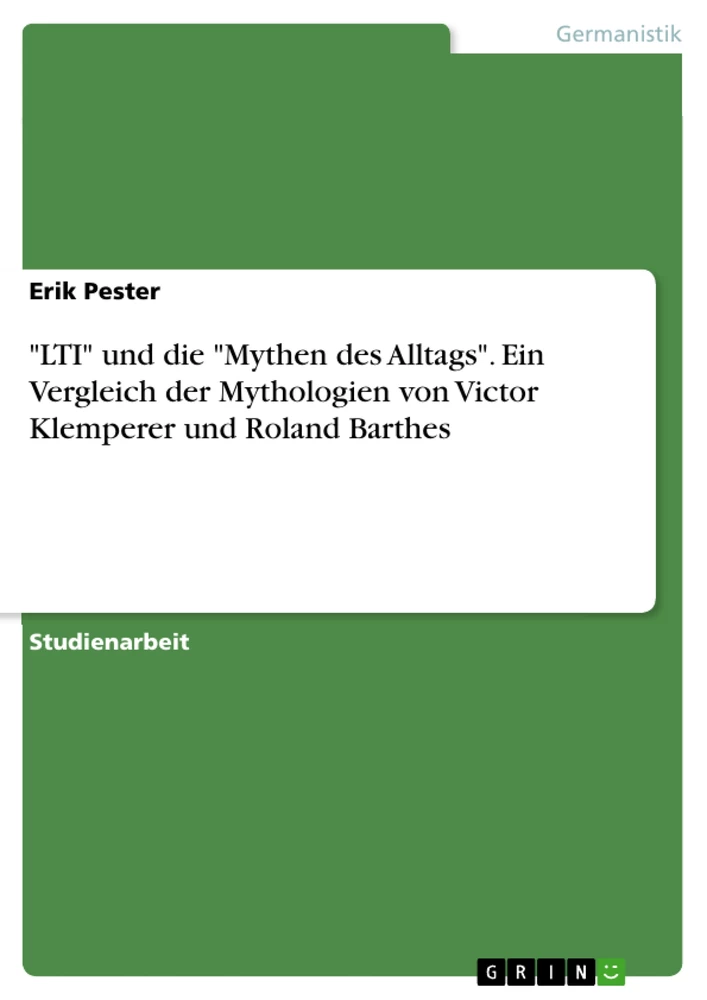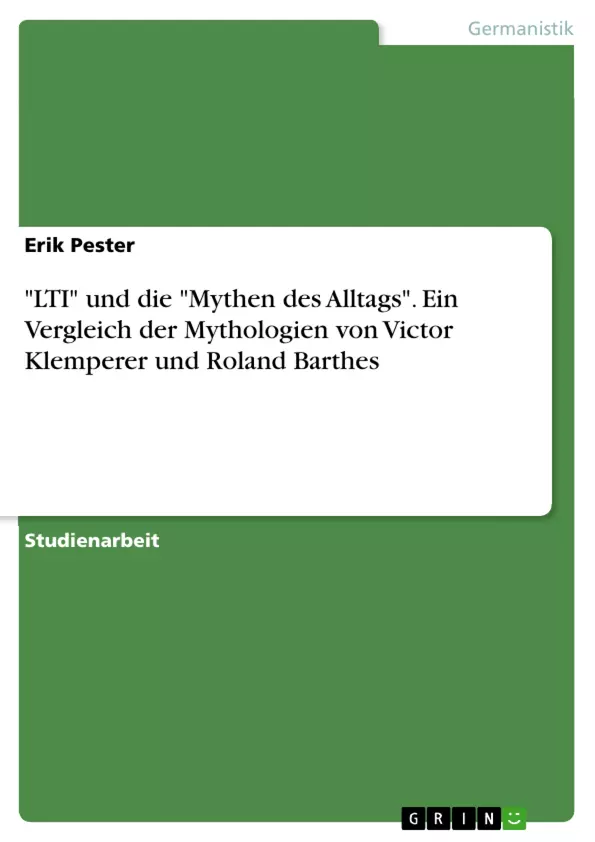Ziel dieser Arbeit ist es, zwei sprachwissenschaftliche Arbeiten aufeinander zu beziehen, für die schon bei einer rein formalen Betrachtung eine Reihe von Parallelen und Gemeinsamkeiten festgestellt werden können. Sie wurden beide in der unmittelbaren Nachkriegszeit veröffentlicht: Victor Klemperers „LTI. Notizbuch eines Philologen“ (im Folgenden nur: „LTI“) erschien 1947, die Einzelanalysen Roland Barthes´ in der späteren Zusammenstellung „Mythen des Alltags“ in den Jahren von 1952 bis 1956. Die Gesamtausgabe von 1956 enthält zudem einen zusätzlichen Abschnitt mit theoretischen Betrachtungen (Neumann 2009, S. 98).
Da beide gewissermaßen hinter die Kulisse der Sprache oder des Zeichens im allgemeinen blicken wollen , erscheint es reizvoll, mögliche tieferliegende Gemeinsamkeiten beider Werke freizulegen. Erschöpfend und unter allen Perspektiven kann dies im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet werden. Daher soll hier in einfacher Operatonalisierung Klemperers Vorgehen gewissermaßen durch die Brille Barthes´ betrachtet werden.
Nach einer kurzen, dem Fokus der Arbeit angemessenen Darstellung der Mythenkonzeption Roland Barthes´, wird das Vorgehen Klemperers erläutert, bereits mit Blick auf die zuvor aufgeführten theoretischen Konstrukte. Einige aussagekräftige Beispiele werden nachfolgend zur Überprüfung der Hypothese herangezogen, Klemperers Untersuchung der Sprache im Dritten Reich sei eine mythologische Analyse, wie Roland Barthes sie in „Mythen des Alltags“ zu formulieren versucht.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Roland Barthes´ Mythenkonzeption nach „Mythen des Alltags“
2.1. Der Mythos als Rede – der Mythos als semiologisches System
2.2. Mythenrezeption nach Roland Barthes
3. Analyse
3.1. Einleitende Vorbemerkungen zu „LTI“
3.2. Auswahl der Beispiele
3.3. Analyse: Von Klemperer zu Barthes
3.4. Victor Klemperer als Mythologe nach Roland Barthes?
4. Fazit und Ausblick
5. Literaturverzeichnis
6. Abbildungsverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was vergleicht die Arbeit von Klemperer und Barthes?
Die Arbeit vergleicht Victor Klemperers Analyse der Sprache des Dritten Reiches (LTI) mit Roland Barthes' semiologischer Untersuchung moderner Mythen.
Was bedeutet der Begriff "LTI"?
LTI steht für "Lingua Tertii Imperii", die Sprache des Dritten Reiches, die Klemperer in seinem Notizbuch philologisch analysierte.
Was ist ein "Mythos" im Sinne von Roland Barthes?
Für Barthes ist ein Mythos ein semiologisches System, eine "Rede", die gesellschaftliche Werte als naturgegeben und selbstverständlich darstellt.
Gibt es Parallelen zwischen den Werken?
Ja, beide Autoren versuchen, hinter die Kulissen der Sprache und Zeichen zu blicken, um verborgene ideologische Strukturen aufzudecken.
Kann Klemperer als "Mythologe" bezeichnet werden?
Die Arbeit untersucht die Hypothese, dass Klemperers Vorgehen bei der Untersuchung der NS-Sprache einer mythologischen Analyse nach Barthes entspricht.
- Quote paper
- Erik Pester (Author), 2012, "LTI" und die "Mythen des Alltags". Ein Vergleich der Mythologien von Victor Klemperer und Roland Barthes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200002