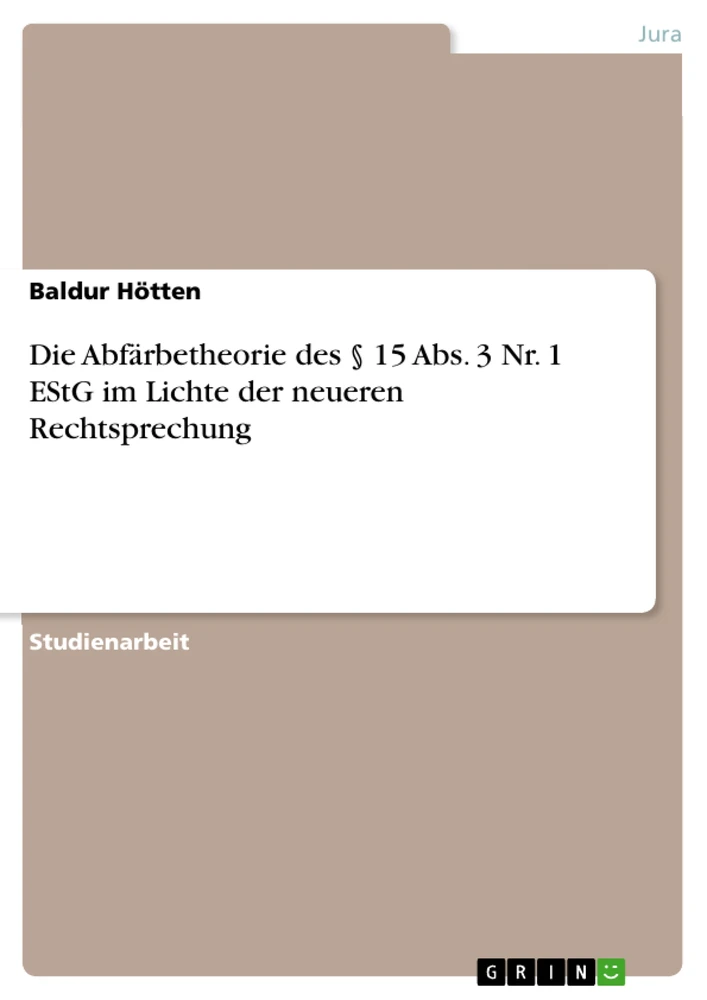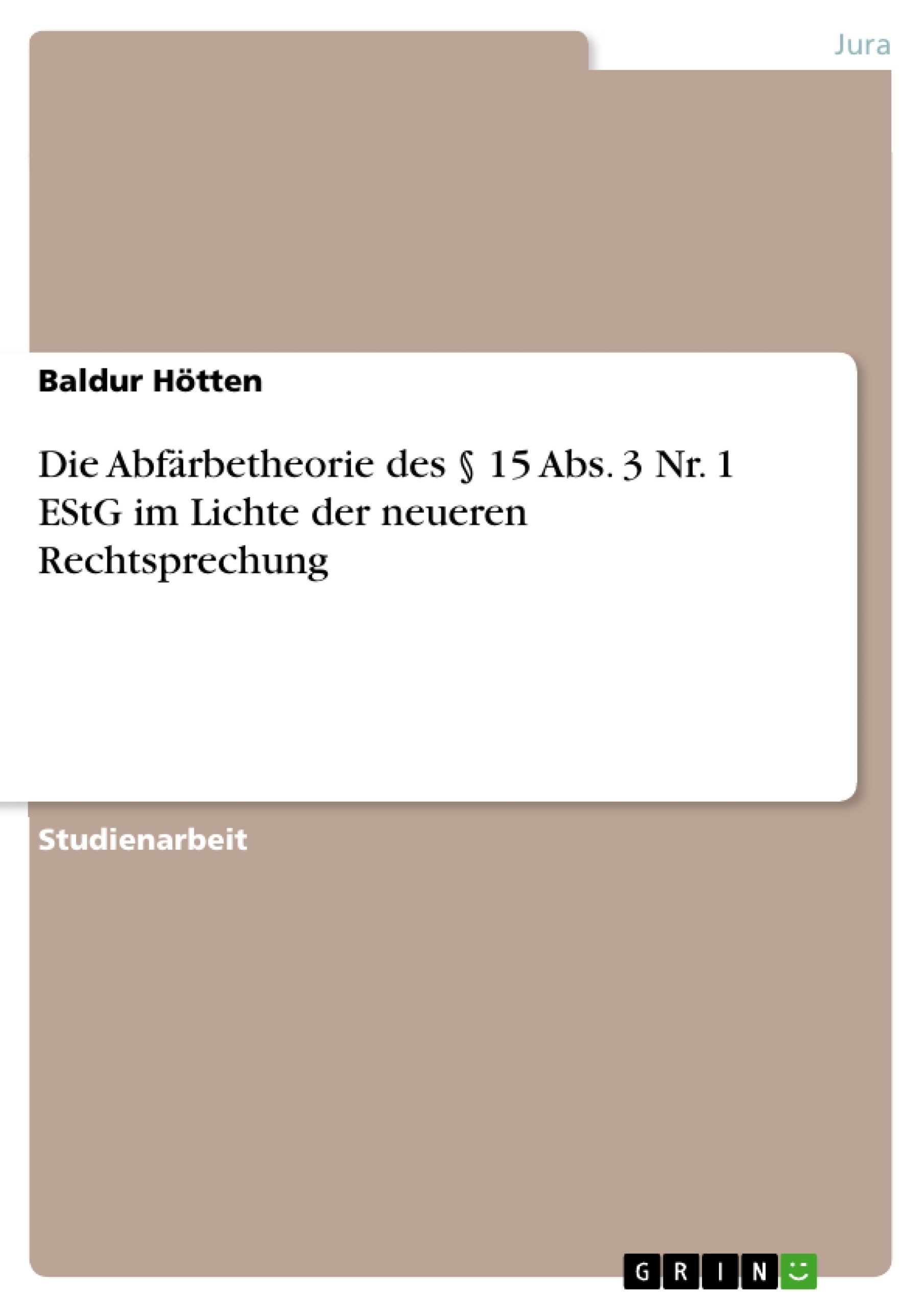Die Abfärberegel des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG führt dazu, dass sämtliche Einkünfte einer Personengesellschaft - das kann zB eine freiberufliche Sozietät von Rechts-anwälten, der Zusammenschluss von zwei Diplom-Ingenieuren zwecks Erstellung von Systemsoftware für gemeinsame Kunden oder auch eine zahnärztliche Berufsaus-übungsgemeinschaft (auf die im Folgenden exemplarisch immer wieder beispielhaft zurückgegriffen wird), sein - der Gewerbesteuer unterliegen. Dieses unbefriedigende Ergebnis betrifft nur Personengesellschaften, jedoch keine Einzelunternehmer was somit eine steuerliche Ungleichbehandlung zur Folge hat. Der BFH geht indes in ständiger Rechtsprechung von der Verfassungsmässigkeit der Abfärberegel aus mit dem Hinweis, dass die Steuerpflichtigen die Möglichkeit hätten, trennbare Tätigkeiten auf eine gesonderte Personengesellschaft auszugliedern. Diese starre, „gebetsmühlen-artige“ Haltung des BFH lässt sich aus dem Sinn und Zweck der Abfärberegel begründen die deshalb als einer der Oberpunkte des Hauptteils vertiefend dargestellt werden sollen, nachdem Eingangs die Tatbestandsmerkmale des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG erörtert werden. Es soll damit zunächst näher mit der Bestimmung vertraut gemacht werden, denn die sog. „Abfärbe- oder Infektionstheorie“ wurde ursprünglich von der Rechtsprechung entwickelt und wird inzwischen auf den durch das Steuer-bereinigungsgesetz 1986 geänderten Wortlaut von § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG gestützt („. . . in vollem Umfang“).
Nach einer Bestandsaufnahme der aktuellen Situation zur Verfassungswidrigkeit der Gesetzesvorschrift, soll das sog. Ausgliederungsmodell als originäre Gestaltungs-empfehlung des BFH - auf welches dieser in mehreren Urteilen nachhaltig verwiesen hat - näher erläutert werden. Eingegangen wird in diesem Zusammenhang auch auf den Problemfall einer steuerlich verunglückten Ausgliederung, wenn nämlich eine Be-triebsaufspaltung begründet wird.
Nach Durchleuchtung von Vergangenheit und Gegenwart - insbesondere der Zeit von 1997 bis Ende 2000 - gilt es abschließend zukünftige steuerpolitische Perspektiven der Abfärberegel zu eruieren. Anhand eines BFH- bzw. von mehreren FG-Urteilen werden erste „Aufweichungstendenzen“ in der Rechtsprechung aufgezeigt und mög-liche Grenzwerte bis zu denen gewerbliche Einnahmen bei der Gewerbesteuer zu vernachlässigen sind, diskutiert. Auswirkungen aus dem ab dem 01. Januar 2001 geltenden Steuersenkungsgesetz schließen die Ausführungen ab.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Tatbestandsmerkmale des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG
- 2.1 Umfassend gewerbliche Personengesellschaft
- 2.2 Vorliegen einer anderen (als die gewerbliche) einkommensteuerpflichtigen Tätigkeit dieser Personengesellschaft mit Einkünfteerzielungsabsicht (typische praktische Fallkonstellationen)
- 2.3 Eine gewerbliche Tätigkeit i.S.v. § 15 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 2 EStG
- 2.4 Weitere Möglichkeiten für eine Abfärbung
- 3. Vorrangige Klärung, ob eine gemischte Tätigkeit als einheitlich freiberuflich oder gewerblich zu werten ist
- 4. Rechtsfolgen bei Erfüllung der Tatbestandsmerkmale des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG
- 5. Sinn und Zweck der Abfärberegel
- 5.1 Zielsetzung des historischen Gesetzgebers
- 5.2 Aspekt der Praktikabilität nach Ansicht der Rechtsprechung vorrangig
- 5.3 Abfärberegel als kombinierte Vereinfachungs- und Missbrauchsvermeidungsvorschrift zum Schutze des Gewerbesteueraufkommens
- 6. Ist die Abfärberegel wegen Verstoßes gegen den Gleichheitsgrundsatz des Artikel 3 Abs. 1 Grundgesetz verfassungswidrig?
- 7. Das Ausgliederungsmodell als Gestaltungsempfehlung
- 7.1 Ausgliederung gewerblicher Tätigkeiten auf die Gesellschafter
- 7.2 Ausgliederung auf gesonderte - auch personenidentische - Personengesellschaften (sog. Zweit- bzw. Schwestergesellschaften/Parallelgesellschaften)
- 7.2.1 Prämissen einer Zweitgesellschaft und die zu ziehenden Konsequenzen für die steuerliche Anerkennung nach dem BMF-Schreiben vom 14.05.1997 (BStBl I 1997, S. 566)
- 7.2.2 Beeinträchtigung der Anwendung des Ausgliederungsmodells durch die Grundsätze zur Betriebsaufspaltung
- 7.2.3 Gefahr der Abfärbung durch gewerbliche Sonderbetriebseinnahmen?
- 8. „Aufweichungstendenzen“ in der Rechtsprechung zu § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG durch den BFH und die Finanzgerichtsbarkeit
- 8.1 Abfärbetheorie greift nicht bei äußerst geringfügigen gewerblichen Einkünften
- 8.2 Gewerbliche, aber von der Gewerbesteuer befreite Einkünfte aus einer Klinik können aus Gründen der Verhältnismäßigkeit keine Abfärbewirkung i.S.d. § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG auf Einkünfte aus ärztlicher Tätigkeit entfalten
- 9. Mögliche Grenzwerte, um gewerbliche Einnahmen von untergeordneter Bedeutung bei der Gewerbesteuer zu negieren
- 10. Auswirkungen ab dem Jahr 2001 durch das Steuersenkungsgesetz (StSenkG)
- 11. Die Ansichten des Bundesverfassungsgerichts
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Abfärbetheorie des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG im Lichte der neueren Rechtsprechung. Ziel ist es, die Tatbestandsmerkmale dieser Regelung zu erläutern, deren Sinn und Zweck zu beleuchten und die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) und der Finanzgerichte (FG) kritisch zu prüfen. Insbesondere wird das Ausgliederungsmodell als Gestaltungsempfehlung des BFH im Detail untersucht.
- Tatbestandsmerkmale des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG
- Sinn und Zweck der Abfärberegel und deren verfassungsrechtliche Zulässigkeit
- Das Ausgliederungsmodell zur Vermeidung der Abfärbung
- Aktuelle Rechtsprechung und "Aufweichungstendenzen"
- Auswirkungen des Steuersenkungsgesetzes
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Abfärberegel des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG ein. Sie beschreibt das Problem der Gewerbesteuerpflicht für Personengesellschaften mit gemischten Tätigkeiten und stellt die zentralen Fragestellungen der Arbeit vor. Die Einleitung hebt die steuerliche Ungleichbehandlung zwischen Personengesellschaften und Einzelunternehmen hervor und kündigt die detaillierte Untersuchung der Tatbestandsmerkmale, des Sinns und Zwecks der Regelung, des Ausgliederungsmodells und der aktuellen Rechtsprechung an. Besonders wird auf die von der Rechtsprechung entwickelte „Abfärbe- oder Infektionstheorie“ hingewiesen und deren Stützung durch den geänderten Gesetzeswortlaut im Steuerbereinigungsgesetz 1986 hervorgehoben.
2. Die Tatbestandsmerkmale des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG: Dieses Kapitel definiert die Tatbestandsmerkmale des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG. Es beschreibt, unter welchen Voraussetzungen eine Personengesellschaft, die neben freiberuflichen oder anderen Tätigkeiten auch gewerblich tätig ist, vollumfänglich als Gewerbebetrieb gilt. Es werden verschiedene Gesellschaftstypen, wie OHG, KG, GbR und atypisch stille Gesellschaften, betrachtet und deren Einordnung im Kontext der Abfärberegel diskutiert. Der Abschnitt behandelt die Anforderungen an die gewerbliche Tätigkeit und die Bedeutung der Einkünfteerzielungsabsicht. Die Ausführungen beziehen sich auf relevante Rechtsprechung des BFH, insbesondere zum Thema atypisch stiller Gesellschaften.
3. Vorrangige Klärung, ob eine gemischte Tätigkeit als einheitlich freiberuflich oder gewerblich zu werten ist: Dieses Kapitel behandelt die Frage der Abgrenzung zwischen freiberuflichen und gewerblichen Tätigkeiten im Rahmen einer gemischten Tätigkeit. Es beleuchtet die Kriterien für die Einordnung der Gesamttätigkeit als einheitlich freiberuflich oder gewerblich. Die Diskussion umfasst die Schwierigkeiten der Abgrenzung und die Bedeutung dieser Klassifizierung für die Anwendung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG.
4. Rechtsfolgen bei Erfüllung der Tatbestandsmerkmale des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG: Kapitel 4 beschreibt die steuerlichen Konsequenzen, wenn die Tatbestandsmerkmale des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG erfüllt sind. Es erklärt die umfassende Gewerbesteuerpflicht für sämtliche Einkünfte der Personengesellschaft und die daraus resultierenden Auswirkungen. Es könnte auch die Problematik der Ungleichbehandlung im Vergleich zu Einzelunternehmen erneut thematisieren.
5. Sinn und Zweck der Abfärberegel: Dieses Kapitel untersucht den Sinn und Zweck der Abfärberegel. Es analysiert die Zielsetzung des historischen Gesetzgebers und die Rolle der Praktikabilität in der Rechtsprechung. Es wird die Abfärberegel als kombinierte Vereinfachungs- und Missbrauchsvermeidungsvorschrift zum Schutz des Gewerbesteueraufkommens dargestellt. Die Diskussion könnte den Konflikt zwischen Vereinfachung und Gerechtigkeit beleuchten.
6. Ist die Abfärberegel wegen Verstoßes gegen den Gleichheitsgrundsatz des Artikel 3 Abs. 1 Grundgesetz verfassungswidrig?: Das sechste Kapitel befasst sich mit der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit der Abfärberegel. Es untersucht die Argumente für und gegen deren Vereinbarkeit mit dem Gleichheitsgrundsatz. Die Auseinandersetzung könnte die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts einbeziehen und die Frage der Verhältnismäßigkeit der Regelung diskutieren.
7. Das Ausgliederungsmodell als Gestaltungsempfehlung: Dieses Kapitel beschreibt das vom BFH empfohlene Ausgliederungsmodell zur Vermeidung der Abfärbung. Es erläutert verschiedene Ausgliederungsvarianten und analysiert deren steuerliche Konsequenzen. Ein besonderer Fokus liegt auf den möglichen Problemen bei einer Ausgliederung, insbesondere im Zusammenhang mit der Betriebsaufspaltung. Die steuerliche Anerkennung nach dem BMF-Schreiben von 1997 wird ebenfalls diskutiert.
8. „Aufweichungstendenzen“ in der Rechtsprechung zu § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG durch den BFH und die Finanzgerichtsbarkeit: Das Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Rechtsprechung zum § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG und analysiert mögliche „Aufweichungstendenzen“. Es wird die Frage diskutiert, bis zu welchem Umfang geringfügige gewerbliche Einkünfte die Abfärbung auf andere Einkunftsarten auslösen. Beispiele aus der Rechtsprechung des BFH und der Finanzgerichte werden herangezogen.
9. Mögliche Grenzwerte, um gewerbliche Einnahmen von untergeordneter Bedeutung bei der Gewerbesteuer zu negieren: Kapitel 9 diskutiert die Frage nach möglichen Grenzwerten für gewerbliche Einnahmen, ab denen diese bei der Gewerbesteuer vernachlässigt werden können. Es analysiert die Grenzen der Abfärbetheorie und sucht nach Kriterien zur Abgrenzung zwischen relevanten und irrelevanten gewerblichen Tätigkeiten.
10. Auswirkungen ab dem Jahr 2001 durch das Steuersenkungsgesetz (StSenkG): Das Kapitel beschreibt die Auswirkungen des Steuersenkungsgesetzes von 2001 auf die Abfärbetheorie. Es analysiert die Änderungen und deren Relevanz für die Praxis.
11. Die Ansichten des Bundesverfassungsgerichts: Dieses Kapitel stellt die Position des Bundesverfassungsgerichts zur Abfärberegel dar, soweit dies aus dem gegebenen Text ersichtlich ist.
Schlüsselwörter
Abfärbetheorie, § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG, Personengesellschaft, Gewerbebetrieb, freiberufliche Tätigkeit, Gewerbesteuer, Einkünfteerzielungsabsicht, Ausgliederungsmodell, Betriebsaufspaltung, Rechtsprechung BFH, Finanzgerichtsbarkeit, Verfassungsmäßigkeit, Gleichheitsgrundsatz, Steuersenkungsgesetz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Abfärbetheorie des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Abfärbetheorie des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG, beleuchtet deren Tatbestandsmerkmale, Sinn und Zweck und prüft die Rechtsprechung kritisch. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Ausgliederungsmodell als Gestaltungsempfehlung zur Vermeidung der Abfärbung.
Welche Tatbestandsmerkmale umfasst § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG?
Dieser Paragraph regelt, unter welchen Bedingungen eine Personengesellschaft, die neben freiberuflichen oder anderen Tätigkeiten auch gewerblich tätig ist, vollumfänglich als Gewerbebetrieb gilt. Es werden Kriterien wie die umfassend gewerbliche Personengesellschaft, das Vorliegen einer weiteren einkommensteuerpflichtigen Tätigkeit mit Einkünfteerzielungsabsicht und das Bestehen einer gewerblichen Tätigkeit i.S.v. § 15 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 2 EStG betrachtet. Verschiedene Gesellschaftstypen (OHG, KG, GbR, atypisch stille Gesellschaften) und die Bedeutung der Einkünfteerzielungsabsicht werden ebenfalls diskutiert.
Was ist der Sinn und Zweck der Abfärberegel?
Die Abfärberegel dient der Vereinfachung und der Missbrauchsvermeidung im Steuerrecht. Sie soll das Gewerbesteueraufkommen schützen. Die Arbeit untersucht die Zielsetzung des historischen Gesetzgebers und die Rolle der Praktikabilität in der Rechtsprechung. Der Konflikt zwischen Vereinfachung und Gerechtigkeit wird ebenfalls beleuchtet.
Ist die Abfärberegel verfassungswidrig?
Die Arbeit untersucht die verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Abfärberegel im Hinblick auf den Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG). Die Argumente für und gegen die Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz werden diskutiert, und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wird einbezogen.
Was ist das Ausgliederungsmodell?
Das Ausgliederungsmodell ist eine vom BFH empfohlene Gestaltungsempfehlung zur Vermeidung der Abfärbung. Es beinhaltet die Ausgliederung gewerblicher Tätigkeiten auf die Gesellschafter oder auf gesonderte Personengesellschaften (Zweit- oder Schwestergesellschaften). Die Arbeit analysiert verschiedene Varianten, deren steuerliche Konsequenzen und mögliche Probleme im Zusammenhang mit der Betriebsaufspaltung. Die steuerliche Anerkennung nach dem BMF-Schreiben von 1997 wird ebenfalls diskutiert.
Gibt es „Aufweichungstendenzen“ in der Rechtsprechung?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Rechtsprechung und analysiert mögliche „Aufweichungstendenzen“ der Abfärbetheorie. Insbesondere wird die Frage diskutiert, inwieweit geringfügige gewerbliche Einkünfte die Abfärbung auf andere Einkunftsarten auslösen. Beispiele aus der Rechtsprechung des BFH und der Finanzgerichte werden herangezogen.
Welche Grenzwerte gibt es für gewerbliche Einnahmen?
Die Arbeit diskutiert mögliche Grenzwerte für gewerbliche Einnahmen, ab denen diese bei der Gewerbesteuer vernachlässigt werden können. Sie analysiert die Grenzen der Abfärbetheorie und sucht nach Kriterien zur Abgrenzung zwischen relevanten und irrelevanten gewerblichen Tätigkeiten.
Welche Auswirkungen hatte das Steuersenkungsgesetz (StSenkG) von 2001?
Die Arbeit beschreibt die Auswirkungen des Steuersenkungsgesetzes von 2001 auf die Abfärbetheorie und analysiert die durchgeführten Änderungen und deren Relevanz für die Praxis.
Welche Position vertritt das Bundesverfassungsgericht?
Die Arbeit stellt die Position des Bundesverfassungsgerichts zur Abfärberegel dar, soweit dies aus dem gegebenen Text ersichtlich ist.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Abfärbetheorie, § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG, Personengesellschaft, Gewerbebetrieb, freiberufliche Tätigkeit, Gewerbesteuer, Einkünfteerzielungsabsicht, Ausgliederungsmodell, Betriebsaufspaltung, Rechtsprechung BFH, Finanzgerichtsbarkeit, Verfassungsmäßigkeit, Gleichheitsgrundsatz, Steuersenkungsgesetz.
- Quote paper
- Dipl. Kaufmann/Dipl. Betriebswirt Baldur Hötten (Author), 2012, Die Abfärbetheorie des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG im Lichte der neueren Rechtsprechung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200103