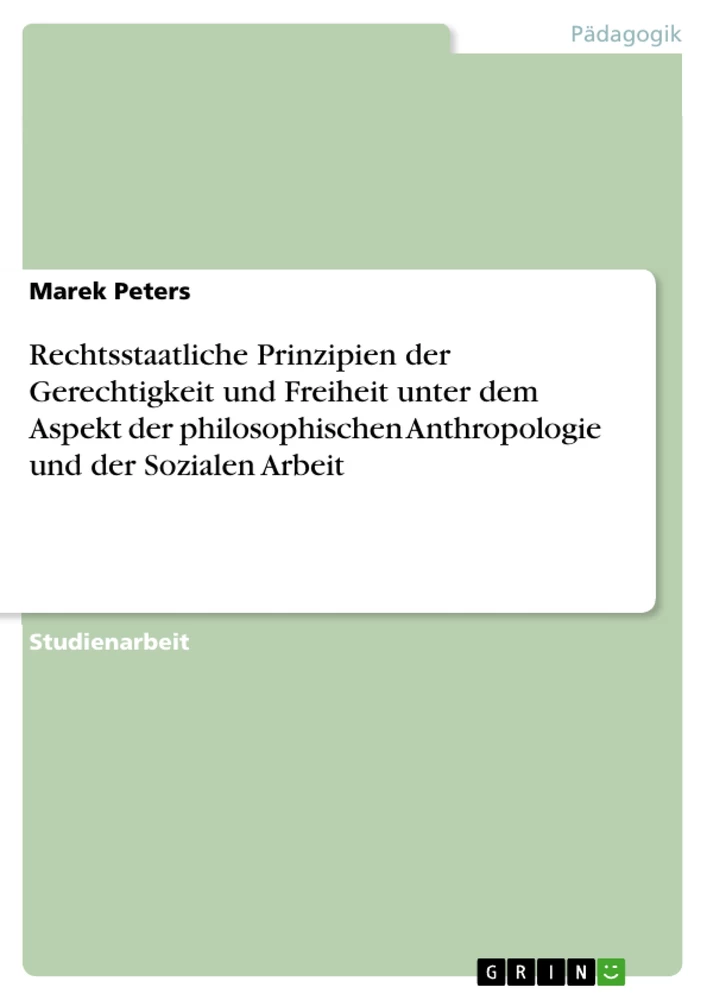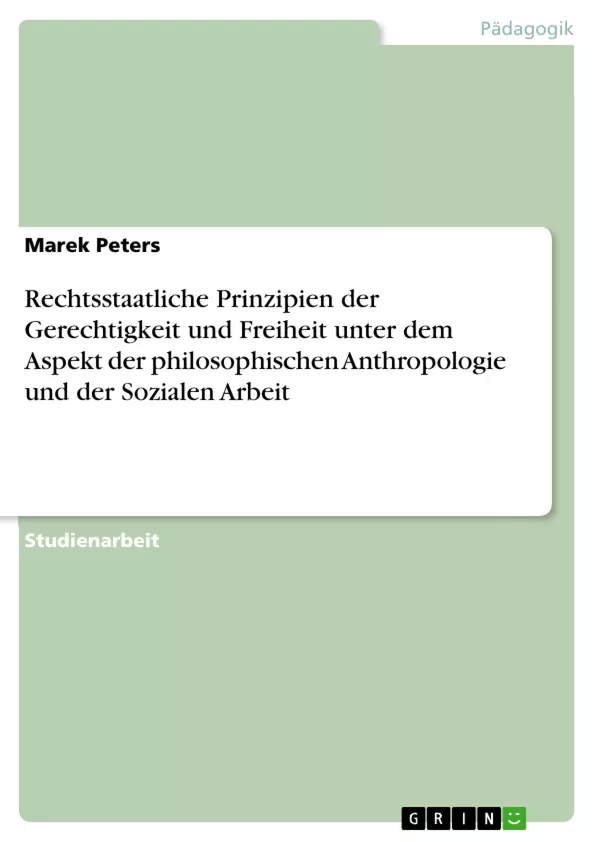Gerechtigkeit und freie Entfaltung sind Schlüsselbegriffe im demokratischen Werteverständnis. Jeder Bürger fordert Gerechtigkeit an sich selbst ein und alle Menschen begehren nach freier Entfaltung. Um den Einzelnen in der menschlichen Gemeinschaft vor Missbrauch und Unterdrückung zu schützen wird im deutschen Grundgesetz klar dargestellt, dass die Gleichberechtigung zu den unveräußerlichen Menschenrechten in der Welt zählt und sich jeder Mensch frei entfalten darf. Untermauert werden diese Gedanken dadurch, dass die Freiheit als unantastbar gilt und nur aufgrund von Gesetzen eingeschränkt werden darf gemäß Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland Art. 1 Abs. 2 und Art. 2 Abs. 1. Die deutsche Verfassung basiert bereits teilweise in ihrem Grundkonzept auf dem klassisch-antiken römischen Recht, jedoch Philosophen wie René Descartes, Thomas Hobbes, John Locke und Jean-Jacques Rousseau sind als Ideenväter und Vordenker des heutigen Demokratieverständnisses und dem Regelwerk des gemeinschaftlichen, gesetzlich überwachten Staatsapparats zu betrachten. Aus ihren Überlegungen heraus prägt sich unser Wertesystem und ihre Thesen prägen auch die Praxis bei der Urteilsfindung in der sozialen Arbeit. Diese Arbeit soll unter Einbringung der philosophischen Denkansätze der Aufklärungszeit darstellen, wie frei der Einzelne in der Neuzeit sein kann. Des Weiteren soll untersucht werden, wie Gerechtigkeit im sozialen Kontext gesellschaftlich umgesetzt werden kann. Dazu wird im ersten Teil Descartes‘ Idee von freiem Denken dargelegt. Anschließend wird im zweiten Abschnitt dieser Arbeit Hobbes‘ Ansatz der Volksvereinigung per Vertrag betrachtet. Das dritte Kapitel dieser Arbeit stellt Lockes Gewaltenteilungsmodell vor, gefolgt von Rousseaus Thesen zur Abschaffung der Herrschaft von Menschen über Menschen im vierten Abschnitt. Die Arbeit ist analytisch aufgebaut unter Einbeziehung von Primär- und Sekundärliteratur zur Herleitung der Theorien und hinführend zur Kernfrage: Wie gerecht ist man in der Praxis der sozialen Arbeit und geht soziale Arbeit ohne Beschneidung der freien Handlungsräume und Entmündigung der betreuten Person einher.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Descartes: Ein Wissenschaftler ruft zum Zweifeln auf.
2. Hobbes: Pakt der Wölfe
3. Lo>
4. Rousseau: Die Befreiung des angeketteten Menschen..
5. Umsetzung der philosophischen Denkansätze in der Praxis der sozialen Arbeit
6. Quellenverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Welche Philosophen prägten das heutige Demokratieverständnis?
Vordenker wie René Descartes, Thomas Hobbes, John Locke und Jean-Jacques Rousseau legten die Grundlagen für das moderne Regelwerk des Staates und der individuellen Freiheit.
Was besagt Thomas Hobbes' Ansatz der Volksvereinigung?
Hobbes beschreibt den Zusammenschluss der Menschen durch einen Vertrag, um Sicherheit und Ordnung in einer Gemeinschaft zu gewährleisten.
Wie wird Gerechtigkeit in der Sozialen Arbeit umgesetzt?
Die Arbeit untersucht, wie philosophische Theorien der Gerechtigkeit in der praktischen Urteilsfindung der Sozialen Arbeit Anwendung finden, ohne die Freiheit des Einzelnen zu beschneiden.
Welche Rolle spielt die Gewaltenteilung nach John Locke?
Lockes Modell der Gewaltenteilung dient dem Schutz vor Missbrauch und Unterdrückung, indem die staatliche Macht auf verschiedene Institutionen verteilt wird.
Was versteht Rousseau unter der Befreiung des Menschen?
Rousseau forderte die Abschaffung der Herrschaft von Menschen über Menschen, um die natürliche Freiheit und Gleichheit wiederherzustellen.
- Quote paper
- B.A. Marek Peters (Author), 2009, Rechtsstaatliche Prinzipien der Gerechtigkeit und Freiheit unter dem Aspekt der philosophischen Anthropologie und der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200130