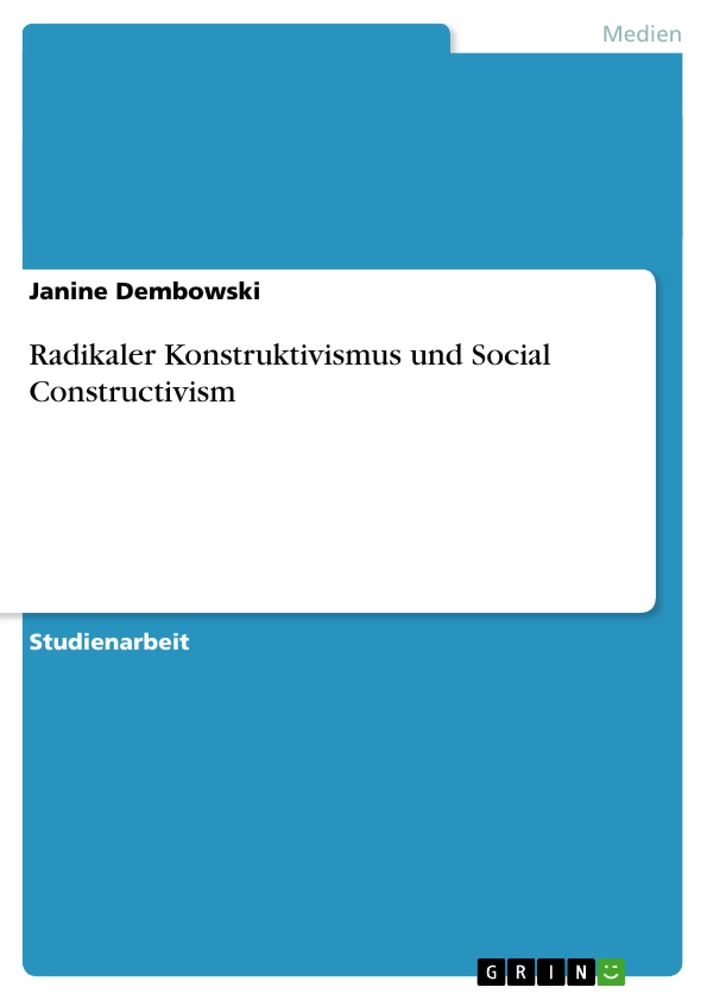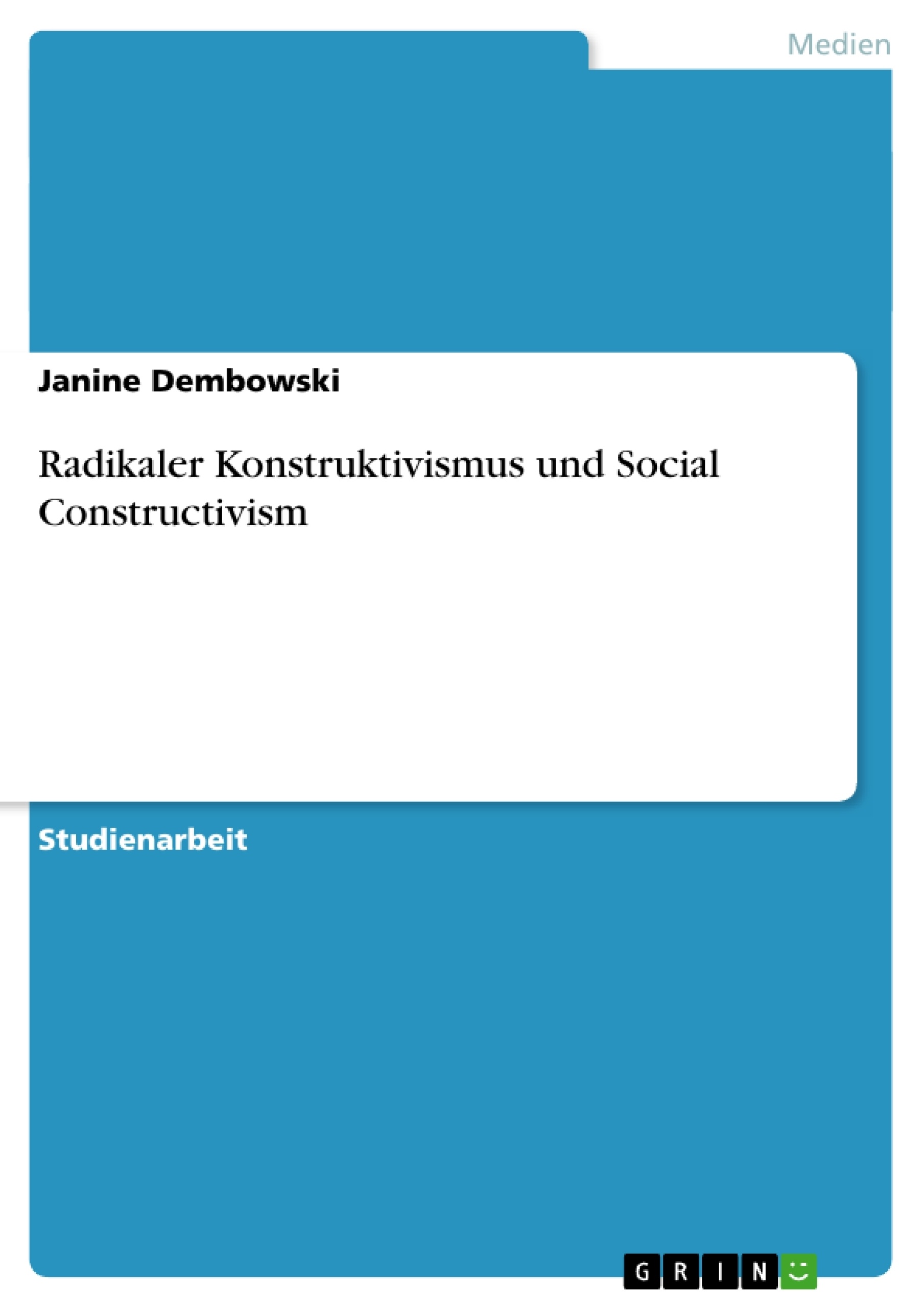Wirklichkeitskonstruktionen durch Kommunikation in unterschiedliche, systemspezifische Bereiche auf verschiedenen Ebenen aus der Sicht von Wolfgang Frindte. Komplexe Prozesse innerhalb der Bildung von Wirklichkeitskonstruktionen werden in diesem Beitrag vereinfacht dargestellt. Durch Beispiele untermautert, folgt eine Gegenüberstellung von Radikalem Konstruktivismus und Social Constructivism.
Prof. Dr. Wolfgang Frindte, geboren 1951 in Thüringen ist studierter Psychologe und habilitierte sich im Bereich Sozialpsychologie. Seit 1997 ist er als Professor für Kommunikationspsychologie an der Universität Jena tätig. Seinen universitärer Forschungsschwerpunkt legt Frindte auf die Konstruktion von Wirklichkeit und den damit verbundenen psychologischen Prozess sowie dessen empirische Begründung aus der Sicht des Konstruktivismus. Insbesondere der Social Constructivism als Gegenposition zum Radikalen Konstruktivismus stellte hierbei das wissenschaftstheoretische Basiskonzept für seine Forschung dar. Der zusammengefasste Beitrag aus dem Sammelwerk von Hans Rudi Fischer (1995) mit dem Titel: „Radikaler Konstruktivismus und Social Constructivism. Sozialpsychologische Folgen und die empirische Rekonstruktion eines Gespenstes”, soll folglich zentrales Thema sein. Hierbei ist die aktive Konstruktion von Wirklichkeit aus der Sicht des Sozialpsychologen Wolfgang Frindte im Zusammenspiel mit den Bereichen Kommunikation, Individuum und Gesellschaft von Bedeutung.
Wolfgang Frindte stellt zunächst die zwei Strömungen des Konstruktivismus vor. Weiter versucht er den Radikalen Konstruktivismus (RK) und den Social Constructivism (SC) (vgl. Klaus/ Drüeke 2012: 6) gegenüberzustellen und überprüft beide Theorien auf deren Schnittmenge mit den Leitdifferenzen „Psychisches” und „Soziales” (vgl. Frindte 1995: 110). Im Ergebnis wird klar, dass sich RK und dem SC signifikant durch die Radikalität im Ansatz der Theorie unterscheiden. Dies ist im Ansatz damit zu begründen, dass der Konstruktivismus in Hinblick auf taditionelle Wissenschafts- und Erkenntnistheorien nicht an bereits bestehende Theorien anknüpft, sondern ein eigenständiges Konzept vom aktiven Wissenserwerb über die objektive Welt durch eine individuelle (RK) oder kollektive (SC) Konstruktion der Wirklichkeit entwirft (vgl. Frindte 1995: 113).
Doch was ist der Motor, das aktivierende Zentrum, für derartige Konstruktionsprozesse? (Vgl. Klaus/ Drüeke 2012: 8) Ist es das individuelle Gehirn als die einzig „harte Instanz” (Frindte 1995: 110) oder das Miteinander in der sozialen Gesellschaft (Frindte 1995: 110)? Auf diese Frage gibt es zwei konträre Antworten. Denn innerhalb des Konstruktivismus vertreten die zwei Strömungen RK und SK trotz dem gemeinsamen Denkansatz stark differente Ansichten gegenüber der gegensätzlichen Strömung (vgl. Frindte 1995: 107).
So ist die Theorie des RK über welche u.a. durch S. J. Schmidt, v. Glasersfeld und v. Foerster (vgl. Frindte 1995: 107; Klaus/ Drüeke 2012: 9) im deutschen Sprachraum bereits häufiger geschrieben wurde als über den SC, eine Synthese aus Neurobiologie und Systemtheorie (vgl. Klaus/ Drüeke 2012: 6) und der SC mit überwiegend amerikanischen und britischen Vertretern wie u.a. K. J. Gergen (vgl. Frindte 1995: 107; Klaus/ Drüeke 2012: 11), eine Verbindung aus Sozialpsychologie, Wissenssoziologie sowie der Erkenntnisgewinnung aus Ereignissen (vgl. Klaus/ Drüke 2012: 6). Diese Unterschiede zwischen RK und SC versucht Wolfgang Frindte im ersten Teil seines Beitrages mit der Überschrift „Ich denke also bin ich, oder: Ich kommuniziere also denke ich” (Frindte 1995: 107) anhand von Gegenüberstellungen zu konkretisieren.
Zunächst nimmt er den beiden Theorien die Komplexität, indem er die Ansätze von RK und SC jeweils auf fünf Grundpostulate verteilt und diese in einem Raster gegenüberstellt (vgl. Frindte 1995: 108). Folglich wird ein Postulat des RK, welches im Einzelnen als Leitfaden bzw. höchstes Gebot einer Theorie die unentbehrliche Voraussetzung für den entsprechenden Gedankengang ist, mit dem passenden Postulat des SC konfrontiert. Im Ergebnis können sowohl die Gemeinsamkeiten und Unterschiede als auch das eventuell Nichtvergleichbare (vgl. Frindte 1995: 108) herausgearbeitet werden. Zur Verteidigung für die Aufstellung dieses Rasters betont Frindte (1995: 108), dass er keine Garantie für Vollständigkeit, Unabhänigkeit oder Widerspruch gewährt.
Das erste Grundpostulat, zusammengefasst „Postulat des radikalen Skeptizismus”, bezieht sich auf den Skeptizismus. Hierbei beschreibt Frindte (1995: 108), dass im RK einzelne Individuen weder fähig sind die vom Bewusstsein unabhängige Umwelt zu erkennen noch die Umwelt zu erschließen, welche selbst von den Individuuen durch interaktives Verhalten und Kommunikation geschaffen wurde. Bekräftigt wird dies durch das zweite „Postulat der kognitiven Selbstreferenz” (Frindte 1995: 108) des RK. In diesem Postulat nennt Frindte (1995: 109) das Gehirn als „selbstreferentielles System”, welches nicht in der Lage ist auf Grund seiner anatomischen Beschaffenheit und physiologischen Merkmale einen Zugang zur Welt herzustellen. Deshalb erkennt nur das Indiviuum selbst die Welt individuell und eigendynamisch (vgl. Klaus/ Drüeke 2012: 8). Die durch Kommunikation zustandekommenden sozialen und wechselseitigen Interaktionen zwischen Individuuen, sind im RK quasi non-existent (vgl. Frindte: 114) oder werden als „interindividuell übereinstimmende kognitive Zustände” (Frindte 1995: 109) gewertet. Dies wird im SC gemäßigter interpretiert. So zweifelt der SC im ersten „Postulat des gemäßigten Skeptizismus” (Frindte 1995: 108) zwar ebenso am direkten Zugang zu einer objektiven Realität (vgl. Klaus/ Drüeke 2012: 8) sowie an deren Abbildung, jedoch wird neben der Akzeptanz der individuellen Konstruktion weniger radikal davon ausgegangen, dass die Konstruktion der Wirklichkeit durch die Kommunikation und den sozialen Diskurs angetrieben wird (vgl. Frindte 1995: 109).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Wer ist Wolfgang Frindte?
Wolfgang Frindte ist ein Professor für Kommunikationspsychologie, der sich intensiv mit der Konstruktion von Wirklichkeit aus sozialpsychologischer Sicht befasst.
Was ist der Hauptunterschied zwischen Radikalem Konstruktivismus (RK) und Social Constructivism (SC)?
Der RK sieht das individuelle Gehirn als selbstreferentielles System der Wirklichkeitskonstruktion, während der SC die Wirklichkeit als Ergebnis sozialer Kommunikation und kollektiver Prozesse betrachtet.
Was besagt das "Postulat des radikalen Skeptizismus" im RK?
Es besagt, dass Individuen unfähig sind, eine vom Bewusstsein unabhängige Umwelt objektiv zu erkennen.
Welche Rolle spielt die Kommunikation im Social Constructivism?
Im SC wird die Kommunikation als der zentrale Motor für die Konstruktion der Wirklichkeit und den sozialen Diskurs angesehen.
Auf welcher theoretischen Basis steht der Radikale Konstruktivismus?
Er wird oft als Synthese aus Neurobiologie und Systemtheorie beschrieben, mit Vertretern wie Glasersfeld und von Foerster.
- Arbeit zitieren
- BA Kommunikationswissenschaft Janine Dembowski (Autor:in), 2012, Radikaler Konstruktivismus und Social Constructivism, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200242