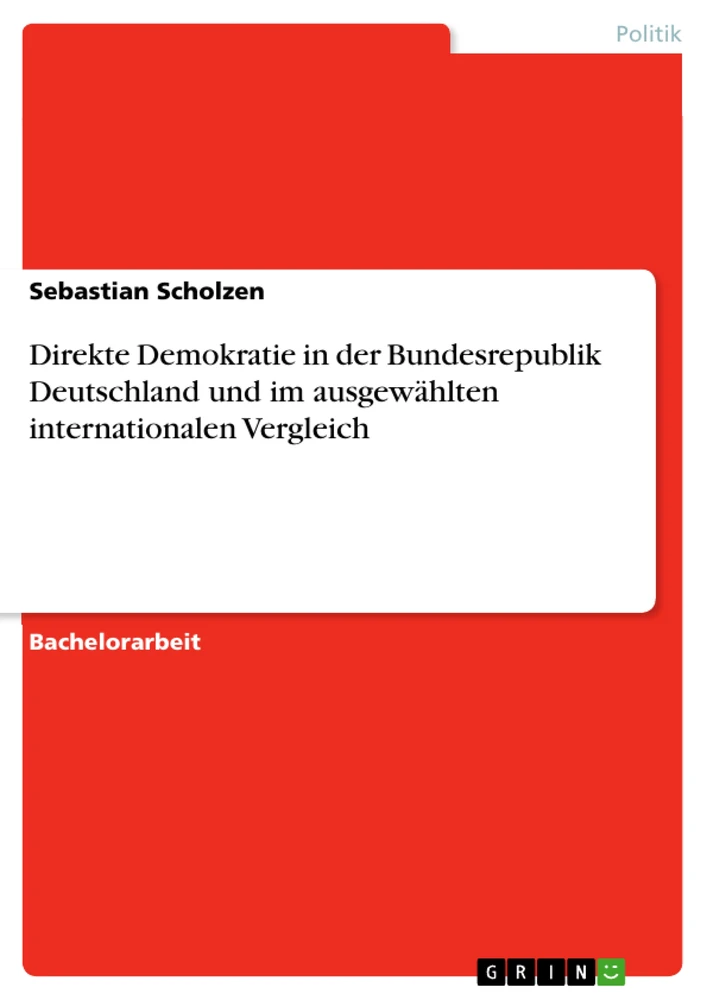Im Zuge der Bachelor-These soll versucht werden, durch den Vergleich der direktdemokratischen Instrumente in der Bundesrepublik Deutschland und in der Schweiz, praktikable Ergänzungen für direktdemokratische Ansätze in der Bundesrepublik Deutschland zu finden.
Die Direkte Demokratie soll kein Modell sein, das in einem Gegensatz zum parlamentarischen System steht. Vielmehr sollte diese Form der Mitbestimmung als eine Ergänzung des parlamentarischen Systems gesehen werden. Dabei soll im Vordergrund stehen, dass der Parlamentarismus nicht unterwandert oder ausgehebelt werden darf, sondern durch direktdemokratische Ansätze ergänzt wird.
Vor diesem Hintergrund werde ich den Vergleich anstellen und versuchen zu erschließen, ob einige der in der Schweiz genutzten direktdemokratischen Instrumente auch in der Bundesrepublik Deutschland anwendbar wären.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition "Direkte Demokratie"
- Historische Herleitung (Entwicklung der Direkten Demokratie)
- Formen Direkter Demokratie auf kommunaler Ebene in der Bundesrepublik Deutschland und in der Schweiz
- Direkte Demokratie auf kommunaler Ebene in der Bundesrepublik Deutschland
- Direkte Demokratie auf kommunaler Ebene in der Schweiz
- Zusammenfassender Vergleich
- Formen Direkter Demokratie auf Länder- und Kantonsebene in der Bundesrepublik Deutschland und in der Schweiz
- Direkte Demokratie auf Länderebene in der Bundesrepublik Deutschland
- Direkte Demokratie auf Kantonsebene in der Schweiz
- Zusammenfassender Vergleich
- Formen Direkter Demokratie auf Bundesebene in der Bundesrepublik Deutschland und in der Schweiz
- Direkte Demokratie auf Bundesebene in der Bundesrepublik Deutschland (sowie der Gesetzentwurf des Vereins „Mehr Demokratie e. V.“)
- Direkte Demokratie auf Bundesebene in der Schweiz
- Zusammenfassender Vergleich
- Formen Direkter Demokratie auf europäischer Ebene
- Gesetzentwurf des Vereins "Mehr Demokratie e.V." für direktdemokratische Verfahren auf europäischer Ebene
- Ausblick und Perspektiven der Direkten Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland & Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelor-Arbeit untersucht die Möglichkeiten, die repräsentative Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland durch direktdemokratische Verfahren zu ergänzen. Im Mittelpunkt steht der Vergleich der direktdemokratischen Instrumente in Deutschland und der Schweiz, um praktikable Ansätze für Deutschland zu finden.
- Definition und historische Entwicklung der direkten Demokratie
- Vergleich der direktdemokratischen Instrumente auf kommunaler, Landes- und Bundesebene in Deutschland und der Schweiz
- Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen und des Themenspektrums in beiden Ländern
- Bewertung der Chancen und Risiken der direkten Demokratie für die Bundesrepublik Deutschland
- Diskussion des Gesetzentwurfs des Vereins "Mehr Demokratie e.V." für die Einführung direktdemokratischer Verfahren auf Bundes- und europäischer Ebene
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Definition des Begriffs "Direkte Demokratie" und beleuchtet dessen historische Entwicklung. Anschließend werden die Formen der direkten Demokratie auf kommunaler Ebene in Deutschland und der Schweiz im Detail verglichen. Dabei werden die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Verfahren und die Themenbereiche beleuchtet. Kapitel 5 widmet sich der direkten Demokratie auf Landes- und Kantonsebene und untersucht die Unterschiede in der Ausgestaltung der direktdemokratischen Instrumente in den beiden Ländern.
Kapitel 6 befasst sich mit der direkten Demokratie auf Bundesebene. Hier werden die rechtlichen Gegebenheiten in Deutschland und der Schweiz gegenübergestellt. Im Fokus steht der Gesetzentwurf des Vereins "Mehr Demokratie e.V." für die Einführung direktdemokratischer Verfahren auf Bundesebene in Deutschland. Kapitel 7 analysiert den Entwurf des Vereins für direktdemokratische Verfahren auf europäischer Ebene. Abschließend werden die Perspektiven der direkten Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland beleuchtet und die Arbeit mit einem Fazit abgerundet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der direkten Demokratie, insbesondere im Vergleich von Deutschland und der Schweiz. Zu den Schlüsselbegriffen gehören: repräsentative Demokratie, direktdemokratische Verfahren, Bürgerbeteiligung, Volksbegehren, Volksentscheid, Volksinitiative, Referendum, obligatorisches Referendum, fakultatives Referendum, Gemeindeordnungen, Landesverfassungen, Bundesverfassung, Gesetzentwurf, "Mehr Demokratie e.V.", Politikverdrossenheit, Medienberichterstattung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Vergleichs zwischen Deutschland und der Schweiz?
Ziel ist es zu prüfen, welche direktdemokratischen Instrumente der Schweiz als Ergänzung für das parlamentarische System in Deutschland sinnvoll sein könnten.
Gibt es direkte Demokratie auf Bundesebene in Deutschland?
Aktuell ist direkte Demokratie auf Bundesebene in Deutschland kaum vorgesehen, weshalb die Arbeit auch Gesetzentwürfe wie die von "Mehr Demokratie e.V." analysiert.
Was sind die wichtigsten Instrumente in der Schweiz?
Dazu gehören Volksinitiativen sowie obligatorische und fakultative Referenden auf kommunaler, kantonaler und Bundesebene.
Soll die direkte Demokratie das Parlament ersetzen?
Nein, die Arbeit betont, dass direkte Demokratie als Ergänzung und nicht als Gegensatz zum parlamentarischen System verstanden werden sollte.
Welche Rolle spielt die kommunale Ebene?
Auf kommunaler Ebene sind Bürgerbegehren und Bürgerentscheide in Deutschland bereits weit verbreitet und werden in der Arbeit mit Schweizer Modellen verglichen.
- Arbeit zitieren
- Sebastian Scholzen (Autor:in), 2009, Direkte Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland und im ausgewählten internationalen Vergleich , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200317