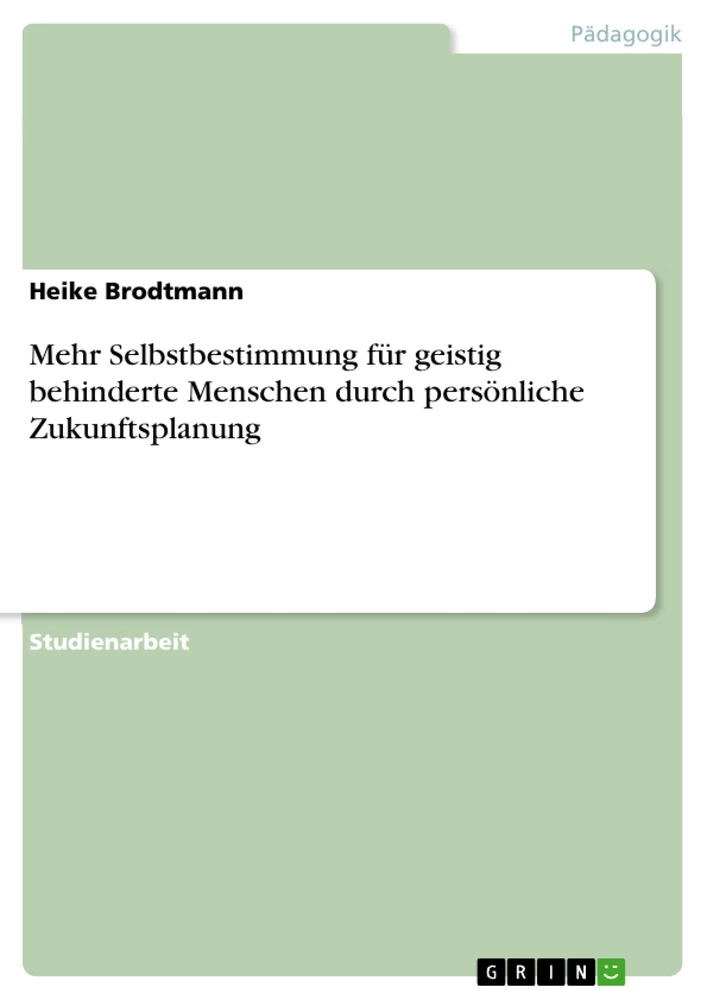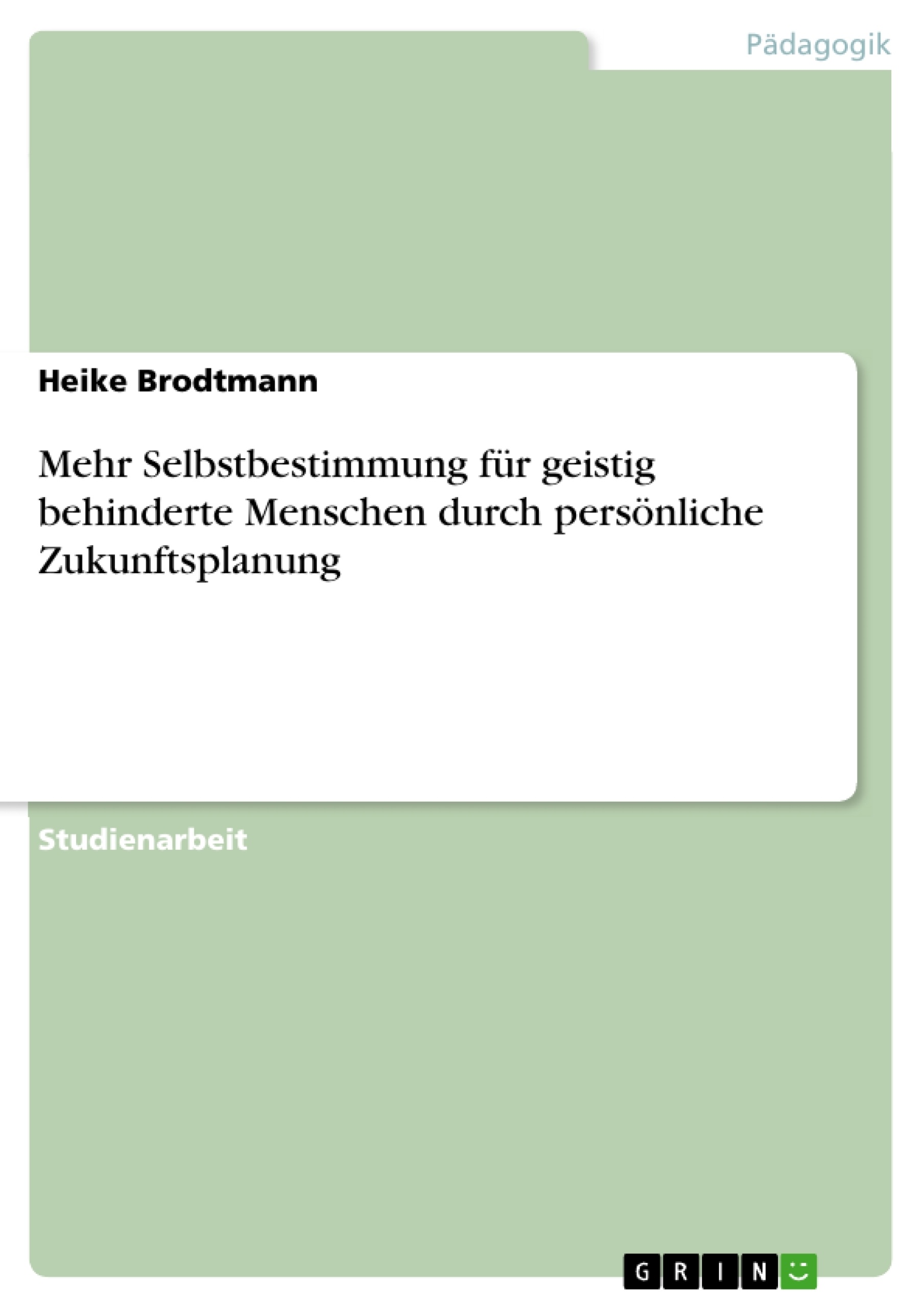In der vorliegenden modulabschließenden Hausarbeit werde ich das Konzept der persönlichen Zukunftsplanung darstellen. Die maßgebende Fragestellung lautet in diesem Zusammenhang: Kann die Selbstbestimmung von Menschen mit einer sog. Geistigen Behinderung durch das Konzept der persönlichen Zukunftsplanung gesteigert werden?
In dem folgenden Kapitel werden Begriffsdefinitionen gegeben, die als Grundlage dienen sollen, um ein Verständnis dafür zu geben, um welche Zielgruppe es sich handelt. Es wird im ersten Schritt eine allgemeine Definition von Behinderung gegeben und darauf aufbauend eine Definition von sog.geistiger Behinderung.
Im dritten Kapitel geht es um die Bedeutung von Identität und Selbstbestimmung. Dabei wird gezielt darauf eingegangen, welchen Stellenwert die Identitätsentwicklung für die Persönlichkeit eines jeden Menschen einnimmt. An dieser Stelle wird ein Bezug auf die Ausprägung des Selbstkonzepts genommen. Darauf aufbauend wird der Begriff der Selbstbestimmung bei Menschen mit einer sog. Geistigen Behinderung genauer betrachtet und seine Bedeutung vorgestellt.
Im vierten Kapitel wird das Konzept der persönlichen Zukunftsplanung beschrieben. Inhaltlich werden zunächst der Ursprung und die Entwicklung dieses Konzepts dargestellt. Im folgenden Abschnitt wird die Zielgruppe der persönlichen Zukunftsplanung beschrieben und darauf aufbauend wird die Durchführung näher erläutert. Ein besonderer Fokus richtet sich dabei auf die möglichen anwendbaren Methoden, sowie die Rolle des Moderators in diesem Prozess.
Abschließend wird im Fazit Bezug genommen auf die eingangs gegebene Fragestellung. Für eine bessere Lesbarkeit werde ich in der Regel männliche Formulierungen verwenden. Frauen sind damit gleichermaßen einbezogen.
Inhalt
1. Einleitung
2. Begriffsdefinition
2.1 Definition von Behinderung
2.2 Definition von sog. geistiger Behinderung
3. Bedeutung von Identität und Selbstbestimmung
3.1 Identitätsentwicklung
3.2 Förderung der Selbstbestimmung bei Menschen mit einer sog. geistigen Behinderung
4. Das Konzept der persönlichen Zukunftsplanung
4.1 Ursprung
4.2 Durchführung
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist "persönliche Zukunftsplanung"?
Es ist ein Konzept, das Menschen mit Behinderung dabei unterstützt, ihre eigenen Wünsche und Ziele für die Zukunft zu formulieren und gemeinsam mit einem Unterstützungskreis umzusetzen.
Wie fördert dieses Konzept die Selbstbestimmung?
Anstatt dass Fachkräfte über den Kopf der Betroffenen hinweg entscheiden, rückt die Zukunftsplanung die individuellen Vorstellungen des Menschen mit Behinderung in das Zentrum aller Entscheidungen.
Welche Rolle spielt der Moderator in diesem Prozess?
Der Moderator leitet den Planungsprozess, achtet darauf, dass die Person mit Behinderung gehört wird, und nutzt kreative Methoden (z.B. grafische Protokolle), um Ziele sichtbar zu machen.
Warum ist Identitätsentwicklung für Menschen mit geistiger Behinderung wichtig?
Ein starkes Selbstkonzept ist die Basis für Selbstbestimmung. Die Arbeit zeigt auf, wie wichtig es ist, dass Menschen mit Behinderung sich als handelnde Subjekte ihrer eigenen Biografie wahrnehmen.
An wen richtet sich die persönliche Zukunftsplanung?
Die primäre Zielgruppe sind Menschen mit sog. geistiger Behinderung, aber das Konzept ist grundsätzlich für alle Menschen in Übergangsphasen oder Veränderungsprozessen geeignet.
- Quote paper
- Heike Brodtmann (Author), 2011, Mehr Selbstbestimmung für geistig behinderte Menschen durch persönliche Zukunftsplanung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200320