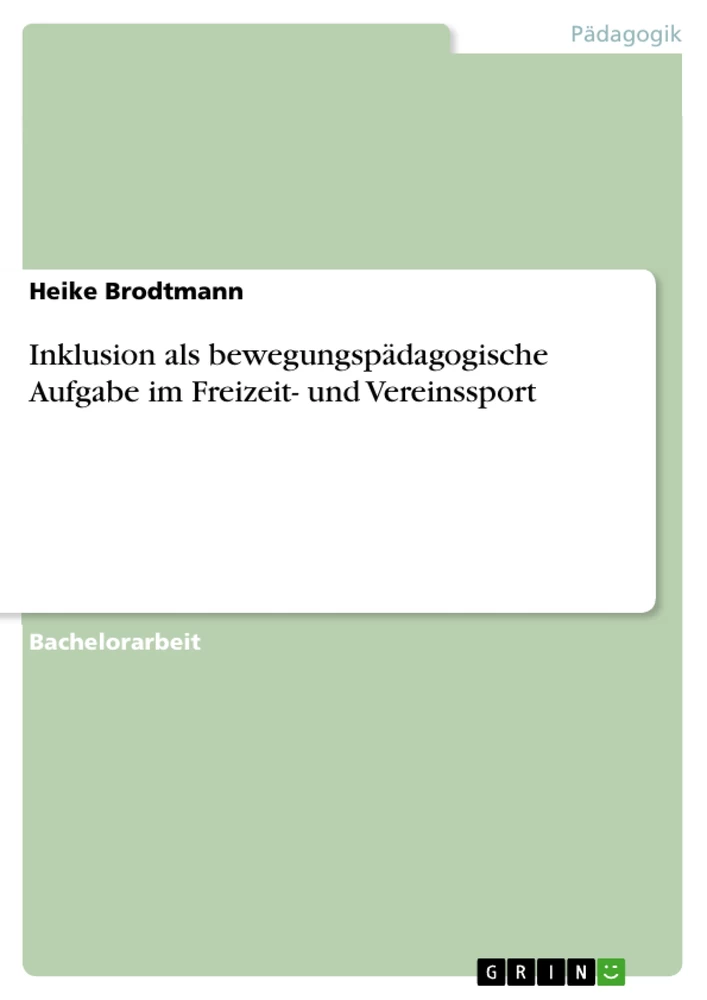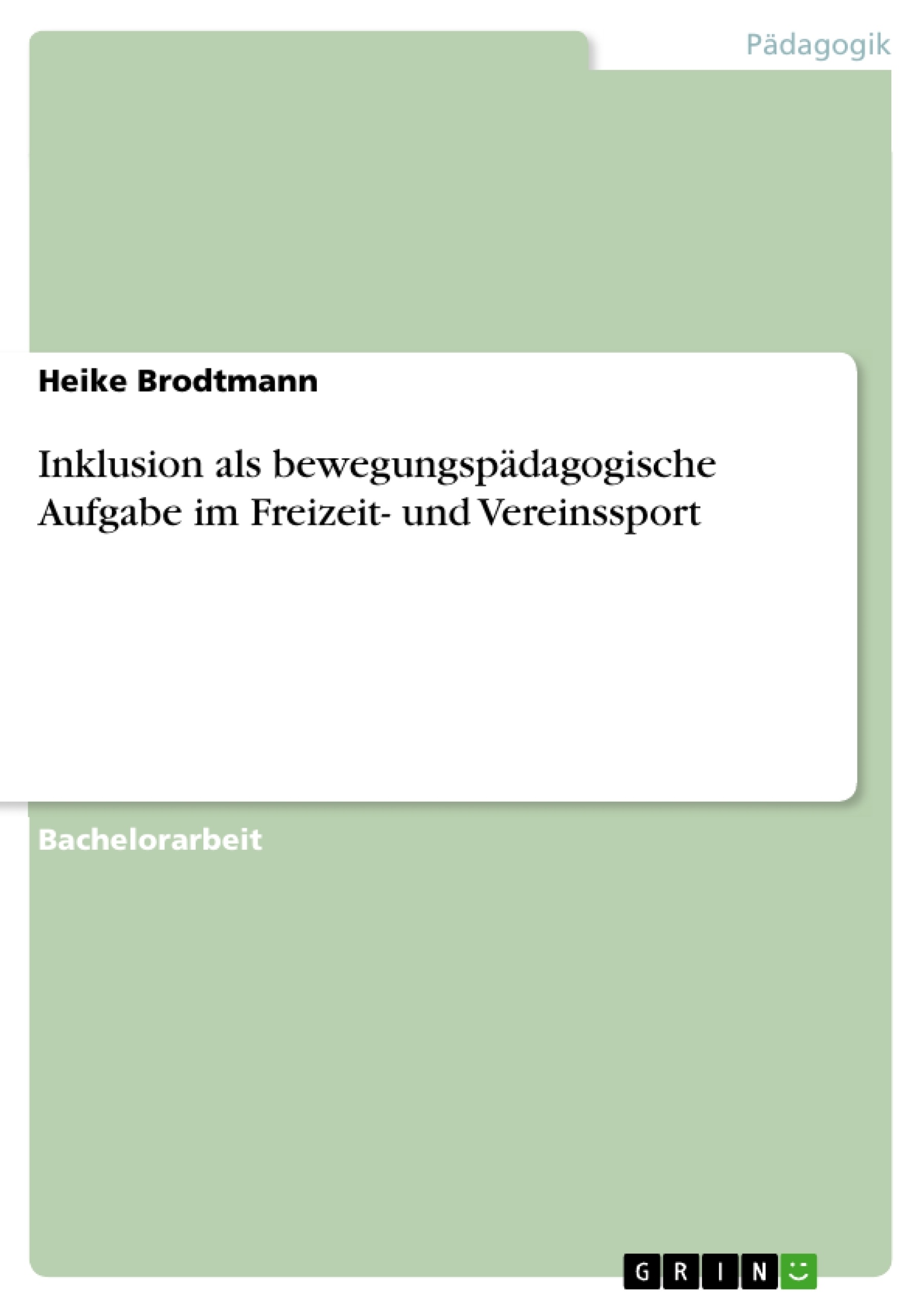1. Einleitung
Das Thema der vorliegenden Bachelorarbeit lautet: 'Inklusion als bewegungspädagogische Aufgabe'. Dem Begriff der Inklusion wird im Behindertenwesen eine immer größer werdende Bedeutung zugeschrieben, dies bezieht sich auf die unterschiedlichsten Bereiche menschlichen Lebens wie zum Beispiel Schule, Arbeit, WOhnen, Freizeit und das gesellschaftliche Leben. In der Entwicklung des behindertenwesens mit Blick auf Inklusion stehen verstärkt der schulische sowie der berufliche Lebensbereich im Vordergrund. Ich gehe mit dieser Arbeit im Allgemeinen auf den Bereich der Freizeit ein und im Besonderen wird der Fokus dabei auf den bewegungspädagogischen Aspekt im Freizeit- und Vereinssport gelegt.
Den Ausgangspunkt für den Themenschwerpunkt dieser Arbeit bildet das Buch "Inklusion als bewegungspädagogische Aufgabe - Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam im SPort" von Friedhold Fediuk (2008a). Dort werden verschiedene Konzepte, Ansätze und Ideen bezüglich des Wandels von der Integration zur Inklusion und der Bewegungspädagogik beleuchtet. Ein abschließender Artikel in dem Buch von Friedhold Fediuk widmet sich der Darstellung eines Modellprojekts aus Deutschland. Das Projekt zur Förderung integrativer Ferien- und Freizeitangebote (PFiFF e.V.) bietet unter anderem Eltern und ANgehörigen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen die Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten Sportverein, des weiteren unterstützt der PFiFF e.V. Vereine bei der konkreten Umsetzung integrativer ANgebote. Dies kann von Ratschlägen bis hin zu professioneller Unterstützung und Hilfsmitteln reichen. Die Tätigkeitsfelder des PFiFF e.V. sind vielseitig, zusätzlich können Hilfestellungen bei Ämtern, Behörden, Krankenkassen und ähnlichem in ANspruch genommen werden. Auch Fort- und Weiterbildungen in den Bereichen von Planung, Fallbesprechung und Supervision gehören dazu (vgl. Markowetz, R. (2008) S. 183 ff.).
Dabei stellt sich folgende Fragestellung: Ist es möglich durch bewegungspädagogische Angebote im Freizeit- und Vereinssport Kinder- und Jugendliche mit Behinderungen nach dem Prinzip der Inklusion die Teilhabe und Partizipation in der Gemeinschaft zu verbessern?
Im folgenden Kapitel wird zunächst der Begriff der Behinderung nach der Weltgesundheitsorganisation definiert. Dies dient der Grundlage, um ein Verständnis dafür zu geben, um welche Zielgruppe es sich handelt.
Im dritten Kapitel wird das Konzept der Inklusion genauer dargestellt. Dabei werden die ....
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Definition des Begriffs Behinderung
3. Inklusion
3.2 Rechtliche Grundlagen von Inklusion
3.2.1 Die Salamanca Erklärung
3.2.2 UN-Behindertenrechtskonvention
4. Bewegungspädagogik
4.1 Bedeutung und Funktion von Bewegung
4.2 Entwicklung und Veränderung in der Bewegungspädagogik für Menschen mit Behinderungen
4.3 Handlungsfelder der Bewegungspädagogik
4.4 Möglichkeiten und Grenzen für Inklusion in der Bewegungspädagogik
4.4.1 Beispiele aus dem inklusiven Schulsport
4.4.2 Möglichkeiten und Grenzen der Inklusion am Beispiel des Schulprojekts ARATIS
5. Fazit
6. Literatur- und Quellenverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Inklusion im Freizeit- und Vereinssport?
Es bedeutet, dass Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam Sport treiben, wobei Barrieren abgebaut werden, um echte Teilhabe zu ermöglichen.
Was ist die Aufgabe der Bewegungspädagogik in diesem Kontext?
Sie nutzt Bewegung als Medium, um die individuelle Entwicklung zu fördern und soziale Partizipation innerhalb der Gemeinschaft zu verbessern.
Welche rechtlichen Grundlagen stützen die Inklusion?
Zentrale Dokumente sind die Salamanca-Erklärung und die UN-Behindertenrechtskonvention.
Was ist das Projekt PFiFF e.V.?
Ein Modellprojekt, das Familien bei der Suche nach inklusiven Sportangeboten unterstützt und Vereine bei der Umsetzung integrativer Konzepte berät.
Wie definiert die WHO den Begriff Behinderung?
Behinderung wird als Wechselwirkung zwischen gesundheitlichen Beeinträchtigungen und umweltbedingten sowie einstellungsbezogenen Barrieren verstanden.
Gibt es Grenzen für Inklusion im Schulsport?
Die Arbeit diskutiert Möglichkeiten und Grenzen anhand von Beispielen wie dem Schulprojekt ARATIS, wobei oft Rahmenbedingungen und Ressourcen limitierende Faktoren sind.
- Arbeit zitieren
- Heike Brodtmann (Autor:in), 2012, Inklusion als bewegungspädagogische Aufgabe im Freizeit- und Vereinssport, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200322