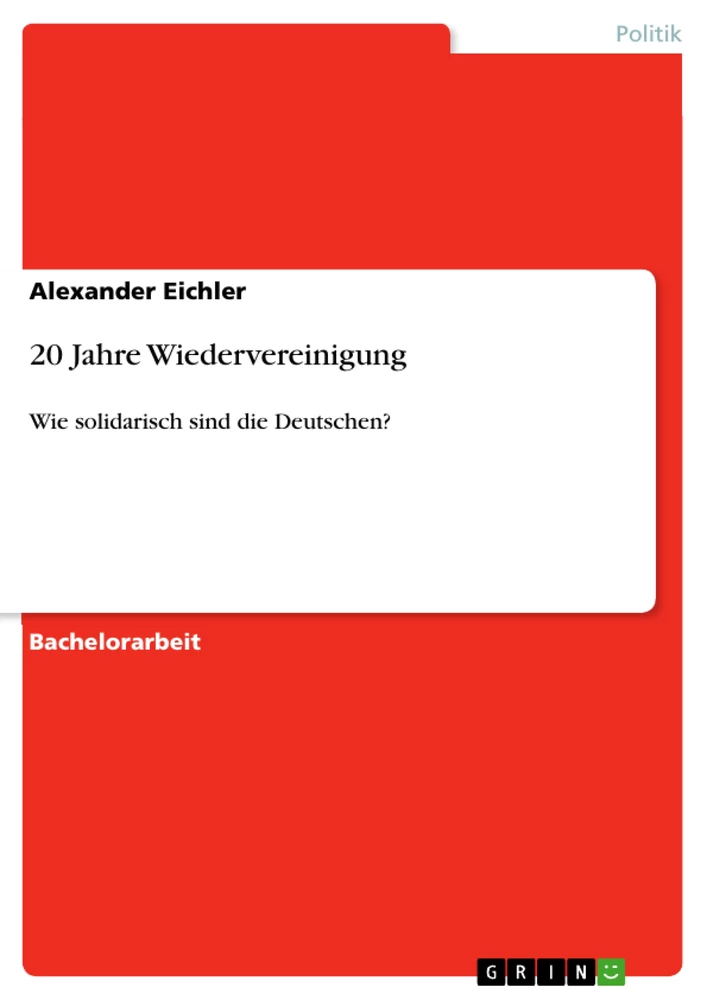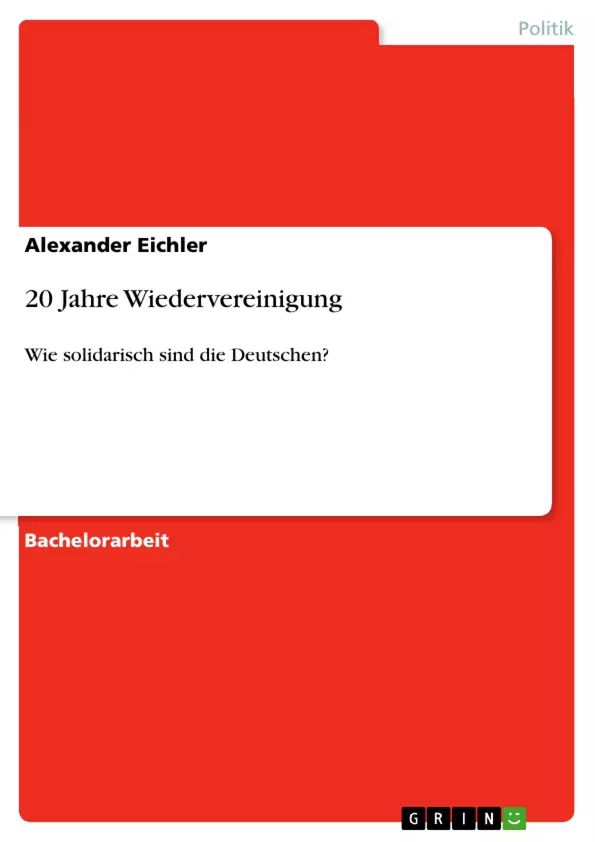20 Jahre nach der Wiedervereinigung haben Bilanzen des Einigungsprozesses in Deutschland Konjunktur. Auch der Anlass für diese Arbeit waren der Jahrestag am 3. Oktober 2010 und die emotional geführten öffentlichen Debatten zum Stand der deutschen Einheit.
Mehr als 65 Jahre liegen nun die Entscheidungen von Jalta zurück, doch die Folgen der deutschen Aggression sind noch bis heute schmerzhaft zu spüren. Die Teilung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg war unnatürlich und von den Siegermächten aufoktroyiert. Als im Jahr 1989 der „Eiserne Vorhang“ fiel, wurden die tiefen Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland, die aufgrund der gegensätzlichen Lebenswege entstanden waren, rigoros entblößt. Auf der einen Seite hatte sich im Westen die ehemalige Bundesrepublik hin zu Demokratie und Marktwirtschaft entwickelt und dem gegenüber stand auf der anderen Seite im Osten eine Parteidiktatur und der Zentralplan der Deutschen Demokratischen Republik, die unter der sowjetischen Führung eine politisch eher abgekapselte Rolle spielte. Aus diesem Grund waren weder Staat, noch Wirtschaft, noch Gesellschaft der ehemaligen DDR für die neu gewonnene Freiheit gerüstet. Gewohnte sozialpolitische Leitbilder, Legitimationsideen und Solidaritätsvorstellungen verschwanden und die ehemaligen Bürger der DDR mussten sich von heute auf morgen einem komplett unbekannten System anpassen.
Doch nicht nur die Menschen mussten ihre individuellen Lebensweisen den neuen Umständen angleichen. Die Wiedervereinigung war in erster Linie eine immense fiskalische Herausforderung. Vereinfacht ausgedrückt verteilten sich Kosten und Lasten auf drei Haushaltsbereiche. Zum einen auf die Haushalte des Bundes, der westdeutschen Gemeinden und der Länder. Zweitens wurden verschiedene Sondervermögen verwendet und drittens die Haushalte der Sozialversicherung. Aufgrund dieser Verteilung ist es schwer, den Umfang der Vereinigungskosten präzise zu ermitteln. Die vorliegende Arbeit wird aber versuchen, diesen in den öffentlichen Diskursen sehr beliebten Streitpunkt näher zu untersuchen, um weitverbreitete Vorurteile zu beseitigen. Zusätzlich werden mögliche Ost-West-Kontraste bezüglich des materiellen Wohlstandsniveaus anhand von aggregierten ökonomischen Indikatoren wie Arbeitslosigkeit und Einkommenverteilung thematisiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Solidarität
- Annäherung an Begriff und Bedeutung
- Perspektiven und Denkmodelle
- 20 Jahre Wiedervereinigung – Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Ost und West
- Aufbau Ost - ein nie endender Aufholprozess?
- Zufriedenheit und Wohlbefinden der Deutschen
- Krise des Sozialstaats? Suche nach Gründen
- Bevölkerungsveränderungen
- Wohlstandsveränderungen
- Solidarität in Deutschland
- Das Rentensystem
- Die gesetzliche Krankenversicherung
- Der Solidaritätszuschlag und der Solidarpakt
- Freiwilliges soziales Engagement in der Zivilgesellschaft
- Die Jugend – eine pragmatische Generation
- Solidaritätsschwund oder nur ein Strukturwandel? Was muss getan werden, um Solidarität in Deutschland zu fördern?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Solidarität in Deutschland 20 Jahre nach der Wiedervereinigung. Sie untersucht die Entwicklung der Solidarität im Kontext der deutschen Einheit und analysiert, wie sich die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland auf die Solidarität auswirken. Die Arbeit beleuchtet auch die Herausforderungen, die der Sozialstaat durch demografische Veränderungen und den Wandel der Wohlstandsverhältnisse erlebt.
- Untersuchung der Entwicklung der Solidarität in Deutschland im Kontext der Wiedervereinigung
- Analyse der Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland in Bezug auf die Solidarität
- Bewertung der Herausforderungen, die der Sozialstaat durch demografische Veränderungen und den Wandel der Wohlstandsverhältnisse erlebt
- Beurteilung des Einflusses des Solidaritätszuschlags und des Solidarpakts auf die Solidarität in Deutschland
- Untersuchung der Einstellungen der Jugend in Deutschland zur Solidarität
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Hintergrund der Arbeit dar und beleuchtet die Auswirkungen der Wiedervereinigung auf die deutsche Gesellschaft. Kapitel 2 definiert den Begriff der Solidarität und stellt verschiedene Denkmodelle vor. Kapitel 3 untersucht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Ost- und Westdeutschland in den letzten 20 Jahren. Kapitel 4 analysiert die Herausforderungen, die der Sozialstaat durch Bevölkerungsveränderungen und Wohlstandsveränderungen erlebt. Kapitel 5 betrachtet verschiedene Bereiche der Solidarität in Deutschland, einschließlich des Rentensystems, der Krankenversicherung, des Solidaritätszuschlags, des Solidarpakts und des freiwilligen Engagements. Abschließend beschäftigt sich Kapitel 6 mit der Frage, ob es einen Solidaritätsschwund in Deutschland gibt und welche Maßnahmen getroffen werden können, um die Solidarität zu fördern.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Solidarität, Wiedervereinigung, Ost-West-Unterschiede, Sozialstaat, demografischer Wandel, Wohlstandsveränderungen, Rentensystem, Krankenversicherung, Solidaritätszuschlag, Solidarpakt, freiwilliges Engagement und Jugend. Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Solidarität in Deutschland nach der Wiedervereinigung und analysiert die Auswirkungen der politischen und wirtschaftlichen Veränderungen auf die gesellschaftliche Solidarität.
Häufig gestellte Fragen
Wie haben sich die Vereinigungskosten auf die Haushalte verteilt?
Die fiskalischen Lasten verteilten sich auf die Haushalte des Bundes, der Länder und Gemeinden, verschiedene Sondervermögen sowie auf die Sozialversicherungen.
Welche Rolle spielen der Solidarpakt und der Solidaritätszuschlag?
Diese Instrumente dienen dazu, den „Aufbau Ost“ finanziell zu unterstützen und die infrastrukturellen sowie wirtschaftlichen Unterschiede zwischen Ost und West auszugleichen.
Gibt es 20 Jahre nach der Einheit noch materielle Wohlstandsunterschiede?
Ja, Indikatoren wie Arbeitslosigkeit und Einkommensverteilung zeigen, dass trotz eines Aufholprozesses weiterhin signifikante Kontraste zwischen den alten und neuen Bundesländern bestehen.
Wie wird die Solidarität der jungen Generation eingeschätzt?
Die Arbeit beschreibt die heutige Jugend als eine „pragmatische Generation“, deren Verständnis von gesellschaftlicher Solidarität sich im Vergleich zu früheren Generationen gewandelt hat.
Was sind die größten Herausforderungen für den Sozialstaat nach der Wende?
Neben den Kosten der Einheit belasten vor allem demografische Veränderungen und der Wandel der Wohlstandsverhältnisse das Renten- und Krankenversicherungssystem.
- Arbeit zitieren
- Master of Arts Alexander Eichler (Autor:in), 2011, 20 Jahre Wiedervereinigung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200504