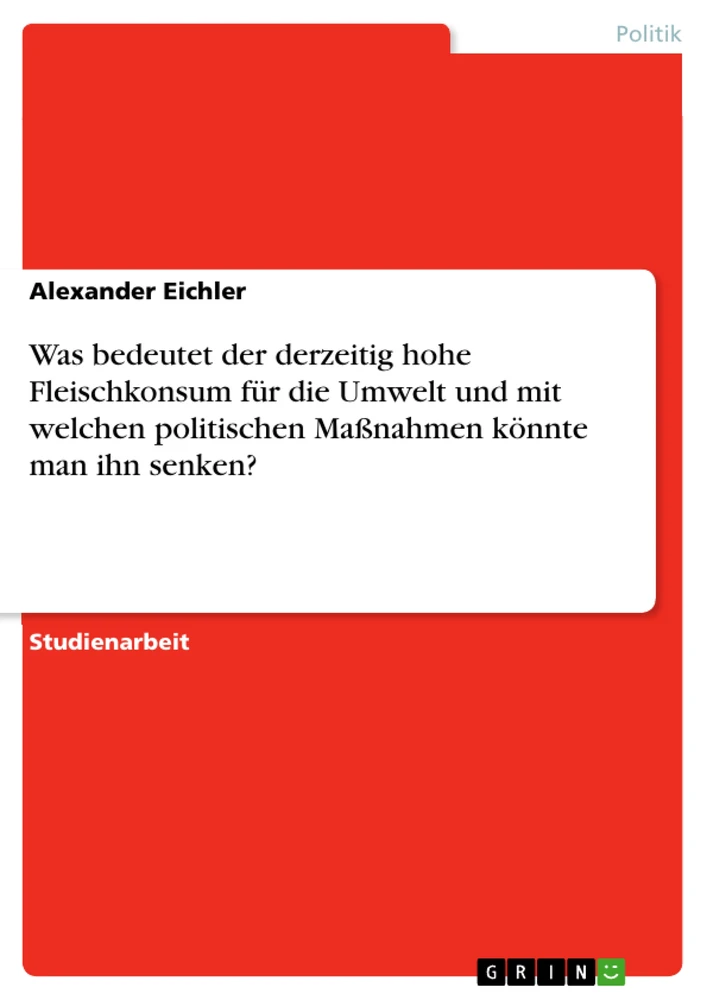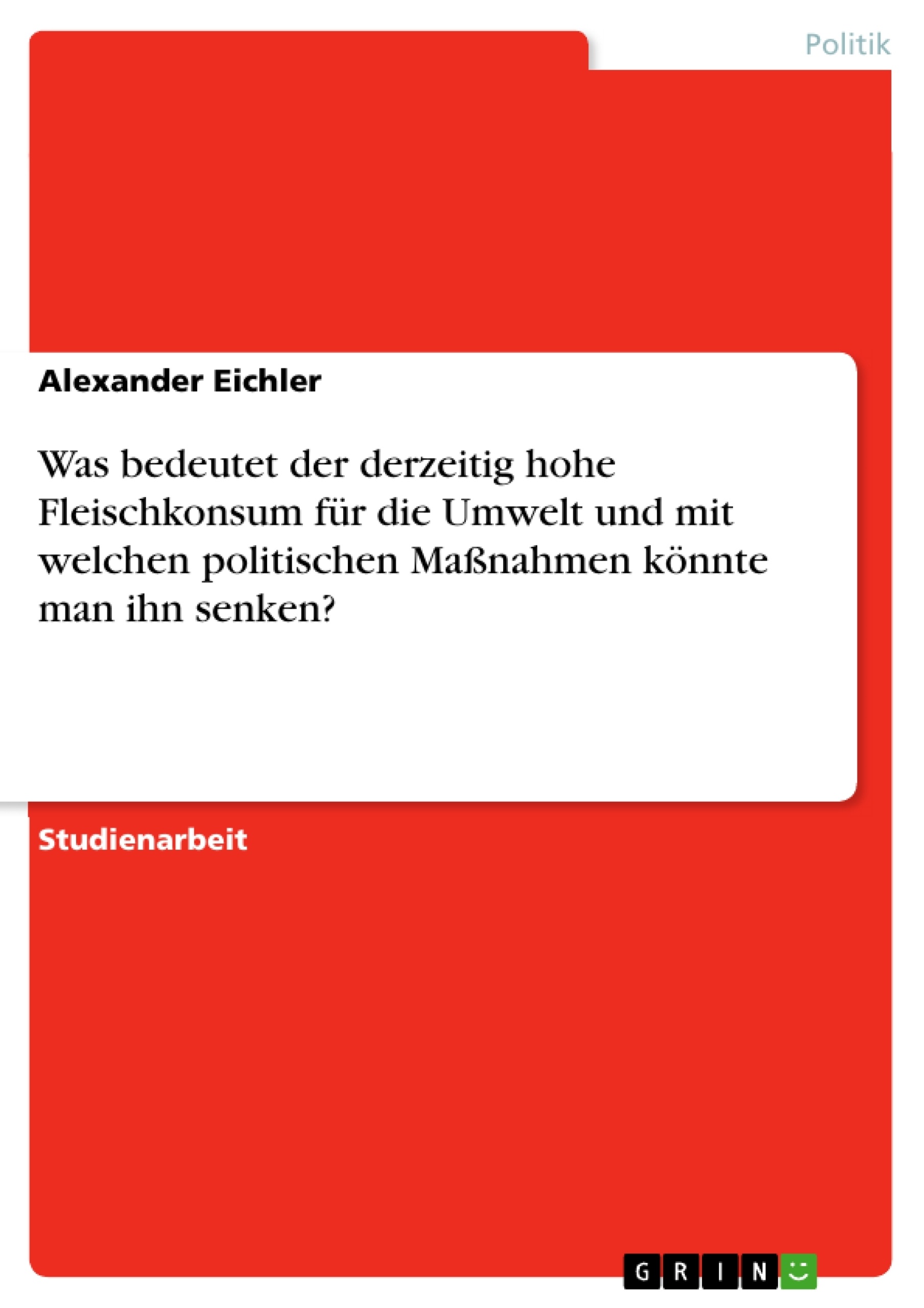„Nichts wird die Chance auf ein Überleben auf der Erde so steigern, wie der Schritt zur vegetarischen Ernährung.“
Liest man dieses Zitat, so kann man sich kaum vorstellen, dass es von Albert Einstein, einem der genialsten Physiker der Menschheit, stammt. Trotzdem weist es auf eine sehr bedeutende Problematik hin, die in unserer heutigen Zeit medial und politisch zu wenig Beachtung erhält. Auch diese Arbeit wird sich mit dem Problemfeld des hohen Fleischkonsums auseinandersetzen und die damit zusammenhängenden ökologischen Konsequenzen aufzeigen. Außerdem werden politische Maßnahmen zur Senkung des Fleischkonsums diskutiert, um letztendlich einen systemverträglichen Lösungsansatz zu finden.
Als Grundlagen für die hier präsentierten Ausführungen dienten hauptsächlich verschiedene Aufsätze und Dissertationen, die sich mit dem Fleischverzehr in Deutschland und dem spezifischen Verbraucherverhalten beschäftigen. Des Weiteren wurde bewusst versucht möglichst neutrale Literatur zu verwenden, weil nur so ein unbefangenes Bild zu dieser Thematik skizziert werden kann.
Laut Fleischbeschaugesetz spricht man von Fleisch, wenn es sich um alle frischen und zubereiteten Teile warmblütiger Tiere, die sich für den menschlichen Verzehr eignen, handelt. Trotz dieser Eingrenzung muss man natürlich festhalten, dass auch Meerestiere und andere nicht-warmblütige Individuen durchaus als Fleischquellen anzusehen sind. Für die folgenden Betrachtungen genügt diese Definition jedoch völlig, da größtenteils auf die Produktion von Großvieh eingegangen wird. Hierbei werden insbesondere Fleischprodukte behandelt, die in Deutschland verzehrt und auch produziert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklung des Fleischkonsums: Hintergründe, Daten und Fakten
- Konsequenzen des hohen Fleischkonsums
- Politische Maßnahmen um den Fleischkonsum zu senken
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die ökologischen Folgen des hohen Fleischkonsums in Deutschland und diskutiert mögliche politische Maßnahmen zur Senkung des Verzehrs. Ziel ist es, einen systemverträglichen Lösungsansatz zu finden.
- Historische Entwicklung des Fleischkonsums in Deutschland
- Ökologische Konsequenzen des hohen Fleischkonsums
- Politische Strategien zur Reduktion des Fleischkonsums
- Verbraucherverhalten und dessen Einfluss auf den Fleischkonsum
- Mögliche Lösungsansätze für einen nachhaltigeren Fleischkonsum
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik des hohen Fleischkonsums und dessen ökologische Konsequenzen dar. Sie benennt das Ziel der Arbeit, einen systemverträglichen Lösungsansatz zu finden, und erläutert die methodische Vorgehensweise, die auf der Auswertung von Aufsätzen und Dissertationen zum Fleischverzehr in Deutschland basiert. Die Einleitung hebt die Bedeutung der neutralen Literaturwahl hervor, um ein unbefangenes Bild der Thematik zu zeichnen. Sie definiert den Begriff „Fleisch“ gemäß Fleischbeschaugesetz und erwähnt die Herausforderungen in Bezug auf das Verbrauchervertrauen nach diversen Lebensmittelskandalen. Schließlich wird die Diskrepanz zwischen den Wünschen der Verbraucher nach umweltfreundlicher Fleischproduktion und dem tatsächlichen Konsumverhalten hervorgehoben, wobei auf die Überversorgung der Bevölkerung mit Energie und Nährstoffen hingewiesen wird. Die Einleitung führt in die folgende Analyse der historischen Entwicklung des Fleischkonsums ein.
Entwicklung des Fleischkonsums: Hintergründe, Daten und Fakten: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Fleischkonsums, beginnend bei den Urmenschen als Allesfresser bis zur heutigen Massentierhaltung. Es beschreibt die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Faktoren, die den Fleischkonsum beeinflusst haben, wie z.B. die Bevölkerungsentwicklung, religiöse und hygienische Aspekte, Preisentwicklung und die Industrialisierung. Der Text veranschaulicht den Wandel vom seltenen Luxusgut zum Massenprodukt und zeigt mithilfe statistischer Daten den starken Anstieg des Pro-Kopf-Verbrauchs im Laufe der Zeit. Die Analyse umfasst die verschiedenen Phasen der Fleischproduktion und -verarbeitung sowie die Veränderungen im Verbraucherverhalten. Der Fokus liegt auf dem deutschen Kontext, aber auch der globale Kontext wird angesprochen. Der Abschnitt endet mit einem Ausblick auf zukünftige Entwicklungen, um die Tragweite des Problems des hohen Fleischkonsums zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Fleischkonsum, Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, ökologische Konsequenzen, politische Maßnahmen, Verbraucherverhalten, Massentierhaltung, Lebensmittelskandale, Ressourcenverbrauch, Gesundheit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Ökologische Folgen des hohen Fleischkonsums in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die ökologischen Folgen des hohen Fleischkonsums in Deutschland und diskutiert mögliche politische Maßnahmen zur Senkung des Verzehrs. Ziel ist es, einen systemverträglichen Lösungsansatz zu finden.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Fleischkonsums in Deutschland, die ökologischen Konsequenzen des hohen Fleischkonsums, politische Strategien zur Reduktion des Fleischkonsums, das Verbraucherverhalten und dessen Einfluss, sowie mögliche Lösungsansätze für einen nachhaltigeren Fleischkonsum.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zur Entwicklung des Fleischkonsums mit Hintergründen und Daten, und eine Zusammenfassung. Das Kapitel zur Entwicklung des Fleischkonsums beinhaltet Unterkapitel zu den Konsequenzen des hohen Fleischkonsums und politischen Maßnahmen zur Senkung des Verbrauchs.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung stellt die Problematik des hohen Fleischkonsums und dessen ökologische Konsequenzen dar. Sie benennt das Ziel der Arbeit, erläutert die methodische Vorgehensweise (Auswertung von Aufsätzen und Dissertationen), hebt die Bedeutung der neutralen Literaturwahl hervor, definiert den Begriff „Fleisch“, erwähnt Herausforderungen bezüglich des Verbrauchervertrauens und die Diskrepanz zwischen Wunsch und tatsächlichem Konsumverhalten.
Worüber handelt das Kapitel "Entwicklung des Fleischkonsums"?
Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Fleischkonsums von den Urmenschen bis zur heutigen Massentierhaltung. Es beschreibt gesellschaftliche und wirtschaftliche Einflussfaktoren (Bevölkerungsentwicklung, Religion, Hygiene, Preisentwicklung, Industrialisierung), den Wandel vom Luxusgut zum Massenprodukt, den Anstieg des Pro-Kopf-Verbrauchs, verschiedene Phasen der Fleischproduktion und -verarbeitung, Veränderungen im Verbraucherverhalten (deutscher und globaler Kontext) und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Fleischkonsum, Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, ökologische Konsequenzen, politische Maßnahmen, Verbraucherverhalten, Massentierhaltung, Lebensmittelskandale, Ressourcenverbrauch und Gesundheit.
Welche Methode wurde angewendet?
Die Arbeit basiert auf der Auswertung von Aufsätzen und Dissertationen zum Fleischverzehr in Deutschland. Es wird auf eine neutrale Literaturwahl geachtet, um ein unbefangenes Bild der Thematik zu zeichnen.
Welches Ziel verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, einen systemverträglichen Lösungsansatz für den hohen Fleischkonsum in Deutschland zu finden.
- Citar trabajo
- Master of Arts Alexander Eichler (Autor), 2010, Was bedeutet der derzeitig hohe Fleischkonsum für die Umwelt und mit welchen politischen Maßnahmen könnte man ihn senken?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200509