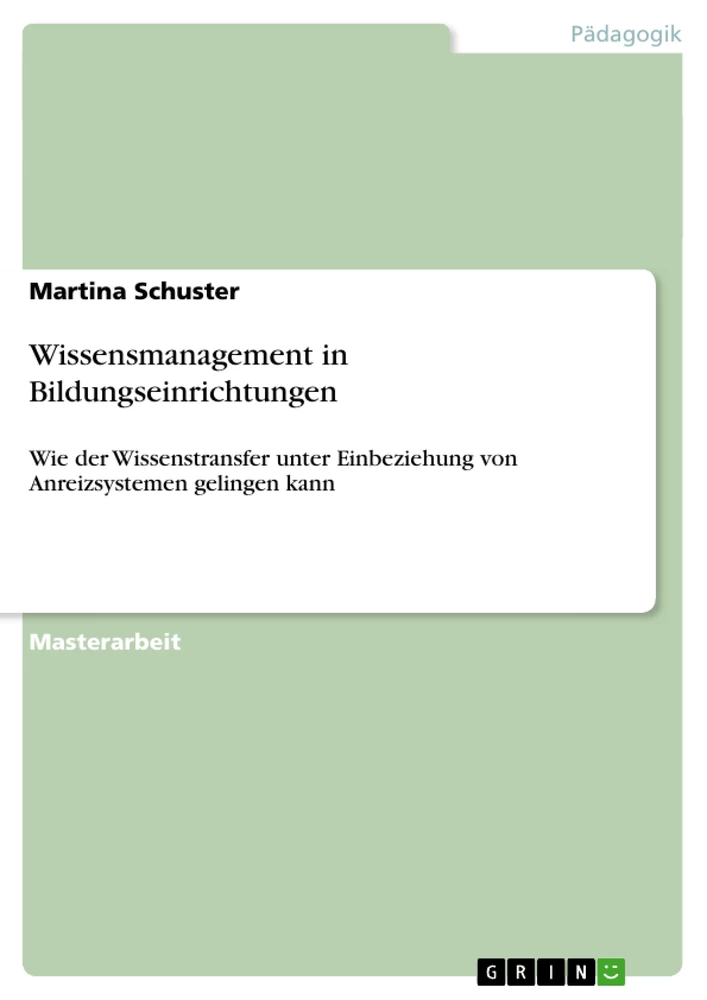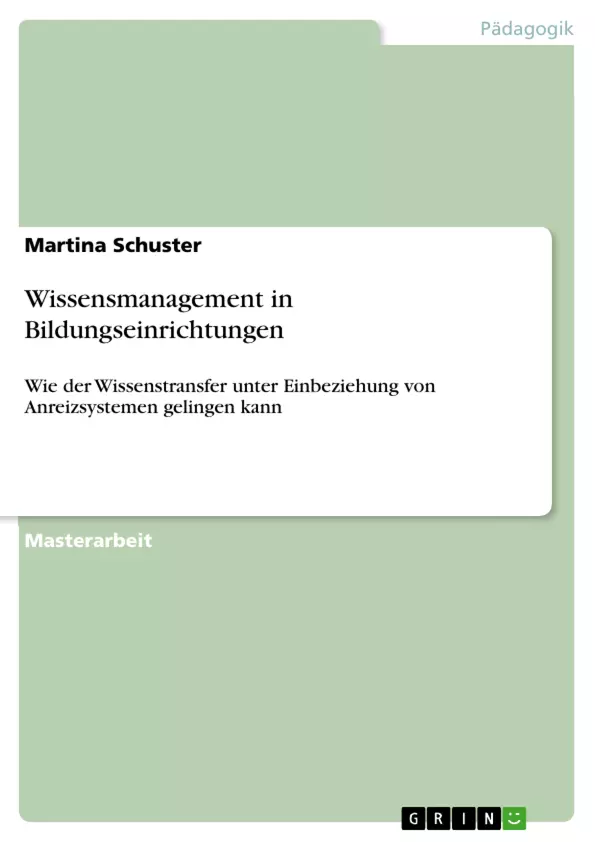Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht die Veranschaulichung der Relevanz von Wissensmanagement für Bildungseinrichtungen. Die Debatte um wirkungsvolle Konzepte und deren Legitimation hält seit einigen Jahren an, jedoch sind Best-Practice-Ansätze hauptsächlich in Wirtschaftsbetrieben zu finden bzw. werden Konzepte für eben solche entwickelt.
Bildungseinrichtungen müssen sich gleichermaßen wie Wirtschaftsbetriebe einer zunehmend dynamischen Umwelt stellen. Einen Beitrag dazu kann Wissensmanagement leisten, indem Wissen als wichtige Ressource identifiziert, gepflegt und gesteuert wird. Organisational betrachtet muss es gelingen, erfolgskritisches Wissen zu sichern und innovative Bildungsprodukte zu generieren, um dem Wettbewerb standhalten zu können. Bezieht man die individuelle Perspektive noch mit ein, kann Wissensmanagement auch zur Kompetenzentwicklung einzelner Mitarbeiter genutzt werden. Für die Erreichung dieser Ziele scheint das Münchener Modell von Reinmann-Rothmeier und Mandl besonders geeignet zu sein, da es neben der be-triebswirtschaftlichen auch eine psychologisch-pädagogische Sichtweise einnimmt. Dieses Modell zeigt diverse Ansatzmöglichkeiten für Interventionen auf. So verlockend die Vereinfachung durch ein Modell erscheint, darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass der Wissensprozess an sich ein komplexer und zum Teil schwer greifbarer Vorgang ist. Insbesondere wenn es um Wissenstransfer, also die Weitergabe von Know-how von Mitarbeiter zu Mitarbeiter geht, gibt es zahlreiche Kommunikationsstörungen, die den Prozess beeinträchtigen können. Daher ist es wichtig, erste Symptome von Kommunikationsstörungen wahrzunehmen und den Ursachen auf den Grund zu gehen.
Ein weiterer zentraler Aspekt für den Erfolg von Wissensmanagementaktivitäten ist die Einbeziehung geeigneter Anreize. Während Anreizsysteme in Wirtschaftsunter-nehmen zum Standardinstrumentarium gehören, um Mitarbeiter zu bestimmtem Verhalten zu animieren, scheint diese Begrifflichkeit im Bildungssektor ein Fremd-wort zu sein. Anreize werden hier unter anderem Namen verwendet und -wenn überhaupt- aus der Perspektive der Personalentwicklung betrachtet. Dennoch lässt sich ein weites Spektrum an Instrumenten identifizieren, insbesondere solche, die nicht monetärer Art sind. Diese können analog auf den Bildungsbereich übertragen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Forschungsfrage
- 1.2 Ziel der Arbeit
- 2. Theoretischer Bezugsrahmen
- 2.1 Wissensmanagement und Bildungsmanagement
- 2.1.1 Wissen
- 2.1.1.1 Wissenstypologien
- 2.1.2 Konzepte des Wissensmanagements
- 2.1.2.1 Modell der Wissenstransformation
- 2.1.2.2 Baustein-Modell
- 2.1.2.3 Münchener Wissensmanagement Modell
- 2.1.3 Wissenstransfer
- 2.1.3.1 Probleme beim Wissenstransfer
- 2.2 Bildungseinrichtungen als Expertenorganisationen
- 2.2.1 Besonderheiten von Non-Profit-Organisationen
- 2.2.2 Formen des Lernens in Bildungsorganisationen
- 2.3 Möglichkeiten der betrieblichen Anreizgestaltung
- 2.3.1 Rolle der Motivation
- 2.3.2 Betrieblichen Anreizsysteme
- 2.3.2.1 Anreizarten
- 2.3.2.1.1 Intrinsische Anreize
- 2.3.2.1.2 Extrinsische Anreize
- 2.3.2.2 Anforderungen an Anreizsysteme
- 3. Wissensmanagement und Anreizsysteme in Bildungseinrichtungen
- 3.1 Bedeutung des Wissensmanagements für Bildungseinrichtungen
- 3.2 Wissen in Bildungseinrichtungen
- 3.3 Kommunikationsstörungen und Ursachen für einen defizitären Wissenstransfer
- 3.3.1 Symptome von Kommunikationsstörungen
- 3.3.2 Ursachen und Hindernisse für den Wissenstransfer
- 3.4 Geeignete Anreizsysteme in Bildungseinrichtungen
- 3.5 Anreizsysteme und ihre Anforderungen im Wissensmanagement
- 3.5.1 Anforderungen an Anreizsysteme im Wissensmanagement
- 3.5.2 Den Wissenstransfer fördernde Anreizinstrumente
- 4. Erfolgsfaktoren für die Umsetzung von Wissensmanagement
- 4.1 Unternehmenskultur
- 4.2 Strukturen und Prozesse
- 4.3 Informations- und Kommunikationstechnologien
- 4.4 Motivation und Fähigkeiten der Mitarbeiter
- 4.5 Unterstützung des Managements
- 5. Maßnahmen zur Förderung des Wissenstransfers in Bildungseinrichtungen
- 5.1 Erfolgskonzept: Community of Practice
- 5.1.1 Chancen von CoP
- 5.1.2 Rahmenbedingungen für CoP
- 5.1.3 Dilemma der Communities of Practice
- 5.2 Der narrative Ansatz für die Wissenskommunikation
- 5.2.1 Hintergründe zum Erfahrungswissen
- 5.2.2 Story telling als Chance für den Wissenstransfer
- 5.2.2.1 Grenzen des Story tellings für den Wissenstransfer
- 5.3 Generationsübergreifendes Arbeiten
- 5.3.1 Wissenstransfer durch altersgemischte Tandems
- 5.3.2 Wissenstransfer durch altersgemischtes Mentoring
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterthesis befasst sich mit dem Wissenstransfer in Bildungseinrichtungen und analysiert, wie dieser unter Einbeziehung von Anreizsystemen verbessert werden kann.
- Die Arbeit untersucht die Rolle des Wissensmanagements in Bildungseinrichtungen.
- Sie beleuchtet die Bedeutung von Anreizsystemen für die Förderung des Wissenstransfers.
- Die Thesis analysiert die besonderen Herausforderungen im Kontext von Non-Profit-Organisationen.
- Sie untersucht verschiedene Ansätze zur Wissenskommunikation, wie z.B. Story telling und Community of Practice.
- Schließlich werden konkrete Maßnahmen zur Förderung des Wissenstransfers in Bildungseinrichtungen vorgestellt.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik des Wissenstransfers in Bildungseinrichtungen ein und stellt die Forschungsfrage sowie das Ziel der Arbeit vor. Kapitel 2 legt den theoretischen Rahmen für die Untersuchung. Es werden die Konzepte von Wissensmanagement und Bildungsmanagement, verschiedene Wissensarten, Modelle des Wissenstransfers und Probleme im Wissenstransferprozess diskutiert. Außerdem werden die Besonderheiten von Bildungseinrichtungen als Non-Profit-Organisationen und die Bedeutung von Anreizsystemen im Kontext von Motivation erläutert.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem Wissenstransfer in Bildungseinrichtungen im Kontext von Anreizsystemen. Es werden Kommunikationsstörungen und Ursachen für einen defizitären Wissenstransfer in Bildungseinrichtungen analysiert. Anschließend werden geeignete Anreizsysteme für Bildungseinrichtungen vorgestellt und die Anforderungen an solche Anreizsysteme im Wissensmanagement beleuchtet.
Kapitel 4 untersucht Erfolgsfaktoren für die Umsetzung von Wissensmanagement. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung der Unternehmenskultur, Strukturen und Prozesse, Informations- und Kommunikationstechnologien, Motivation und Fähigkeiten der Mitarbeiter sowie die Unterstützung des Managements für eine erfolgreiche Wissensmanagementstrategie.
In Kapitel 5 werden konkrete Maßnahmen zur Förderung des Wissenstransfers in Bildungseinrichtungen vorgestellt. Das Erfolgskonzept der Community of Practice wird als Ansatz für die Wissenskommunikation erläutert, und es werden die Chancen, Rahmenbedingungen und Herausforderungen von CoP analysiert. Der narrative Ansatz für die Wissenskommunikation und die Rolle von Story telling als Chance für den Wissenstransfer werden diskutiert. Darüber hinaus werden generationsübergreifende Arbeitsformen wie Tandems und Mentoring als Möglichkeiten für den Wissenstransfer vorgestellt.
Schlüsselwörter
Wissensmanagement, Wissenstransfer, Bildungseinrichtungen, Non-Profit-Organisationen, Anreizsysteme, Motivation, Community of Practice, Story telling, Generationsübergreifendes Arbeiten.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Wissensmanagement für Bildungseinrichtungen wichtig?
Bildungseinrichtungen stehen in einer dynamischen Umwelt im Wettbewerb. Wissensmanagement hilft dabei, Wissen als Ressource zu sichern, innovative Bildungsprodukte zu entwickeln und die Kompetenzen der Mitarbeiter zu fördern.
Was ist das Münchener Wissensmanagement Modell?
Es ist ein Modell von Reinmann-Rothmeier und Mandl, das sowohl betriebswirtschaftliche als auch psychologisch-pädagogische Aspekte vereint und sich daher besonders gut für den Bildungssektor eignet.
Welche Rolle spielen Anreizsysteme im Bildungssektor?
Anreize motivieren Mitarbeiter zum Wissenstransfer. Im Bildungsbereich werden oft nicht-monetäre Anreize genutzt, die aus der Personalentwicklung stammen, um den Austausch von Know-how zu fördern.
Was versteht man unter einer „Community of Practice“?
Dies ist eine Gruppe von Menschen, die ähnliche Aufgaben bearbeiten und voneinander lernen. Sie gilt als Erfolgskonzept für den informellen Wissenstransfer in Organisationen.
Wie kann „Storytelling“ beim Wissenstransfer helfen?
Durch den narrativen Ansatz können Erfahrungen und implizites Wissen anschaulich weitergegeben werden, was besonders beim generationsübergreifenden Arbeiten (z. B. Tandems oder Mentoring) effektiv ist.
- Quote paper
- Martina Schuster (Author), 2011, Wissensmanagement in Bildungseinrichtungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200728