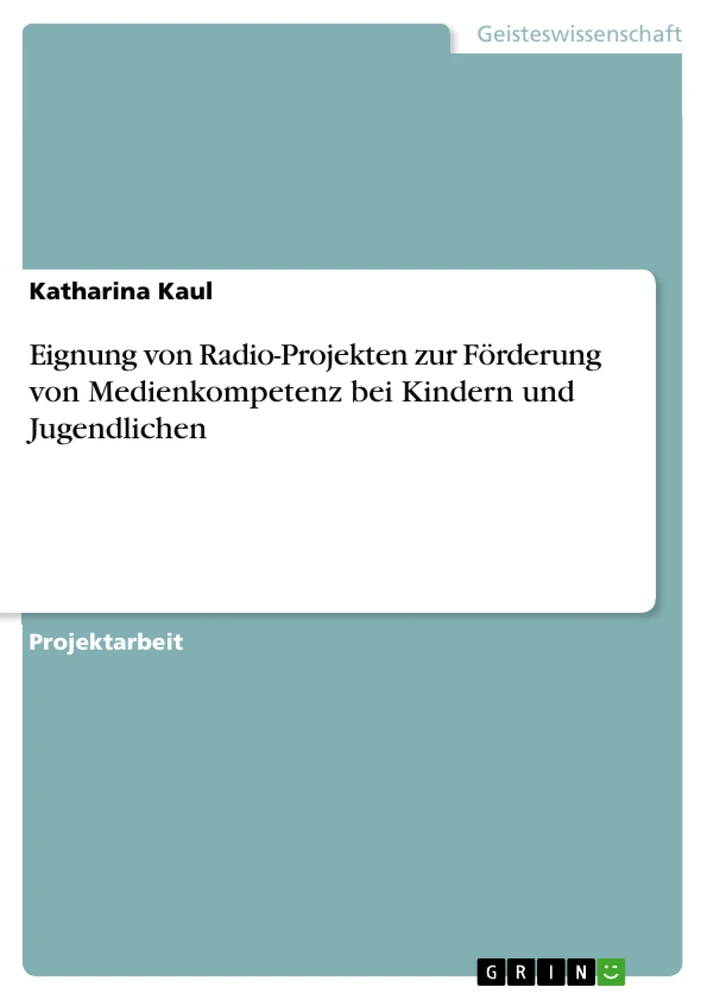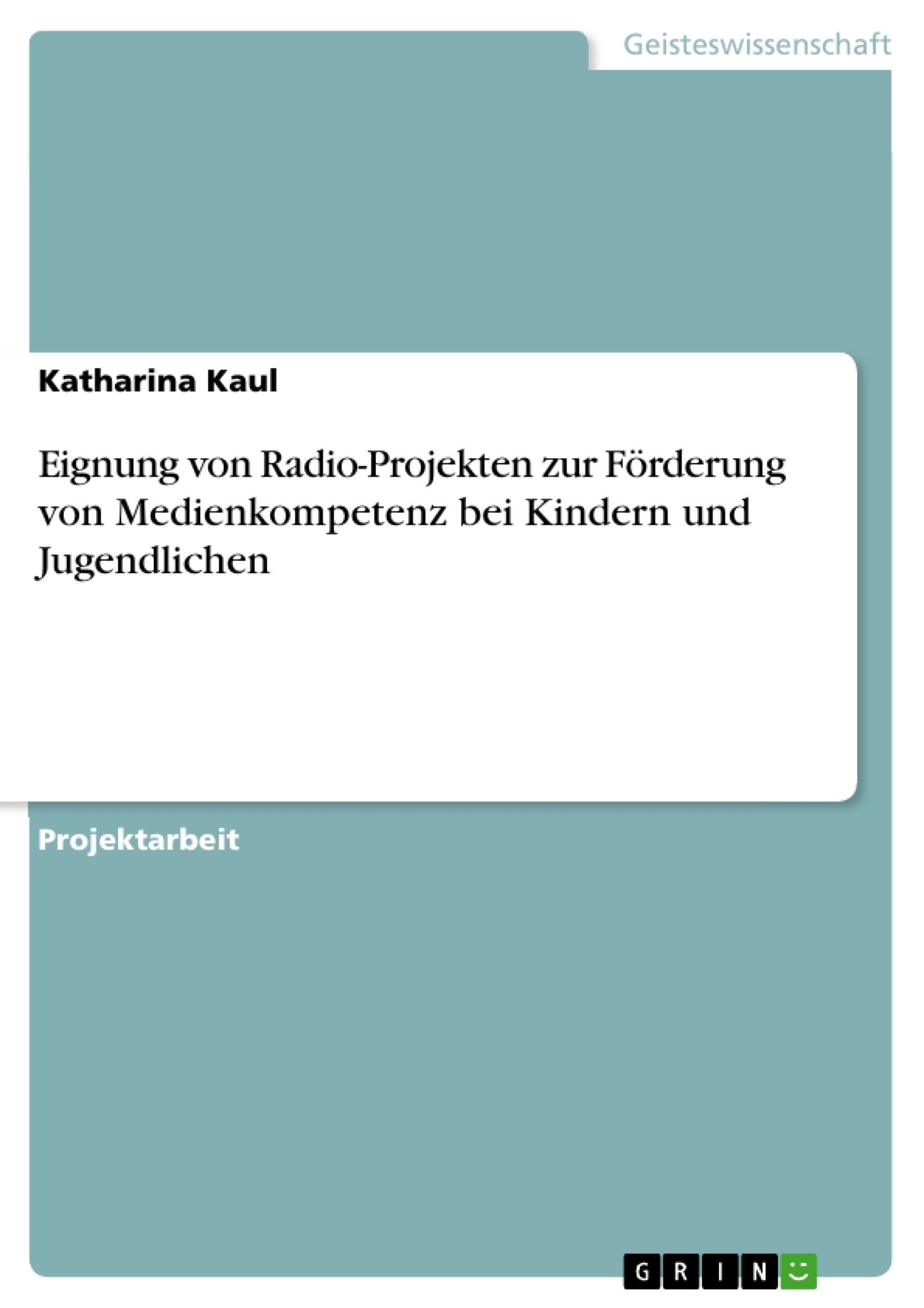Das Medienzeitalter fordert die Menschen heraus, besonders Kinder und Jugendliche, die mit einer Fülle an Möglichkeiten und Informationen konfrontiert sind, mit der sie zunächst kaum umzugehen wissen. Medien bieten die Möglichkeit des Zuganges zu Informationen und somit der Meinungsbildung und Orientierung, der Teilhabe an Gesellschaft, der vereinfachten Kommunikation und viele weitere Funktionen, wenn der Nutzer sie kompetent anzuwenden weiß. Dabei sind Kinder und Jugendliche selbst, aber auch Eltern und Erziehungspersonen mit dem eigenen Medienkonsum und der Anleitung ihrer Kinder oft überfordert. Darauf weist zum Beispiel der aktuelle Werbespot „Wo ist Klaus?“ von ‚klicksafe‘ hin: Der provokante Werbefilm zeigt eine anscheinend naive Mutter, die als gefährlich einzuordnende Gestalten freundlich zu ihrem Sohn durchlässt und ihre Tochter einem fremden Mann überlässt, der ihr seinen Hasen zeigen möchte. So zeigt der Spot eindringlich Gefahren von Medien auf, hier des Internets, und spricht nicht nur Eltern oder Erziehungspersonen, sondern auch die Kinder und Jugendlichen direkt an. Der Film offenbart dabei auch die große Notwendigkeit, Kinder und Jugendliche darin anzuleiten, solche Gefahren zu erkennen, zu vermeiden und die von ihnen genutzten Medien so einzusetzen, das diese sich als konstruktiv und profitabel erweisen.
Viele Jugendliche beherrschen die essentiellen Aspekte der Medienkompetenz nur ansatzweise und haben hier hohen Förderbedarf. Diese Erfahrung habe ich in meinem Praxissemester in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit der ‚Katholischen Jugendwerke Rhein.-Berg. e.V.‘ gemacht. In der daraus resultierenden Suche, nach einer geeigneten Möglichkeit, diese Fähigkeiten zu fördern, schien mir ein Projekt, in dem die Jugendlichen selbst Medien herstellen, am geeignetsten. Der besonderen Herausforderung, dass es sich bei der Zielgruppe um Jugendliche mit und ohne Behinderung handelt, wurde in meinen Augen ein Radio-Projekt gerecht.
Die besondere Eignung von solchen Radio-Projekten zur Medienkompetenzförderung bei Kindern und Jugendlichen soll in dieser Hausarbeit an Hand von Literaturauswertung und unter Berücksichtigung der praktischen Erfahrungen aus dem oben genannten Projekt in einem Theorie-Praxis-Abgleich untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Projektbeschreibung
- Kinder/Jugendliche und Medien
- Bedeutung von Medien
- Bedeutung des Mediums Radio
- Medienkompetenz
- Begriffsklärung Medienkompetenz
- Förderung von Medienkompetenz
- Begegnung des speziellen Bedarfs durch strukturelle Maßnahmen am Beispiel des Landes Nordrhein-Westfalen
- Theorie-Praxis-Abgleich
- Fazit
- Literatur
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Eignung von Radio-Projekten zur Förderung der Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen. Anhand von Literaturrecherche und anhand der Erfahrungen aus einem Radio-Projekt in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit werden die Möglichkeiten und Herausforderungen der Medienkompetenzförderung durch Radio-Projekte beleuchtet.
- Bedeutung von Medien für Kinder und Jugendliche
- Bedeutung und Nutzung des Mediums Radio
- Begriffsklärung und Dimensionen von Medienkompetenz
- Förderung von Medienkompetenz in verschiedenen Kontexten
- Theorie-Praxis-Abgleich: Analyse eines Radio-Projekts und seine Auswirkungen auf die Medienkompetenzförderung
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Problemstellung vor und erläutert den Hintergrund der Hausarbeit.
- Kapitel 2 beschreibt das Radio-Projekt „Radio im Cafe Leichtsinn“ und seine Zielgruppe.
- Kapitel 3 beleuchtet die Bedeutung von Medien für Kinder und Jugendliche, insbesondere den Einfluss von Radio.
- Kapitel 4 beschäftigt sich mit dem Begriff der Medienkompetenz, verschiedenen Aspekten der Förderung und den strukturellen Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen.
- Kapitel 5 analysiert die Eignung von Radio-Projekten für die Förderung der Medienkompetenz im Theorie-Praxis-Abgleich.
Schlüsselwörter
Medienkompetenz, Kinder, Jugendliche, Radio, Projektarbeit, Medienpädagogik, Mediennutzung, Medienwirkung, Bürgerfunk, Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen, Medienkritik, Theorie-Praxis-Abgleich, Informationsgesellschaft, digitale Spaltung, Mediensozialisation
Häufig gestellte Fragen
Wie fördern Radio-Projekte die Medienkompetenz?
Indem Kinder und Jugendliche selbst Medien produzieren, lernen sie Gefahren zu erkennen, Informationen kritisch zu hinterfragen und Technik konstruktiv zu nutzen.
Was ist das Ziel des Projekts "Radio im Cafe Leichtsinn"?
Es richtet sich an Jugendliche mit und ohne Behinderung, um durch aktives Radiomachen die Teilhabe und kommunikative Fähigkeiten zu stärken.
Welche Bedeutung hat das Medium Radio heute noch?
Trotz Internet bleibt Radio ein wichtiges Medium zur Meinungsbildung, Orientierung und als niederschwelliger Zugang zur gesellschaftlichen Teilhabe.
Was versteht man unter "Bürgerfunk"?
Bürgerfunk ermöglicht es Laien, eigene Radiobeiträge zu produzieren und auszustrahlen, was ein zentrales Element der Medienpädagogik in NRW ist.
Warum sind viele Jugendliche mit Medien überfordert?
Die Fülle an Informationen und versteckte Gefahren im Netz (z. B. Cybermobbing, Datenschutz) erfordern eine Anleitung, die oft weder Eltern noch Schule allein leisten können.
Was zeigt der Werbespot "Wo ist Klaus?"?
Der Spot von 'klicksafe' verdeutlicht drastisch die Naivität im Umgang mit Internetgefahren und die Notwendigkeit von Medienkompetenz.
- Quote paper
- Katharina Kaul (Author), 2012, Eignung von Radio-Projekten zur Förderung von Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200945