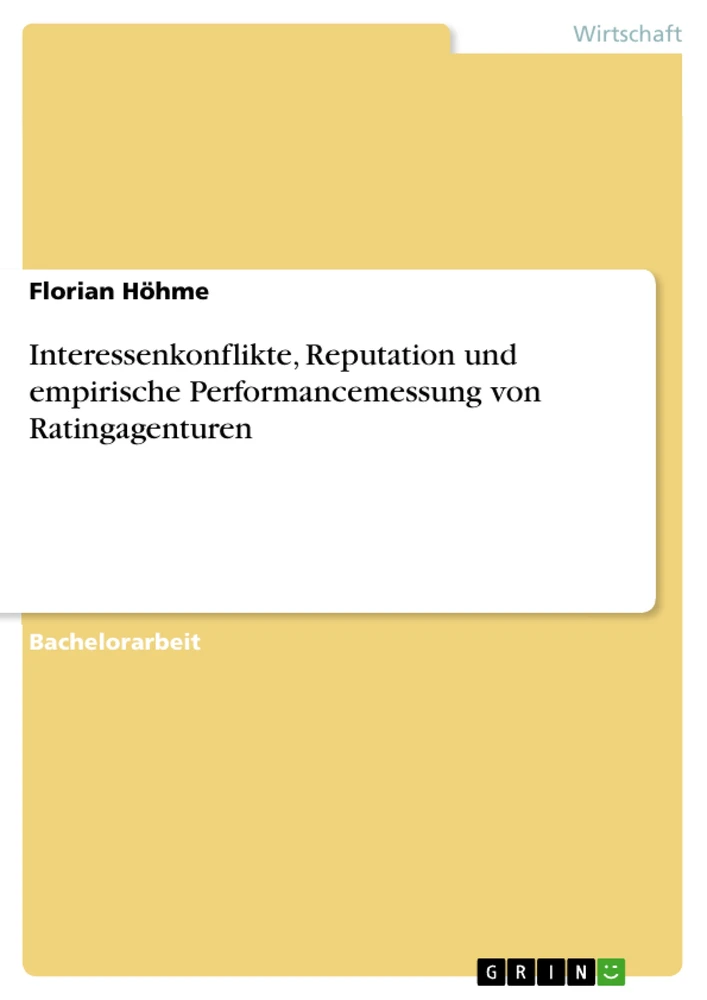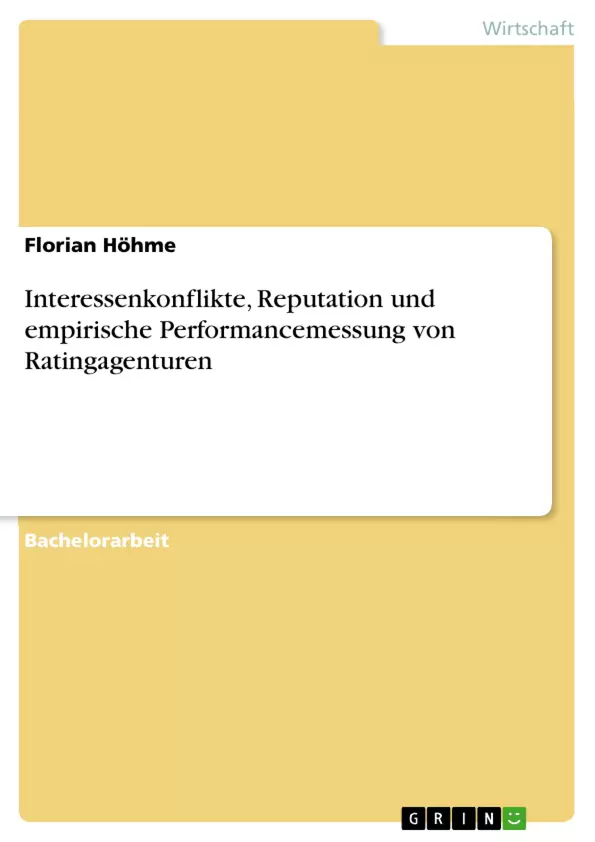In der Folge der Finanzkrise auf dem amerikanischen Sub-Prime Immobilienmarkt und der jüngsten europäischen Staatsschuldenkrise gerieten Ratingagenturen und deren, das Kreditrisiko von Wertpapieren bewertende Ratingurteile, zunehmend in die Kritik. Als unabhängiger Finanzintermediär ist es die Aufgabe der Agenturen auf Kapitalmärkten entstehende Informationsasymmetrien zwischen Kreditnehmern und Kreditgebern durch die Vergabe eines objektiven Bonitätsurteils zu reduzieren. Dieser Aufgabe sei man, so der Vorwurf, nur unzureichend nachgekommen. Es wird bemängelt, dass Risiken von strukturierten Finanzprodukten unterschätzt wurden und Interessenkonflikte existieren, die das objektive Urteilsvermögen behindern, ja sogar die Unabhängigkeit der Ratingagenturen gefährden. Lösungsansätze reichen von der Schaffung einer staatlichen Ratingagentur , über die Implementierung strikterer regulatorischer Maßnahmen , der Gründung einer europäischen Ratingagentur zur Förderung des Wettbewerbs , bis hin zur Forderung sämtliche regulatorischen Abhängigkeiten von Ratings abzuschaffen, um dadurch deren Qualität zu verbessern. In der wissenschaftlichen Literatur lassen sich zahlreiche Beiträge finden, welche die Qualität von Ratings mittels quantitativer Methoden bewerten. Seltener werden jedoch die ökonomischen Anreize der Marktteilnehmer, gesetzliche Rahmenbedingungen, die Marktstruktur, sowie der Wettbewerb der Rating-Industrie und deren Einfluss auf das Verhalten der Ratingagenturen analysiert. In dieser Arbeit wird ein Überblick über die Funktion der Ratingagenturen im System internationaler Finanzmärkte und ihrer Relevanz für die verschiedenen Marktakteure gegeben. Darüberhinaus werden die elementaren Interessenkonflikte, deren Ursachen und die besondere Rolle der Reputation als interessenausgleichender Mechanismus erläutert. Abschliessend wird auf in der Praxis angewandte empirische Methoden der Performancemessung eingegangen und deren positive Effekte auf die Transparenz von Ratings für alle Marktakteure.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- RATINGAGENTUREN IM SYSTEM DER FINANZMÄRKTE
- Historische Entwicklungsgeschichte
- Kreditratings
- ZUR RELEVANZ VON RATINGS
- Emittenten
- Investoren
- Regulatoren
- DIE ROLLE DER REPUTATION
- Der regulierungsfreie Reputationsmechanismus
- Kritik des Modells von Mathis
- INTERESSENKONFLIKTE
- Negative Effekte der Zertifizierungsfunktion
- Marktstruktur und Wettbewerb
- Einseitigkeit des Erlösmodell
- Prozyklizität
- METHODEN DER PERFORMANCEMESSUNG
- CAP‐Kurven und das Accuracy Ratio
- Der Zielkonflikt zwischen Präzision und Stabilität
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht die Rolle von Ratingagenturen im System internationaler Finanzmärkte. Dabei werden insbesondere die Interessenkonflikte, die sich aus der Bewertungstätigkeit der Agenturen ergeben, sowie deren Auswirkungen auf die Qualität der vergebenen Ratings beleuchtet.
- Die historische Entwicklung der Rating‐Industrie
- Die Bedeutung von Ratings für Emittenten, Investoren und Regulatoren
- Der Einfluss von Reputation auf die Objektivität und Unabhängigkeit der Ratingagenturen
- Verschiedene Formen von Interessenkonflikten im Ratingprozess
- Empirische Methoden der Performancemessung zur Bewertung der Qualität von Ratings
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2.1 bietet eine Übersicht über die historische Entwicklung der Rating‐Industrie, die in vier Phasen unterteilt wird. Kapitel 2.2 beschreibt die Funktionsweise von Kreditratings, die eingesetzte Ratingskala, den Prognosehorizont und die von den Ratingagenturen angewandten Methoden. Kapitel 3 analysiert die Relevanz von Ratings für verschiedene Interessengruppen, darunter Emittenten, Investoren und Regulatoren. Kapitel 4 beleuchtet die Rolle der Reputation als interessenausgleichender Mechanismus und präsentiert ein Modell von Mathis et al., das die Entstehung von Reputationszyklen beschreibt. Kapitel 5 untersucht verschiedene Formen von Interessenkonflikten, die sich aus der Zertifizierungsfunktion von Ratings, der Marktstruktur, dem Erlösmodell und der Prozyklizität von Ratings ergeben. Schlussendlich werden in Kapitel 6 verschiedene empirische Methoden der Performancemessung vorgestellt, die zur Bewertung der Qualität von Ratings eingesetzt werden können.
Schlüsselwörter
Ratingagenturen, Kreditratings, Informationsasymmetrien, Reputation, Interessenkonflikte, Performancemessung, Prozyklizität, Zertifizierungsfunktion, Marktstruktur, Wettbewerb, Erlösmodell, CAP‐Kurven, Accuracy Ratio, EDF.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Hauptaufgabe von Ratingagenturen?
Ratingagenturen fungieren als Informationsintermediäre, die die Kreditwürdigkeit (Bonität) von Emittenten und Wertpapieren bewerten, um Informationsasymmetrien am Markt abzubauen.
Welche Interessenkonflikte bestehen bei Ratingagenturen?
Ein zentraler Konflikt ist das "Issuer-Pay-Modell", bei dem der Emittent für sein eigenes Rating bezahlt, was die Objektivität der Agentur gefährden kann.
Wie wirkt die Reputation als Kontrollmechanismus?
Da das Geschäftsmodell auf Vertrauen basiert, ist der Verlust der Reputation existenzbedrohend. Agenturen haben daher theoretisch einen Anreiz, korrekte Ratings abzugeben.
Was bedeutet "Prozyklizität" bei Ratings?
Prozyklizität bedeutet, dass Ratings in Boomphasen oft zu optimistisch sind und in Krisen durch abrupte Herabstufungen die wirtschaftliche Abwärtsspirale verstärken können.
Wie wird die Qualität von Ratings gemessen?
Zur Performancemessung werden statistische Methoden wie CAP-Kurven (Cumulative Accuracy Profile) und das Accuracy Ratio eingesetzt, um die Prognosegüte zu bestimmen.
- Arbeit zitieren
- Florian Höhme (Autor:in), 2012, Interessenkonflikte, Reputation und empirische Performancemessung von Ratingagenturen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201137